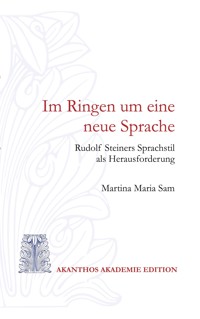
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Rudolf Steiner versuchte in seinen Schriften und Vorträgen mit der teils vernutzten Sprache der Gegenwart so beweglich umzugehen, dass er den spirituellen Inhalten gerecht wurde. Zugleich musste er die Art seines Schreibens und Sprechens so gestalten, dass keine suggestive Beeinflussung stattfand, sondern Leser und Hörer innerlich mitschaffend werden konnten. Wie er diese Anforderungen konkret umzusetzen suchte, wird in den einzelnen Kapiteln dieses Büchleins skizziert. I - Ist Rudolf Steiners Sprache heute noch zu verstehen? II - Warum Rudolf Steiner eine neue Sprache entwickeln musste III - Über den besonderen Charakter der Vorträge IV - Charakterisieren statt Definieren V - Das bildhafte Element in der Sprache VI - Zur Gestaltung und zum Erleben der Mantren VII - Geisteswissenschaftliche Sprache als Kunstwerk
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 106
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INHALT
Vorwort zur zweiten Auflage
Vorwort
Einleitung
I – Ist Rudolf Steiners Sprache heute noch zu verstehen?
Die Irritationen gegenüber dem Stil Rudolf Steiners
Auf der Suche nach einer neuen Sprache
II – Warum Rudolf Steiner eine neue Sprache entwickeln musste
Der Kampf mit der Sprache
Anregung zur freien seelischen Mitarbeit
Freilegen der inneren Sprachgebärden
III – Über den besonderen Charakter der Vorträge
Die Zuhörer arbeiten mit
Der rhetorische Duktus der Vorträge
Ein fortwährend Aktives und Sich-Entwickelndes
IV – Charakterisieren statt Definieren
Emanzipation von der Nomenklatur
Von verschiedenen Seiten um eine offene Mitte
Im Widerspruch und Dazwischen
Feine Nuancen des Geistigen
Verstehen des Geistigen durch Mittun
V – Das bildhafte Element in der Sprache
Ein vorsichtig-vorläufiges Hinweisen
Vergleichendes Sprechen wahrt die Sachgemäßheit
Die ursprüngliche, ätherische Wortgebärde
Das nicht ganz aufgehende Beispiel
Geistige Tätigkeit in der Bild-Entstehung
VI – Zur Gestaltung und zum Erleben der Mantren
In den Sprüchen ist alles bedeutsam
Die Dynamik des Perspektivwechsels
Laut und Lautempfindung
Wortneubildungen aus durchfühlten Lauten
Unausschöpfliche Wortfügungen
VII – Geisteswissenschaftliche Sprache als Kunstwerk
Das anthroposophische Buch – eine Art Partitur
Das künstlerische Moment in der geisteswissenschaftlichen Literatur
Sich in den Quellpunkt der Sprachentstehung versetzen
Das zukünftige Pfingstereignis der Sprache
Literaturverzeichnis
Verzeichnis der zitierten und erwähnten Werke der Rudolf Steiner Gesamtausgabe
Verzeichnis sonstiger zitierter Literatur
Über die Autorin
Weitere Werke der Autorin
VORWORT ZUR ZWEITEN AUFLAGE
Das vorliegende Büchlein ist vor zwanzig Jahren entstanden. Mit der inneren Frage, ob das Geschriebene inzwischen teilweise überholt sein könnte, las ich es – veranlasst zunächst durch eine Anfrage für eine ungarische Übersetzung – vor einiger Zeit wieder durch. Abgesehen von den damals aktuellen Beispielen im ersten Kapitel, so konnte ich sehen, ist das damals Geschriebene aber noch so aktuell wie damals – ja, gewissermaßen noch aktueller.
In jüngster Zeit verursacht ein neues digitales Werkzeug weltweit großes Aufsehen, das Potential hat, unser Leben tiefgreifen zu verändern: der ChatGPT, ein «Generative Pre-trained Transformer», der sich den Anschein gibt, mit uns nicht nur zu «chatten», also zu «plaudern» wie ein echtes Gegenüber, sondern uns auf Fragen aus allen Lebensund Wissensgebieten Antworten geben zu können. Waren die «Antworten» des ChatGPT anfangs oft noch unbeholfen und falsch – was auf den ersten Blick zu erkennen war –, war es für manche Anwender erschreckend festzustellen, wie schnell der Chatbot «lernt», in welch rasender Geschwindigkeit die Antworten geschickter wurden und werden. Das gilt sogar für komplexe anthroposophische Inhalte, wie in der Zeitschrift Die Drei dargelegt wurde.1 Zwar stellte erst neulich der Journalist der deutschen Wochenschrift Der Spiegel, Patrick Beuth, fest, dass Chat-GPT – nachdem er das Programm mit allen seinen bisherigen Texten «gefüttert» und entsprechend programmiert hatte –, die Aufgabe, «in seinem Stil» zu schreiben2, nicht wirklich gelang, aber vermutlich wird es nur eine Frage der Zeit sein, bis ChatGPT auch «individuelle Stile» nachahmen kann.
Das heißt, dass wir in sehr naher Zukunft bei jedem Text vor der Frage stehen werden, ob er von einem «echten Menschen» stammt oder durch geschickte Algorithmen aus einer immensen Fülle von Daten künstlich produziert wurde. Welche Kriterien können wir in der Zukunft überhaupt noch anlegen, um zu wissen, ob etwas «wahr», ob etwas authentisch ist, ob etwas von einem Menschen geschrieben wurde? – Mit diesen Fragen im Hintergrund wurde mir deutlich, wie aktuell der so andere Umgang Rudolf Steiners mit der Sprache ist.
Es wird immer stärker eine Rolle spielen – und für den sensiblen Menschen auch bemerkbar sein –, ob eben ein Text von einem Autor innerlich «erkämpft», errungen wurde. Man wird sich schulen müssen, um abzuspüren, ob Texte in diesem Sinne authentisch sind, d. h. ob der Schreiber mit dem ganzen Gewicht seiner Persönlichkeit dahintersteht.
Rudolf Steiner machte vor über hundert Jahren darauf aufmerksam, dass man z. B. zwar fast wortwörtliche Übereinstimmungen zwischen Aussagen von Herman Grimm und Woodrow Wilson finden könne, dass es aber weniger auf das wörtlich Gesagte ankomme, als auf die Persönlichkeit, die es äußert, bzw. das Ringen, das dahintersteht: «Wir müssen das als ein Zeitenkarma auffassen, müssen uns klar sein darüber, dass wir gerade die Seite unseres Wesens entwickeln müssen, welche in der Lage ist, zu empfinden, ob irgendein Inhalt, ob geistiges Ringen darinnen ist, oder bloß Phraseologie. Das ist es, was man wünschen möchte, dass wiederum Empfindung für die Art und Weise, wie geistige Leistung zustande kommt, entstehen könnte.» Man solle empfinden lernen, dass, wenn man sich damit beschäftigt, wie z. B. Herman Grimm Sätze bildet, «wir eine Verbindung bekommen mit dem wirklich geistig in der Welt Waltenden, während wir bei dem gewöhnlichen Gelehrten-Geplapper mit gar nichts eine Verbindung kriegen, als mit den Verschrobenheiten der betreffenden Herren oder […] Damen»3. Mit also was verbinden wir uns, wenn wir einen Text lesen? Und wie sind wir selbst in unserer inneren Tätigkeit gefordert? Das wird in Zukunft eine wichtige Frage sein, für die es sich zu sensibilisieren gilt.
Niemals werden maschinengenerierte Texte «Aufwecker des Geistlebens» im Menschen sein können, niemals wird man sich das darin Mitgeteilte «aus einer aktiven inneren Tätigkeit selbst erarbeiten»4, niemals wird man im Lesen durch die eigene Tätigkeit «Mitschöpfer» der geschilderten Tatsachen sein können. Von dem, was sich ein Autor in innerer Anstrengung «erkämpft» hat, so Rudolf Steiner, muss man als Leser «selbst wiederum sich jeden Satz erkämpfen»5. Das wird ein wichtiges Kriterium sein: Ob ich mir einen Text erkämpfen muss und auch erkämpfen kann – oder ob er sich mir mühelos andient. Denn: «Die Arbeit, die wir verrichten, indem wir etwas Schwergeschriebenes verstehen lernen, ist eine innere Trainierung, ist etwas, was dazu beiträgt, dass wir in der richtigen Weise unser Verhältnis zur geistigen Welt ausgestalten.»6
Diese Art maschinengenerierter Texte werden auch nie mit uns «wachsen» können. An Büchern, die aus wirklicher Inspiration geschrieben wurden – die Bibel, Dantes Divina Commedia, Goethes Faust, die Werke Rudolf Steiners u. a. m. – , wird man feststellen können, dass man sie auf jeder Lebensstufe neu liest, dass sie uns immer anders antworten, je nachdem, was wir uns innerlich errungen haben. Das wird mit einer Gebrauchsanweisung und eben auch mit künstlich generierten Texten niemals so sein.
In diesem Sinne wäre es brennend wichtig, dass wir uns die Fähigkeit erüben, zu erkennen, «wes Geistes Kind» Texte sind, wie der Autor uns darin gegenübertritt, ob uns Texte innerlich fördern und anregen, ob sie uns ablähmen und zuschütten mit Inhalten, ob sie uns suggestiv beeinflussen oder ob sie uns durch künstlich geschürte Erregung die Nerven kitzeln wollen. Dies auch schon in Schulen zu unterrichten, sich Kompetenzen zu erarbeiten, um die sprachlichen Mittel zu erkennen, mit denen in Texten gearbeitet wird, und zu beobachten, welches Mittel welche Wirkung auslöst – das wird in der Zukunft von größter Bedeutung sein, wenn wir nicht unser Menschsein verlieren wollen, wenn wir nicht untergehen wollen in einer Welt, in der wir die Lüge nicht mehr von der Wahrheit, das Krankmachende nicht mehr vom Gesundheitsfördernden unterscheiden können.
So möge dieses Büchlein die Leser auch darin anregen, diese Unterscheidungsfähigkeit auszubilden, indem hier dem Ringen Rudolf Steiners nachgegangen wird, geistige Inhalte so in Sprache zu prägen, dass der Leser in seiner Tätigkeit angeregt und zugleich in seiner Urteilsbildung freigelassen wird.
Martina Maria Sam Dornach, Osterzeit 2025
1 Siehe dazu den Artikel von Jörg Ewertowski: «Internet oder Print. Einspruch für das gedruckte Wort oder: Die Unverzichtbarkeit von Bibliotheken» in Anthroposophie Nr. 104, Johanni 2023.
2Der Spiegel Nr. 5, 27. Jan. 2024, S. 72f.
3 Vortrag vom 11. Juli 1916, GA 169, S. S. 133f.
4 Aus GA 28, S. 470, sowie aus dem Vortrag vom 4. Mai 1920, GA 334, S. 244; siehe auch Kap. VII.
5 Vortrag vom 16. Okt. 1918, GA 182, S. 188.
6 Vortrag vom 12. Sept. 1915, GA 253, S. 58.
VORWORT
Die sieben Aufsätze, aus denen dieses Büchlein besteht, entstanden im Sommer 2003 als Versuch einer ersten Darstellung einer schon länger währenden Forschungsarbeit über Rudolf Steiners Sprache und Stil und erschienen in einer ersten Fassung in der Wochenschrift Das Goetheanum. Aus der Beobachtung heraus, dass sich zunehmend Menschen mit diesem Stil schwertun – oft gerade auch akademisch gebildete –, ihn mühsam, umständlich und unwissenschaftlich finden, sollen diese Aufsätze einerseits verständlich machen, dass und warum Rudolf Steiner ganz absichtlich nach einem anderen Stil gestrebt hat, andrerseits Mut und Lust wecken, selber auf Entdeckungsreise in diesen besonderen Sprachkosmos zu gehen.
Bei der Suche nach einer repräsentativen, konzentrierten und Übersicht gebenden Darstellung des umfangreichen Materials ergab sich eine sinnvoll erscheinende Gliederung in sieben jeweils in sich abgeschlossene Aufsätze. Wichtig war mir dabei vor allem, die Intentionen Rudolf Steiners bei seinen spezifischen und oft eigenwilligen (Sprach-)Gestaltungen aufzuzeigen und damit eine erste Grundlage für ein tieferes Verstehens zu schaffen.
Im ersten Kapitel kommen zunächst symptomatisch einige, zum Teil prominente Persönlichkeiten zu Wort, die sich an Rudolf Steiners Stil «gerieben» haben, die kein Verständnis dafür aufbringen konnten, warum er eine so unkonventionelle Sprache entwickeln musste. Die wesentlichen Gründe hierfür, die in den Schwierigkeiten wurzeln, die Ergebnisse der Geistesforschung in der heutigen, durch Konventionen geprägten und stark auf die materiellsinnliche Welt ausgerichteten Sprache mitteilen zu müssen, werden in einem zweiten Kapitel vorgestellt. Nach einem Blick auf das spezifische Wesen von Rudolf Steiners Vorträgen (Kap. 3) kommen zwei umfassende Stilprinzipien zur Darstellung, die seine sämtlichen Werke durchziehen: das Charakterisieren (Kap. 4) und sein besonderer Umgang mit dem Bildelement in der Sprache (Kap. 5). Ein eigener Aufsatz ist der Gestaltung von Wahrspruchworten und Mantren gewidmet (Kap. 6), und im abschließenden Aufsatz wird ein Ausblick auf das in Zukunft erst noch zu entwickelnde künstlerisch-sprachschöpferische Element der geisteswissenschaftlichen Darstellung gegeben.
Selbstverständlich kann das Folgende nur eine erste Annäherung sein. Viele andere Zugänge sind noch zu entwickeln, weitere Entdeckungen zu machen. Den zahlreichen Reaktionen und Leserbriefen, die ich infolge der ersten Veröffentlichung in der Wochenschrift Das Goetheanum im Herbst 2003) erhielt, konnte ich entnehmen, dass viele Menschen sich dazu angeregt fühlten. Dies mag begründen, dass die Aufsätze für einen erweiterten Umkreis gesammelt als Buchedition herausgegeben werden.
Danken möchte ich an dieser Stelle ganz herzlich Johannes Kiersch (†) und Heinz Zimmermann (†), die mich zu diesem reichen und fruchtbaren Forschungsfeld hingeführt haben.
Martina Maria Sam Dornach, Februar 2004
Rudolf Steiner 1905, Foto von Otto Rietmann
EINLEITUNG
Anfang der 2000er Jahre erregte eine internationale Studie nachhaltiges Aufsehen: Die PISA-Studie verglich weltweit wiederholt die Lesekompetenz 15-jähriger Schüler. Die Ergebnisse spiegelten ein erschreckendes Bild wachsender Leseunlust und -Unfähigkeit wider: Rund ein Drittel der Jugendlichen weltweit lesen nie freiwillig ein Buch; und einem nicht unwesentlichen Teil der Schüler bleiben selbst einfachste Texte unverständlich. Es gibt vielfältige Untersuchungen, die darauf hinweisen, dass es heutzutage mit der Lesekompetenz und Leselust von Erwachsenen nicht viel besser aussieht: Immer weniger Menschen greifen überhaupt zu Büchern, viele können nicht verstehen, was sie lesen (müssen), und auch die Verweildauer bei einzelnen Büchern wird immer kürzer.
Angesichts dieser allgemeinen Tendenzen erstaunt es nicht, dass auch anthroposophisch interessierte Menschen zunehmend äußern, die Lektüre von Rudolf Steiners Werken sei ihnen zu schwierig. Es werden Forderungen laut, seinen umständlichen, unnötig komplizierten und «altmodischen» Stil in «modernes Deutsch» umzuschreiben. Die Inhalte, so die Argumentation, seien so wertvoll und anregend, dass sie den heutigen Menschen nicht unbekannt bleiben sollten; damit die Suchenden auch Zugang zu ihnen fänden, gelte es, sie von der altertümlichen Form zu befreien.
Wer solches fordert, liegt im Trend der Zeit: «Lesen» wird im Sinne der PISA-Studie als reiner Prozess der Informationsentnahme verstanden. Es geht darum, die inhaltlichen Aussagen herauszuschälen und sie in sein bisheriges Weltwissen zu integrieren – ob aus einem Text, aus Tabellen, Organigrammen oder Kurven, ist letztlich egal: «Lesekompetenz heißt,» – so die Autoren der Studie –, «geschriebene Texte zu verstehen, zu nutzen und über sie zu reflektieren, um eigene Ziele zu erreichen, das eigene Wissen und Potenzial weiterzuentwickeln und am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen.»7
Ein solches «Lesen» wird durch die modernen Medien stark begünstigt, insbesondere durch das Internet: «Der netzorientierte Leser ‹scannt› die Texte, sucht Textbrocken statt leseaufwendigen Texten», so der Leseforscher Goedart Palm.8 Man springt von Information zu Information, von Sensation zu Sensation. Das aber heißt: Man verbindet sich gar nicht mehr wirklich mit einem Text, lässt sich nicht tiefer auf ihn ein.
Angesichts der ungeheuren Datenfluten, die einem heute entgegentreten, ist verständlich, dass ein Lesestil in dieser Art angestrebt und eingeübt wird: Wie sonst soll man die Textmassen bewältigen, wie sonst das für sich Relevante herausfinden?





























