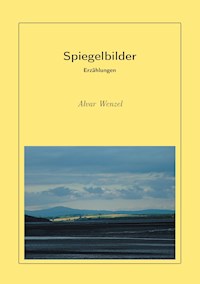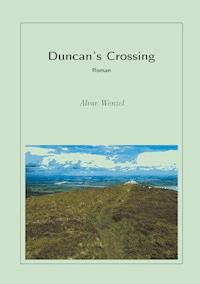Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Sorgen und Wünsche ganz unterschiedlicher Menschen stehen im Mittelpunkt dieser Sammlung von Erzählungen. Ein frustrierter Angestellter, ein verarmter Familienvater, eine ausgenutzte Studentin, ein vereinsamter alter Mann und ein karrieresüchtiger Manager - sie alle möchten sich ihren Lebenstraum erfüllen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 427
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Karamunga
Prüfungen
Befreiungsschlag
Geistesherbst
Das Buch
Ivy
Nachwort
Literaturverzeichnis
Karamunga
MEINE HEIMAT, die Insel Keras, liegt im Südpazifik. Keras ist wirtschaftlich und auch von seiner Größe her derart unbedeutend, dass nur die Wenigsten je davon gehört haben. Und das ist gut so: Denn auf diese Weise ist meine Heimat bis heute landschaftlich ein Paradies geblieben.
Wie die meisten Inseln dieser Region ist auch Keras vulkanischen Ursprungs. Seine Silhouette wird durch den Vulkan Karamunga bestimmt, der bis heute aktiv ist. Die gelegentlichen Kapriolen des Vulkans stellen den einzigen Anlass dar, aus dem unsere Insel hin und wieder überhaupt in den Weltmedien Erwähnung findet.
Dies war erneut der Fall unmittelbar vor den Ereignissen, über die ich nun berichten will. Denn von Vulkanologen aus aller Welt wurde die Prognose erstellt, dass eine gewaltige Eruption des Karamunga zu befürchten sei. Die Regierung auf dem Festland schätzte daraufhin die Gefahr hoch genug ein, um die vollständige Evakuierung von Keras anzuordnen.
Vor wenigen Wochen wurde diese Evakuierung abgeschlossen. Ich selbst jedoch verblieb auf der Insel. Niemandem gelang es mich zu überzeugen, meine Heimat ein weiteres Mal zu verlassen. Die Ankündigung der drohenden Katastrophe schreckte mich wenig, obwohl die Computersimulationen, die man uns im Fernsehen sensationelle vorführte, eine schreckliche Vernichtung allen Lebens auf der Insel durch Lava und pyroklastische Ströme in Aussicht stellten.
Wer jedoch, wie ich, unzählige Warnungen dieser Art in den vergangenen Jahrzehnten erlebt hat, musste sich zwangsläufig zum Skeptiker entwickeln. Zudem wurden die Prognosen der Vulkanologen mit dem Zusatz versehen, man könne sich selbstverständlich bei solch einer Vorhersage auch irren, denn die Bestimmung von Vulkanausbrüchen hinge von zu vielen, teilweise noch nicht ausreichend erforschten Faktoren ab; erst recht ließe sich die Stärke einer möglicherweise drohenden Eruption nicht ausreichend genau vorhersagen. Dieser Zusatz wurde von den Medien allerdings unterschlagen, da er den Sensationsmeldungen ihre Dramatik genommen hätte.
Gewiss meinten die Wissenschaftler es gut mit ihren Warnungen: und sie hatten sicherlich auch genügend Anlass dazu. Doch unter derart ungewissen Vorbedingungen wollte ich meine Heimat nicht aufgeben. Zu sehr hänge ich an diesem wunderbaren Stück Erde, das unser Volk hat heranwachsen sehen und dessen Teil wir im Laufe der Jahrhunderte geworden sind — gerade so, wie auch das Land ein Teil von uns wurde. Dieses Stück Heimat ist überdies alles, was ich in dieser Welt noch besitze. In den Großstädten des Festlands hingegen, wohin die anderen meines Volkes evakuiert wurden, würde ich mich wie ein endgültig Vertriebener fühlen.
Alle anderen meines Volkes hatten sich jedoch von der Regierungüberzeugen lassen, dass ihr Leben auf Keras in größter Gefahr sei. Als dann auch noch, vor wenigen Wochen, der Vulkan Karamunga anfing, Lava zu spucken und Asche zu husten, da verließen sie willig unsere Heimat.
Sie flüchteten in die tristen Großstädte auf dem Festland, in die Auffanglager in der Nachbarschaft von Industriegebieten und Slums. Die riesigen Städte, in die sie verschlagen worden waren, verschlangen die Menschen meines Volkes; sie gingen unter in deren gewaltigen Unpersönlichkeit. Ich konnte nur hoffen, mein Volk würde eines Tages den Weg zurück nach Keras finden und nicht den Versuchungen erliegen, denen man auf dem Festland ausgesetzt ist. Denn dieselben Städte, von denen mein Volk sich nun Zuflucht und Rettung erhoffte, würden ihm auf Dauer vor allem Armut und Elend bringen. Es würde dort Sonne und blauen Himmel, Natur und Meer, vor allem aber die Freiheit und die Einfachheit des Lebens auf unserer Heimatinsel vermissen — wie ich aus eigener Erfahrung nur allzu gut wusste.
Nun, nach dem Exodus, erschien mir, dem Einzigen, der hier zurückgeblieben ist, die gesamte Insel einsam und leer, verlassen und verloren. Dies galt ebenso für das Haus meiner Vorfahren, in dem ich lebte: ein zweistöckiges Ziegelsteingebäude, das auf einem dem Karamunga gegenüberliegenden Bergrücken gebaut wurde und von dessen Veranda aus man einen ungehinderten Blick auf den Vulkangipfel hat. In einer sanft geschwungenen Meeresbucht, die sich zwischen von Haus und Vulkan hinzog, lag der nun wie ausgestorbene Hafen von Keras. Der Hauptort der Insel befand sich direkt daneben, von meinem Hause aus jedoch nicht einzusehen.
DIESES HAUS MEINER VORFAHREN war der Aussichtspunkt, von dem aus ich an jedem Tag neugierig verfolgte, was der alte Gott Karamunga in seinem Aufruhr so alles trieb. Was er, im wahrsten Sinne des Wortes, so von sich gab: Es waren Unmengen von Rauch und Asche, die er in den blauen Himmel über der Insel spie. Tag für Tag qualmte er voll Zorn, wie ein in seiner Ruhe gestörter Gigant aus grauer Vorzeit. Sein schwarzer, schwerer Atem verdunkelte gelegentlich sogar die Sonne.
Und doch verspürte ich niemals Furcht vor diesem Riesen. Denn schon für unsere Vorfahren war der heidnische Vulkangott stets wie ein großer Bruder gewesen, der über unser aller Leben wachte. Jeden Abend saß ich daher auf der breiten Holzbank auf der Veranda vor meinem Haus und genoss den durch die Aschepartikel in der Atmosphäre besonders beeindruckend wirkenden Untergang einer die Welt blutrot färbenden Sonne.
Während ich so die Launen des urzeitlichen Gottes verfolgte, dachte ich zurück an die verschiedenen Stationen meines Lebens. Schauplatz der glücklichsten davon war stets die Insel Keras gewesen. Doch ich dachte auch zurück an die mühevollen Jahre in der Fremde, die ich als Anwalt auf dem Festland verbracht hatte. In dieser Zeit der Entfremdung hatte mein allmählich sich verhärtendes Herz sich stets nach der alten Heimat gesehnt.
Mein Vater war vor langer Zeit sogar auf dem Festland gestorben. Die Versprechungen der großen Firmen von sicheren und gut bezahlten Arbeitsplätzen hatten ihn dorthin gelockt. Mit großem Bedauern hatte er meine Mutter und mich auf Keras zurückgelassen — doch das versprochene Glück hatte er auf dem Festland nicht gefunden. Da ich selbst nicht, wie er, in der Fremde sterben wollte, sondern in der Heimat, war es weder der Regierung noch den Gewalten der Natur gelungen, mich nun von Keras zu vertreiben.
Vielleicht wäre es anders gewesen, wenn meine Familie noch am Leben gewesen wäre. Doch meine Frau und die beiden Kinder waren vor siebenundzwanzig Jahren bei einem schrecklichen Verkehrsunfall ums Leben gekommen — auf dem Festland. Ich hatte sie schließlich nach Hause geholt, wie damals auch meinen Vater. Nun war ich der letzte unserer Familie, und es gab daher niemanden mehr, auf den ich bei meinen Entscheidungen Rücksicht nehmen musste.
Wie groß aber war überhaupt die Gefahr, durch einen Vulkanausbruch zu sterben? Einem Vulkanausbruch, der, wenn er denn tatsächlich stattfand, sich nur vielleicht bis auf meine Seite der Insel hin auswirkte? Diese Fragen konnten die Wissenschaftler nicht mit Bestimmtheit beantworten: und sie gaben dies offen zu. Daher vertraute ich statt dessen auf die Weisheit und die Güte des großen Bruders Karamunga.
Ohnehin erschien mir mein Dasein seit dem Tod meiner Familie oft genug sinnlos und leer, sofern nicht das Leben auf Keras es erfüllte. Auf der breiten Holzbank, auf der ich mich nun des Abends allein niederließ, hatte in meiner Kindheit die gesamte Familie kaum Platz gefunden. Damals war es stets fröhlich zugegangen. Wir hatten viel gelacht und uns des Lebens erfreut. Heute aber war mir von all diesen Gesichtern nur noch das des großen Bruders Karamunga geblieben. Er aber beachtete mich nicht einmal, während ich seine Launen verfolgte und mich gleichzeitig fragte, ob auch er noch dieser fröhlicheren Zeiten gedachte.
Unten am Hafen und in dem Hauptort war es still geworden seit der Evakuierung. Ich vermisste den Lärm und den Trubel, die früher Tag für Tag zu mir emporgestiegen waren; ich vermisste sie mehr als ich es zugeben wollte: das laute Rufen spielender Kinder; die Stimmen der am Abend von den Feldern jenseits des Vulkans oder vom Meer heimkehrenden Frauen und Männer; den Geruch des im Freien zubereiteten Essens. All diese Eindrücke, die noch vor wenigen Wochen von dem glücklichen Leben der Menschen auf dieser Insel Zeugnis abgelegt hatten, waren bloß noch Erinnerungen.
Ebenso vermisste ich die regelmäßigen Besuche meiner Freunde. Mit ihnen hatte ich über die wichtigen Dinge des Daseins sprechen können, über die wahren Werte des Lebens; aber auch über die Geschichte unseres Volkes und über die alten Götter — jene Themen also, über die ich in der Fremde so viele Jahre lang hatte schweigen müssen, um nicht belächelt oder gar ausgelacht zu werden. Dabei war in den Liedern meines Volkes so viel Wahres und Schönes enthalten: die überlieferte Weisheit vieler Generationen.
Die Menschen auf dem Festland, in deren Gesellschaft ich viele Jahre meines Berufslebens verbracht hatte und von denen einige wenige ebenfalls zu meinen Freunden geworden waren, hatten für diese Wahrheiten allzu selten Verständnis aufgebracht. Häufig genug beklagten sie sich zwar über die Härten des Lebens und darüber, wie schlecht eine Welt doch sei, in der vor allem Raffgier, Egoismus und Rücksichtslosigkeit zum Erfolg führten. Doch die Weisheit der Götter meines Volkes und die in den überlieferten Gesängen zum Ausdruck kommenden Einsichten berührten sie nicht — obwohl auch sie dadurch vielleicht ein klein wenig glücklicher hätten leben können.
Überdies war es mir stets so erschienen, als sei es nicht allein die Welt als solche, die sich den Menschen gegenüber derart rücksichtslos zeigte, sondern als seien es vielmehr auch unsere Mitmenschen, die einander weder ausreichend Freiraum noch die Möglichkeit zum Glücklichsein gönnten, sobald sie argwöhnten, dadurch selbst auf etwas verzichten zu müssen. Wie viel harmonischer war dagegen doch das Leben auf Keras verlaufen, wie viel größer war der Zusammenhalt unserer kleinen Inselgemeinschaft, als wir unser Leben noch in Abgeschiedenheit hatten verbringen können.
Der Tod meiner Frau und der Kinder hatte mich damals nach Keras zurückkehren lassen; und Jahre später fand ich in der alten Heimat schließlich meinen Frieden. Doch würde es, so fragte ich mich nun, meinem Volk in der Fremde so ergehen wie mir selbst vor Jahrzehnten? Wusste es, worauf es sich da einließ? Mussten unsere Kultur und unser Zusammenhalt sich in den Schmelzöfen jener andersartigen Zivilisation nicht nach und nach auflösen? Würde mein Volk überhaupt noch nach Keras zurückkehren wollen, sobald die Bedrohung durch den Vulkan vorüber war?
Ich hoffte daher auf ihre baldige Rückkehr. Und je früher die Gefahr eines Ausbruchs des Karamunga gebannt war, desto früher konnte mein Volk heimkehren. Daher hoffte ich sogar, wenn es sich denn nicht vermeiden ließ, auf einen möglichst baldigen Ausbruch des Vulkans.
Doch der alte Karamunga war nicht so vorhersagbar, wie es sich die Vulkanologen gewünscht hätten. Die von den Wissenschaftlern in Aussicht gestellte Eruption ließ Woche für Woche auf sich warten. Monat um Monat verging. Und jeden Abend betrachtete ich, während ich auf der Veranda vor meinem Haus saß, die einerseits bedrohlich wirkende, in ihrer Urgewalt andererseits aber auch rein und geläutert erscheinende Gestalt des großen Bruders Karamunga.
Wann endlich würde dieses winzige Loch in der Kruste unseres Planeten sein Feuer ausspeien und danach Ruhe geben, damit mein Volk zurückkehren und mit dem Wiederaufbau beginnen konnte?
Doch das Feuer kam nicht. Die Monate vergingen. Über ein Jahr lang stand ich keinem einzigen Menschen von Angesicht zu Angesicht gegenüber. Die wenigen todesmutigen Wissenschaftler, die hin und wieder mit dem Helikopter zum Vulkankegel flogen, interessierten sich nicht für meine Anwesenheit. Nur einer ihrer Piloten, ein Neffe meiner verstorbenen Frau, zog, um mich zu grüßen, gelegentlich eine Schleife über meinem Haus, das er in der Vergangenheit regelmäßig besucht hatte. Hin und wieder warf er auch ein Paket mit Lebensmitteln für mich am Hafen ab, wo ich es dann später barg. Er winkte mir jedes Mal aus dem Hubschrauber zu, wenn er mich sah, und ich erwiderte seinen Gruß. Doch sein Gesicht konnte ich über die große Entfernung kaum erkennen.
Meine Tage als letzter Einwohner von Keras verliefen mittlerweile stets nach dem gleichen Muster: In beschaulicher Gelassenheit schrieb ich die meiste Zeit über an meiner Studie über die Geschichte unseres Volkes; den Rest des Tages verbrachte ich mit Feldarbeit, Spaziergängen in die Berge oder hinab in die Siedlung; oder ich saß lesend auf der Veranda. Und bei all dem fühlte ich mich in Einklang und Frieden mit Welt und Natur.
DIESE HARMONIE ENDETE eines Nachmittags, als ich mich auf einem meiner Spaziergänge ins Tal hinab befand, nachdem der Neffe meiner Frau vom Hubschrauber aus abermals Lebensmittel für mich abgeworfen hatte. Denn auf dem Weg dorthin stieß ich auf eine am Wegrand unter Laub begrabene Leiche.
Der Tote war etwa fünfzig Jahre alt und mir unbekannt. Er musste, dem Verwesungsgrad nach zu urteilen, vor nicht länger als zwei Tagen gestorben sein.
Offenbar war er ermordet worden.
Der Fund versetzte mich in beträchtliche Unruhe, da ich mich schließlich allein auf der Insel geglaubt hatte: Woher war dieser Mann gekommen? Woher sein Mörder? Und wo befand sich dieser Mörder jetzt?
Dann überwand ich meinen Schock. Die Routine, die ich mir während zahlreicher Strafprozesse angeeignet hatte, gewann glücklicherweise die Oberhand. Ich untersuchte die Leiche genauer, die nur wenige Schritte abseits des Weges gelegen hatte. Sie war zwar großteils mit Laub und etwas Erde bedeckt gewesen, aufgrund des strengen Geruchs hatte ich sie jedoch kaum ignorieren können.
Der Tote war nicht von unserem Volk. Er war außergewöhnlich hellhäutig. Sein Haar jedoch war dunkel, wenn auch grau meliert. Er hatte sich einen Oberlippenbart wachsen lassen und trug leichte Freizeitkleidung: Bootsschuhe, Shorts sowie ein Polohemd — alles teure Qualitätsarbeit.
Die Todesursache schien offensichtlich: Der Schädel war ihm eingeschlagen worden, vermutlich mit einem runden, stumpfen Gegenstand. Er musste auf der Stelle tot gewesen sein.
Die Taschen des Toten waren durchsucht und geleert worden, das Futter war nach außen gekehrt, und deren Inhalt lag neben der Leiche auf dem Boden verstreut. Um Geld oder Wertgegenstände war es dem Täter nicht gegangen, denn eine teure Armbanduhr und verschiedener Schmuck waren noch vorhanden. Was ich jedoch vermisste, war ein Schlüsselbund.
Die Leichenstarre hatte bereits eingesetzt. Der Tod war somit vor vermutlich zwanzig Stunden eingetreten. Und der üble Geruch, der von dem Toten ausging, war in dessen unmittelbarer Nähe kaum zu ertragen. Der Mörder hatte jedoch unter den gegebenen Umständen nicht damit gerechnet, dass die Leiche von jemandem entdeckt wurde, sonst hätte er sie vermutlich vergraben.
Diese Gedanken führten mich erneut zu der Frage, wer der oder die Täter sein konnten und ob sie sich noch auf Keras aufhielten. Vielleicht hatten sie die Insel auch schon längst verlassen, in der Annahme, der bevorstehende Vulkanausbruch würde alle Spuren ihrer Tat verwischen.
Doch mich beunruhigte die Erkenntnis, dass sich in den vergangenen Tagen Menschen in der Nähe meines Hauses aufgehalten hatten, von deren Anwesenheit ich nichts bemerkt hatte. Was war der Grund für ihre Anwesenheit auf Keras? Mit der paradiesischen Beschaulichkeit, die dieser Ort in den vergangenen Monaten für mich verkörpert hatte, war es nun jedenfalls erst einmal vorbei.
Gleichzeitig überkam mich neuer Tatendrang: Ich wollte meine Heimat vor diesen Menschen schützen; denn Verbrecher wie sie hatten auf Keras nichts zu suchen. Nicht nur hatten sie einen Mord begangen, es handelte sich überdies mit hoher Wahrscheinlichkeit um undurchsichtige Angelegenheiten, die sie in solchen Zeiten nach Keras führten.
Damit mir kein Hinweis entging, untersuchte ich die Leiche ein weiteres Mal und mit noch größerer Sorgfalt. Ich griff dabei auf die Kenntnisse zurück, die ich mir als Strafverteidiger zwangsläufig hatte aneignen müssen.
Zunächst interessierte mich das Tatwerkzeug. Die Schlagverletzung am Kopf des Toten wies einen runden Umriss auf, mit einem Durchmesser von etwa dreieinhalb Zentimetern, und befand sich an der linken Schläfe. Der Schädel war in der Mitte der Wunde mehr als einen Zentimeter tief eingedrückt. Die Tatwaffe war daher offenbar wenigstens zum Teil kugelförmig. Vermutlich handelte es sich um ein recht massives Material, und der tödliche Schlag war mit großer Wucht geführt worden, sodass schon dieser einzige Schlag zum Tod geführt hatte. Weitere Verletzungen konnte ich jedenfalls nicht erkennen; auch keine Abwehrverletzungen.
Einige winzige gelbe Metallfragmente, die in der Kopfwunde zurückgeblieben waren, deuteten auf eine Tatwaffe hin, die mit Gold, Messing oder einem ähnlichen Material beschichtet war. Eine chemische Analyse der Fragmente, die weitere Informationen hätte liefern können, war mir freilich nicht möglich. Ich sammelte dennoch Proben in einer kleinen Plastiktüte, für eine mögliche spätere Untersuchung.
Wie jede Leiche gab auch diese Aufschlüsse über die Lebensumstände des Verstorbenen. Der etwa Fünfzigjährige war europäischer Abstammung und hatte sichtlich keinen Hunger leiden müssen, denn er brachte geschätzte zehn Kilogramm Übergewicht auf die Waage. Die Zähne waren kostspielig saniert: Es gab drei Goldkronen, ein Implantat und eine Brücke. Alle künstlichen Bestandteile, vor allem die Goldkronen, waren an den Außenseiten so mit Blendmaterial versehen worden, dass man den Zahnersatz nur aus großer Nähe als solchen identifizieren konnte. Dies bestätigte meinen zuvor schon aufgrund der Kleidung gewonnen Eindruck, der Tote sei wohlhabend gewesen.
Der dichte, sorgfältig gepflegte Oberlippenbart und die elegante Frisur deuteten auf einen Beruf hin, in dem der äußere Anschein eine wichtige Rolle spielte. Außerdem gab es eine Narbe von einer Blinddarmoperation und eine weitere von einer Operation am Knie, vermutlich am Kreuzband. Die Hände des Ermordeten waren kräftig, wiesen aber kaum Hornhaut auf. Offenbar hatte er vorwiegend am Schreibtisch gearbeitet und war keiner schweren körperlichen Tätigkeit nachgegangen. Sein von langen Phasen des Sitzens verformt wirkendes Rückgrat bekräftigte diese Hypothese.
Damit erschöpften sich die Erkenntnisse, die ich unter den gegebenen Umständen aus der Leiche und ihrem Zustand zu gewinnen vermochte.
Ich wandte mich dem Tatort zu. Da Schleifspuren fehlten, konnte man davon ausgehen, dass der Mord an der Stelle erfolgt war, an dem ich den Leichnam entdeckt hatte. Vorsichtig entfernte ich sämtliches Laub, das mögliche Spuren verdeckte. Bald fand ich auf diese Weise Anzeichen für eine Konfrontation zwischen zwei Personen, bei der verschiedene kleinere Pflanzen zertreten worden waren. Diese Pflanzen hatten sich in der Zwischenzeit zwar zum Teil wieder aufgerichtet, doch da es in den vergangenen Tagen nicht geregnet hatte und da der Boden außerdem von Vulkanasche bedeckt war, konnte man die Spuren der Kontrahenten immer noch deutlich genug erkennen.
Systematisch suchte ich zuerst den unmittelbaren Tatort und danach die weitere Umgebung in immer größer werdenden konzentrischen Kreisen ab. Ich wollte herausfinden, aus welcher Richtung Täter und Opfer gekommen und wie viele Personen insgesamt beteiligt gewesen waren.
Dabei entdeckte ich nur die Fußspuren zweier Personen. Die eine davon war diejenige des Toten, was sich durch Vergleich mit den Schuhen des Opfers leicht feststellen ließ. Die andere musste demnach die des Mörders sein; und dies bedeutete auch, dass es sich um einen Einzeltäter handelte.
Die beiden Fußspuren führten zunächst aus verschiedenen Richtungen auf jene Stelle zu, an der es schließlich zum Streit gekommen war. Eine dieser Fährten (die des Mörders, als er den Tatort wieder verließ) führte anschließend zu dem Pfad, der die Verbindung von dieser Seite der Insel zum Hauptort darstellte. Dort verlor sich die Fußspur in dem festgetretenen Untergrund.
Der Ermordete war wohl aus Richtung der kleinen Anlegestelle gekommen, die etwa zwei Kilometer vom Hafen entfernt an der Küste lag und die vor allem von kleineren Booten genutzt wurde. Ob er dort tatsächlich an Land gegangen war, ließ sich natürlich nur vermuten.
Der Täter war übrigens aus der gleichen Richtung gekommen und hatte sein Opfer dem Anschein nach durch den Wald verfolgt, indem er sich einige Dutzend Meter parallel zu diesem fortbewegte. Dann hatte er sein Opfer überholt und sich ihm schließlich dort in den Weg gestellt, wo ich auf die Leiche gestoßen war.
Offenbar war es am Tatort zunächst nur zu einem Wortgefecht gekommen, denn der Boden war an zwei mehr als einen Meter voneinander entfernt liegenden Stellen stark aufgewühlt, so als wären Täter und Opfer in ihrer Aufregung mehrfach auf der Stelle hin und her getreten. Dann waren beide, wie sehr tiefe und deutlich sichtbare Fußabdrücke bewiesen, aufeinander zu getreten. Am Punkt ihres Zusammentreffens hatte der Mörder sein Opfer schließlich erschlagen, mit Hilfe des noch unbekannten, vermutlich runden metallischen Gegenstands.
Diese Indizien, vor allem das der Tat vorausgehende Wortgefecht, konnten auf einen Totschlag im Affekt hinweisen, auch wenn die vorausgegangene Verfolgung des Opfers durch den Wald für ein geplantes Delikt sprach. Weitere Erkenntnisse vermochte ich dem Tatort nicht abzugewinnen.
Ich erwog meine weiteren Schritte. Sollte ich mich auf die Suche nach dem Täter machen, der sich womöglich noch auf der Insel aufhielt? Es schien mir jedoch wahrscheinlicher, dass er Keras nach dem Mord so rasch wie möglich verlassen hatte und die Beseitigung aller Beweise dem Vulkan überlassen wollte. Selbst wenn er sich noch unten im Ort mit Vorräten eingedeckt hatte, war er inzwischen vermutlich auf und davon.
Eines aber konnte ich tun; Folgte ich den Fußspuren des Opfers zurück und führten sie tatsächlich zu der kleinen Anlegestelle, so entdeckte ich dort vielleicht das Boot, mit dem der Tote auf die Insel gekommen war. So konnte ich weitere Informationen über seine Identität und seine Absichten erhalten.
Doch was, wenn der Täter sich noch auf der Insel befand? Was, wenn er jene Angelegenheit zu Ende bringen wollte, die ihn überhaupt erst hierhergeführt und für die er sogar einen Mord begangen hatte? Ich besaß schließlich keinen Hinweis darauf, worum es sich dabei handelte. In diesem Fall musste ich auf der Hut sein und war selbst in Gefahr.
Heute war es jedoch zu spät für weitere Untersuchungen. Bald würde die Nacht hereinbrechen, und schon jetzt stand die Sonne im Westen dicht über dem azurblauen, spiegelglatten Ozean. Während ich es das erste Mal seit langer Zeit bedauerte, nicht über ein leistungsstarkes Funkgerät zu verfügen, färbte der Himmel sich einmal mehr blutrot über dem Gipfel des großen Bruders Karamunga.
WÄHREND DER NACHT erwachte ich mehrere Male, da unter den Tieren, die in der Wildnis rund um mein Heim hausten, eine ungewöhnliche Unruhe herrschte. Zunächst vermutete ich als Ursache Angst vor dem drohenden Vulkanausbruch; denn Tiere erahnten mit ihrem überlegenen Instinkt und ihren fein ausgeprägten Sinnesorganen derartige Ereignisse lange vor uns Menschen.
Doch bald erkannte ich, dass die Unruhe sich nur auf die Gegend unterhalb meines Hauses konzentrierte und der Vulkan daher nicht der Auslöser sein konnte. Vielmehr trieb sich ein Mensch oder ein Raubtier dort unten zwischen Hauptort und Berghang herum.
Bald war ich mir sicher, dass es kein Raubtier, sondern ein Mensch war — denn kein Raubtier bewegte sich derart auffällig. War der Mörder etwa im Schutz der Dunkelheit zurückgekehrt, um die Spuren seiner Tat doch noch zu beseitigen? Hatte er dabei festgestellt, dass sein Verbrechen entdeckt worden war und sich daher auf die Suche gemacht, um den unerwarteten Zeugen seines Verbrechens zum Schweigen zu bringen?
Es war mein Glück, dass ich so weit abseits der Siedlung lebte und am gestrigen Abend, aufgrund meiner Erschöpfung, kein Licht mehr angezündet hatte, sondern sogleich zu Bett gegangen war. So konnte der Mörder nicht wissen, wo ich mich befand. Falls er außerdem am Vormittag den Hubschrauber beobachtet hatte, als dieser das Lebensmittelpaket über dem kleinen Hauptort abgeworfen hatte, musste er mich dort unten vermuten.
Gleichwohl war es unheimlich, sich zusammen mit einem Mörder auf der im Übrigen menschenleeren Insel zu wissen. Ich lag hellwach auf meinem Bett und lauschte gebannt auf die Geräusche des Waldes und auf die Rufe der aufgeschreckten Tiere.
Nach einer Weile entfernte sich der Lärm wieder, in Richtung Küste. Von da an wurde ich ruhiger. Offenbar hatte ich in dieser Nacht nichts mehr zu befürchten. Erschöpft von der Anspannung schloss ich die Augen. Es dauerte jedoch lange, bis ich endlich Schlaf fand.
AM FOLGENDEN MORGEN ging ich in aller Frühe zum Meer hinunter, jedoch nicht zum Hauptort, sondern in Richtung der kleinen Anlegestelle, an der ich das Boot des Toten vermutete — und vielleicht auch das seines Mörders. Irgendwie mussten die beiden ja auf die Insel gelangt sein.
Ich wollte äußerste Vorsicht walten lassen, um dem Mörder, der in der Nacht nach mir gesucht hatte, nicht in die Arme zu laufen. Daher hielt ich mich im Schutz der Bäume. Glücklicherweise reichte der Wald bis etwa fünfzig Meter an den Ozean heran.
Am Waldrand angelangt, legte ich mich zunächst im Unterholz auf die Lauer. Meine größte Sorge war, dass der Mörder mich überraschen könnte. Sorgfältig in Deckung bleibend, wartete ich ab, ob er sich auf dem im hellen Sonnenlicht liegenden und für mich gut zu überblickenden Sandstrand zeigen würde. Zahlreiche Boote lagen dort, gut gesichert gegen mögliche Unwetter.
Lange Zeit lag ich vergebens auf der Lauer. Mit einem kleinen Feldstecher suchte ich immer wieder die Küste ab. Nichts regte sich. Meine Knochen schmerzten von der unbequemen Haltung.
Gegen Mittag verlegte ich meinen Beobachtungspunkt etwa fünfhundert Meter weiter nach Süden. Auch von dieser Position aus suchte ich immer wieder mit dem Feldstecher die Umgebung ab. Doch ich entdeckte keine Menschenseele. Immerhin machte ich schließlich ein Ruderboot aus, das jemand besonders weit auf den Strand heraufgezogen und unter Gestrüpp verborgen hatte. Möglicherweise war dies eines der Boote, nach denen ich suchte; die Schleifspuren schienen jedenfalls frisch zu sein.
Nachdem ich die nähere Umgebung aufmerksam abgesucht hatte, schlich ich mich schließlich vorsichtig an das Ruderboot heran, immer in Deckung des Waldrands bleibend. In der Nähe des Bootes versteckte ich mich dann im Gestrüpp. War es das Ruderboot des Mörders, so würde er schließlich hierher zurückkehren, um die Insel zu verlassen. War es das Boot seines Opfers, so würde vielleicht der Mörder ebenfalls danach suchen, um Beweise zu vernichten oder etwas zu finden, das er in den Taschen seines Opfers vergeblich gesucht hatte.
Wie ich jedoch vorgehen wollte, falls ich den Unbekannten tatsächlich aufspürte, das hatte ich mir nicht überlegt. Es gab zu viele Unbekannte in meiner Gleichung. Ich würde daher improvisieren und mein Verhalten von den Umständen abhängig machen. Zunächst musste ich mir einen Eindruck von diesem Menschen verschaffen. Und mit dem Revolver, den ich seit dem heutigen Morgen stets in meiner Jackentasche trug, würde ich ihn hoffentlich in Schach halten können.
Mit mir würde er jedenfalls kein so leichtes Spiel haben wie mit dem Toten oben im Wald.
WO WAR ER NUR, dieser verfluchte Mensch, der die Leiche von Hernandez gefunden hatte? Der meinen Spuren gefolgt war, bevor ich alle Beweise hatte vernichten können? Wer hätte denn überhaupt vermutet, dass noch jemand auf dieser von einer Katastrophe bedrohten Vulkaninsel ausharren würde! Immer wieder spielte mir das Schicksal genau dann einen Streich, wenn ich glaubte, meinem Unglück entronnen zu sein!
Und was sollte ich mit diesem Menschen anfangen, der die Leiche entdeckt hatte, falls ich ihn fand? Sollte ich ihn etwa ebenfalls töten? Gab es nur diesen einen Ausweg? Immer nur: Fressen oder gefressen werden? Ich hasste diesen Menschen doch überhaupt nicht — anders als Hernandez.
Überdies hatte ich auch Hernandez im Wald nicht töten, sondern nur zur Rede stellen wollen. Wegen all des Unrechts, das er mir zugefügt hatte. Doch dann hatte Hernandez mich bis auf das Blut gereizt.
Selbst jetzt, bei der bloßen Erinnerung daran, wallte unbändiger Zorn in mir auf. Hernandez, dieser verteufelte Opportunist, dieser Spekulant auf Kosten des Glücks anderer, war mir nicht nur mit seinen fein gedrechselten Erklärungen und Rechtfertigungen gekommen (die ich schon zu oft von ihm hatte anhören müssen), nicht nur mit den gleichen Ausflüchten, mit deren Hilfe er mir mit der Zeit alles genommen hatte — er hatte mich zu allem Überfluss auch noch boshaft an das erinnert, was ich durch ihn verloren hatte: meine Arbeit, mein Zuhause, meine Familie und meine Zukunft. Selbstgefällig hatte er sich mit der Macht gebrüstet, die er über mein Schicksal besaß. Dies war der Moment gewesen, in dem schließlich etwas in mir ausgerastet war.
Obwohl Hernandez den Tod verdient hatte, bereute ich meine unüberlegte Tat schon nach wenigen Minuten. Doch da war es bereits zu spät gewesen.
Nachdem ich etwas ruhiger geworden war, hatte ich die Taschen meines Feindes nach den Schlüsseln seiner Jacht durchsucht und diese auch gefunden. Anschließend hatte ich die Leiche notdürftig mit Laub bedeckt und war hinunter gegangen zum Meer, um Ruhe und Ordnung in meine Gedanken zu bringen. Dass Hernandez mich, würde ich wegen seiner Ermordung angeklagt werden (und wäre nicht ausgerechnet er selbst das Opfer meiner Tat gewesen), ohne Bedenken vor einem Strafgericht verteidigt hätte, sofern er mit meiner Vertretung nur ausreichend Geld hätte verdienen können, nahm meiner Tat nicht ihr Unrecht. Auch dass Hernandez mich vor Gericht wider besseren Wissens als völlig unschuldig hingestellt hätte, schmälerte mein Verbrechen nicht.
Es bewies nur, dass ihn sein Schicksal nicht völlig unverdient ereilt hatte.
Schlimmer als diese Erinnerungen empfand ich es jedoch, dass ich nun bereits mein nächstes Opfer erwartete und schon seit Stunden in meinem Versteck oberhalb der Anlegestelle des Ruderbootes auf der Lauer lag. Wie ein Raubtier beobachtete ich die Umgebung und wartete auf den Unbekannten, der meine Tat entdeckt hatte und womöglich meinen Fußspuren folgte. Tauchte er hier nicht auf, würde ich heute Abend ein weiteres Mal die Insel nach ihm absuchen, wie in der gestrigen Nacht.
Was ich unternehmen würde, falls er tatsächlich hier erschien, das wusste ich allerdings nicht. Ich wollte mir zunächst ein Bild von ihm machen und erst dann meine Entscheidung treffen. Jedenfalls würde ich ihn nicht so einfach zum Schweigen bringen können, wie es mir bei Hernandez möglich gewesen war. Nicht, weil ich mich davor fürchtete, einen weiteren Menschen anzugreifen; sondern weil mein Zorn sich nicht gegen diesen anderen richtete.
Andererseits stand meine Existenz auf dem Spiel, solange ein Zeuge meiner Tat am Leben war. Oder genauer gesagt: Es stand das auf dem Spiel, was von meiner Existenz noch übrig geblieben war.
Dabei hatte ich die Gewalt so satt! Wie sehr hatte ich mich durch sie in den vergangenen Monaten unter dem Einfluss von Hernandez verändert! Ein derartiger Wutausbruch wie jener, der zu seinem Tod geführt hatte, war meiner Natur früher fremd gewesen. Doch wenn man einen Menschen zu weit treibt, brechen offenbar Urgewalten aus ihm hervor, die alle Zivilisiertheit nicht beiseite drängen kann — auch wenn man dies bei sich selbst nicht für möglich hält.
Ein Knacken im Unterholz unterbrach meinen Gedankengang. Offenbar war der Unbekannte im Anschleichen noch weniger geübt als ich selbst. Aus diesem Grunde hatte ich mich ja auch schon lange vor Sonnenaufgang auf die Lauer gelegt und seither nicht von der Stelle gerührt.
Ich konnte nun deutlich hören, wie jemand sich durch die Bäume unterhalb meines Standorts in Richtung auf das Ruderboot zu bewegte, und duckte mich tiefer in mein Versteck. Endlich sah ich ihn: Der Mann machte einen harmlosen Eindruck; er war etwa fünfundsechzig Jahre alt, für sein Alter rüstig, beweglich und offenbar ein Einheimischer: hager, kurzhaarig, mit wachen Augen. Ein Mann, gegen den ich keinen Groll hegen würde, wäre er mir unter anderen Umständen begegnet. Ein Mann, den zu töten mir schwerfallen würde.
Vorsichtig näherte er sich dem Ruderboot und hielt etwa fünfzehn Meter von diesem entfernt zwischen den Bäumen inne. Dann versteckte er sich im Gestrüpp und rührte sich nicht mehr.
Immer noch war ich unentschlossen. Auf keinen Fall wollte ich einen weiteren Menschen töten, falls es sich vermeiden ließ. Aber die Umstände ließen mir kaum eine Wahl.
Dennoch wartete ich ab. Schließlich wurde der andere ungeduldig. Er richtete sich auf und blickte aufmerksam um sich. Da er sich allein glaubte, ging er hinüber zu dem Ruderboot und untersuchte es sorgfältig. Zwischendurch sah er sich immer wieder besorgt um. Damit, dass ich bereits hier sein und ihn beobachten könnte, rechnete er offenbar nicht.
Sollte ich einfach auf ihn zu gehen und ihm offen meine Lage erklären? Dass ich nicht geplant hatte, Hernandez zu töten? Warum es dennoch geschehen war? Vielleicht zeigte er ja sogar Verständnis für meine Lage, wenn ich ihm die Hintergründe erläuterte.
Welch einen Unsinn ich mir da ausmalte! Ich schüttelte heftig den Kopf. Gerade ich sollte es doch besser wissen! Auch bei Hernandez hatte ich vor Jahren geglaubt, ihm offen entgegentreten und von meinem Standpunkt überzeugen zu können. Auch bei Hernandez hatte ich auf Verständnis für meine Situation und auf seine Unterstützung gehofft. Doch er hatte mein Vertrauen missbraucht und sein Wissen um meine Angelegenheiten zu seinen eigenen Gunsten ausgenutzt.
Und wozu hatte Hernandez’ Verrat an mir geführt? Zunächst hatte auch er nicht das erhalten, was er sich von seiner Hinterlist erhofft hatte. Und am Ende hatte sein Verrat sogar zu seinem eigenen Tod geführt. Ich atmete tief ein. Trotz aller Reue überkam mich auf einmal ein Gefühl der Befriedigung.
Aber wegen genau dieses Verrats war nun auch jener Mann, der jetzt neben dem Ruderboot stand, zu meinem Feind geworden. Und dies erfüllte mich keineswegs mit Befriedigung. Schließlich war ich nicht wie Hernandez. Ich war kein Mensch, der andere so einfach aus dem Weg räumte, nur weil dies meinem Eigennutz diente.
Daher richtete ich mich kurz entschlossen auf und trat aus meinem Versteck hervor. Langsam ging ich auf das Ruderboot zu. Der andere hatte mich noch nicht bemerkt, da er sich über das Ruderboot beugte und mir den Rücken zuwandte.
Als er meine Schritte schließlich hörte, drehte er sich erschrocken um. Dann machte er eine abwehrende Geste und wich zurück. Halbherzig griff er nach einem altersschwachen Revolver, der in seiner Jackentasche steckte. Doch schon war ich bei ihm und hielt seinen Arm fest, noch bevor er die Waffe entsichern und auf mich richten konnte.
Als er erkannte, wie zwecklos sein Bemühen war, gab er den Widerstand auf. Ich ergriff den Revolver und warf ihn hinunter auf den Strand. Dann trat ich einen Schritt von dem Mann zurück.
Weil ich ihn losgelassen hatte, senkte er die Arme, die er abwehrbereit vor die Brust gehoben hatte, und musterte mich gespannt. Seine Überraschung war mit Neugier gemischt. Ein solches Verhalten hatte er nicht von mir erwartet.
Aber auch ich selbst staunte über meine eigene Ruhe angesichts dessen, was für mich auf dem Spiel stand.
DA STAND ER. NUN VOR MIR, der Mann, den ich zu überraschen beabsichtigt hatte. Stattdessen hatte er mir eine Falle gestellt, und ich war ahnungslos hineingetappt. Meinen Revolver hatte er mir ohne Mühe abgenommen. Jetzt lag die Waffe unten auf den Strand, für mich unerreichbar.
Erstaunlicherweise trat der andere von mir zurück, nun, da er mich entwaffnet hatte und sein Werk leicht vollenden konnte. Spielte er etwa mit mir? Auch ohne mich anzugreifen, wirkte er bedrohlich genug: eine beeindruckende Gestalt, kräftig und stark. Für einen Mann in meinem Alter war er als Gegner unüberwindlich.
Unauffällig sah ich mich nach einer Möglichkeit zur Flucht um. Doch gleichgültig, in welche Richtung ich mich auch wandte: er hätte mich rasch eingeholt. Auf diese Weise gab es kein Entkommen.
Was aber hatte er mit mir vor? Um den Mord zu vertuschen, würde er auch mich töten müssen. Doch er machte nicht den Eindruck, als sei dies seine Absicht. Jedenfalls nicht hier und nicht jetzt. Der andere stand bloß da und wartete ab.
Vielleicht wusste er selbst nicht, was er mit mir anfangen sollte. Er musterte mich mit durchdringendem Blick: »Jetzt haben Sie mich also gefunden«, stellte er grimmig fest. »Mich, den grausamen Mörder, dessen Spur Sie bis hierher verfolgt haben.« Er lachte heiser. »Sind Sie nun zufrieden? Und wie soll es Ihrer Vorstellung nach weitergehen?«
So harsch diese Worte auch klangen, machten sie mir doch Hoffnung: Offenbar wusste der andere tatsächlich nicht, was er mit mir anfangen sollte; daher war er bereit, die Initiative mir zu überlassen. Vielleicht hoffte er insgeheim auch, dass ich ihm einen Vorwand liefern würde, um mich ebenfalls zu beseitigen.
Doch diesen Gefallen würde ich ihm nicht tun. Dass er das Gespräch suchte, war vielmehr von Vorteil für mich. Ich konnte ihm Verständnisbereitschaft signalisieren und ihn so hoffentlich besänftigen. Außerdem war ich tatsächlich bereit, mir seine Version der Ereignisse anzuhören.
»Warum glauben Sie, dass ich Sie für einen grausamen Mörder halte?«, erwiderte ich daher beschwichtigend. »Denn das tue ich keineswegs«, fügte ich hinzu, wenn auch nicht ganz aufrichtig. »Ich weiß zu wenig über Sie und über das, was dort oben geschehen ist, um mir ein endgültiges Urteil bilden zu können.« Mit dem Kopf deutete ich hinauf in Richtung Wald, wo ich die Leiche gefunden hatte.
Der andere war von meinen Worten nicht beeindruckt und schüttelte ärgerlich den Kopf. »Sie haben den Toten doch gesehen. Das spricht für sich!«
»Ja, ich habe ihn gesehen«, erklärte ich so ruhig wie möglich. »Und ich habe auch die Spuren am Tatort gesehen. Diese Spuren sagen mir, dass Sie ihn nicht gequält oder hinterrücks überfallen haben. Er starb auf der Stelle, durch einen einzigen festen Schlag. Ich halte Sie also keineswegs für einen grausamen Mörder.« Und falls ich es doch getan hätte, so war dies mit Sicherheit nicht der Zeitpunkt gewesen, um ihm dies mitzuteilen.
»Was also ist tatsächlich dort oben geschehen?«, hakte ich nach, als der andere schwieg.
Dass ich die Bereitschaft zeigte, mir seine Version der Ereignisse anzuhören, ließ ihn schließlich die Ernsthaftigkeit meiner Worte akzeptieren. Außerdem war es ihm offenbar selbst ein Bedürfnis, sich zu rechtfertigen.
»Er hat mich provoziert«, erklärte der andere. »Ich hatte nicht geplant, ihn zu töten!«
Ich nickte verständnisvoll, blieb aber skeptisch. »Hatte er denn eine Waffe?«, erkundigte ich mich instinktiv, ohne weiter darüber nachzudenken, wie der andere auf diese Frage reagieren würde.
Tatsächlich hatte der Riese den Eindruck, dass ich ihm diese Zusicherung nicht abnahm. »Nein, er hatte keine Waffe«, erwiderte er bitter. »Nur seinen Gehstock mit dem goldenen Knauf, mit dem er mir ständig vor dem Gesicht herumfuchtelte. Mit diesem Stock habe ich ihn dann erschlagen.«
Er sagte es so, als wäre das Herumfuchteln mit einem Stock vor dem Gesicht eines anderen, vor allem wenn dieser Stock mit einem goldenen Knauf versehen war, allein schon Grund und Rechtfertigung genug, um den Betreffenden zu erschlagen.
»Ein Gehstock war es also, mit dem Sie ihn getötet haben«, wiederholte ich nachdenklich und blieb so sachlich, wie es mir unter den gegebenen Umständen möglich war. »Vermutlich war der Knauf kugelförmig? «
Der Riese nickte. »Aus vergoldetem Messing«, fügte er hinzu. »Doch ich habe ihn ins Meer geworfen.«
Seine Beschreibung der Tatwaffe stimmte mit meinen eigenen Ermittlungen überein. Soweit sagte er also die Wahrheit.
»Und mit diesem Stock hat er Sie provoziert?«
»Nicht nur mit dem Stock. Noch viel mehr mit dem. was er zur gleichen Zeit sagte.« Der andere wurde ungeduldig. »Mit seinen Worten! Mit dem. was sich hinter seinen Worten verbarg! Aber auch damit, dass er mir die ganze Zeit mit dem Stock vor der Nase herumfuchtelte. So als verkörpere dieser Stock all seine Macht über mich.« Er hielt mich offenbar für gegen ihn voreingenommen, weil ich in dieser Weise nachhakte.
Da ich nun kein Wort mehr sagte, fuhr er schließlich von sich aus fort: »Offenbar muss ich weiter ausholen, damit Sie mich verstehen. Damit Sie begreifen, wieso ich mich derart aufregen konnte. Sie werden es erst verstehen, wenn Sie alles erfahren haben. Wie Hernandez mir in den vergangenen Jahren alles genommen hat, was ich mir je erkämpft habe und worauf ich im Leben stolz war. Alles, was mir je etwas bedeutet hat. Und am Ende wollte er noch mehr von mir. Er wollte mir meine letzte Selbstachtung nehmen, indem er mich völlig zu seiner Kreatur formte. Dieser verdammte Anwalt!«
Er spuckte diese Worte derart zornig aus, dass ich nicht wagte, das
Thema zu vertiefen. Ich lenkte daher ab: »Der Tote war also Anwalt?« Und eine Ahnung ließ mich hinzufügen: »War er etwa Ihr Anwalt?«
Der andere nickte. »Ja, er war mein Anwalt. Und wer sonst hätte einen anderen Menschen gewissenlos und kalt lächelnd über den Tisch gezogen und ihm dabei vorgespielt, nur zu dessen Bestem zu handeln? Und dabei doch nur den eigenen Vorteil verfolgt? Wer sonst hätte seinen Mandanten ruiniert, ihn seiner Familie beraubt und dann auch noch damit vor ihm geprahlt? Wer sonst hätte das getan? Wer sonst, frage ich Sie, wäre so gewissenlos gewesen?« Er starrte mich herausfordernd an.
Ich hätte darauf Manches erwidern können und hatte seinen pauschalen Vorwürfen Einiges entgegenzuhalten, obwohl ich aus eigener Erfahrung wusste, dass solch extreme Fälle, wie er sie beschrieb, tatsächlich vorkamen. Auch beschränkte sich solch ein Verhalten nicht auf eine einzige Berufs- oder Personengruppe. Aber ich wollte dem Riesen schon deshalb nicht widersprechen, weil ihn die Erinnerung an das ihm widerfahrene, tatsächliche oder eingebildete Unrecht ganz offensichtlich in Rage versetzte. Ein Protestieren meinerseits hätte diese Wirkung bloß verstärkt.
Wir schwiegen also beide. Ich gab ihm Zeit, sich abzukühlen, und dachte unterdessen über das nach, was er mir berichtet hatte. Zwar kannte ich nicht die Einzelheiten seines Falles, doch seine Erklärungen erschienen mir zumindest so weit schlüssig zu sein, wie sie die Tat selbst betrafen. Sein Bericht passte zu meinen eigenen Ermittlungen. Und da er mich bislang nicht angegriffen hatte, sondern sich stattdessen mir gegenüber zu rechtfertigen suchte, revidierte ich mein Bild von seinen Beweggründen: Trotz seiner großen Körperkraft war er offenbar kein vernunftloser Gewaltmensch.
Ich war daher bereit, mich auf seine Geschichte einzulassen. Ich entschloss mich zu einem für mich riskanten Vorschlag; »Lassen Sie uns zu meinem Haus gehen und dort weiter über alles sprechen. Vielleicht kann ich Ihnen sogar helfen.« Dieses Entgegenkommen sollte ihn weiter beruhigen.
Tatsächlich sah er mich überrascht an und dachte über mein Angebot nach. Dann nickte er. »Einverstanden. — Doch wie wollen Sie mir behilflich sein? Sie können den Kerl ja kaum wieder zum Leben erwecken«, lachte er bitter.
Ich zuckte mit den Schultern und deutete an, dass dies von den genauen Umständen abhängen würde, von denen ich schließlich noch nichts wusste.
Diese ausweichende Antwort ließ ihn zögern. »Ich weiß nicht recht«, wandte er ein. »Wartet etwa jemand bei Ihrem Haus auf uns?«
»Ich lebe allein auf der Insel«, versicherte ich ihm. »Seit Monaten fliegen nur ein paar Geologen hin und wieder mit dem Helikopter vorbei und werfen für mich Vorräte ab, auf dem Weg zum Vulkangipfel.«
Er nickte, scheinbar überzeugt.
Daraufhin wurde ich unvorsichtig: »Werden Sie jetzt bitte nicht zornig auf mich, wenn ich Ihnen wahrheitsgemäß sage, wieso ich glaube, Ihnen helfen zu können. Denn ich war selbst einmal Anwalt, vor vielen Jahren auf dem Festland. Meist Strafverteidiger, um genau zu sein. Und daher weiß ich durchaus, dass es die Wahrheit sein kann, was Sie mir da berichten. Und dass es mir unter Umständen möglich sein wird, Ihnen zu helfen.«
Meine Worte empörten den anderen gleichwohl, und sein Gesicht verfinsterte sich. Ärgerlich schimpfte er vor sich hin: »Anwälte, wohin man auch kommt! Selbst auf dieser gottverlassenen Insel bleibt man nicht von ihnen verschont. Ihr seid eine wahre Plage der Menschheit! Überall mischt Ihr Euch in Dinge ein, die Euch nichts angehen. Alles glaubt Ihr besser zu wissen. Aber wenn jemand einmal wirklich Eure Hilfe benötigt, so wie ich damals, wenn es einmal wirklich um Gerechtigkeit geht und nicht bloß um Profit und kostspielige Vertragsverhandlungen, an denen Ihr Euch eine goldene Nase verdienen könnt, dann fallt Ihr einem sofort in den Rücken, sobald Ihr auf diese Weise das bessere Geschäft machen könnt.« Er starrte mich böse an und dachte dabei offenbar an den Toten, von dem er sich verraten fühlte. »Wie kann denn ein ehrlicher Mensch überhaupt einen Beruf wählen, in dem er dafür bezahlt wird, nicht seinen eigenen Standpunkt oder seine eigenen Überzeugungen zu vertreten, sondern vielmehr einen ganz beliebigen Standpunkt eines beliebigen anderen Menschen? Und je besser er sich verstellt, desto besser wird er bezahlt. — Aber das ist offenbar alles, was zählt: gut zu verdienen. Nicht wahr, Herr Anwalt?«
Seine erneut pauschal geäußerten Vorwürfe trafen mich tief, so ungerechtfertigt sie in vielen Fällen auch waren. Denn einen Kern von Wahrheit enthielten sie bedauerlicherweise doch. Daher erwiderte ich zorniger als es angebracht war: »Wenn es mir im Leben bloß um Geld und Luxus gegangen wäre, würde ich wohl kaum hier auf dieser ‘gottverlassenen Insel' leben, wie Sie sie nennen! Noch dazu in einer Zeit, da dieser Ort von einer Naturkatastrophe bedroht ist. Glauben Sie nicht?«
Er sah überrascht auf und erkannte, dass es mir mit meinem Unmut ernst war. »Ich bin offenbar einmal zu oft an den Falschen geraten«, beschwichtigte er mich dann, nach einer kurzen Pause des Schweigens.
Mein Zorn war jedoch nicht verraucht: »Offenbar sogar stets an den gleichen Falschen, wenn ich es recht verstehe«, fügte ich sarkastisch hinzu.
Der andere nickte wortlos. Ich hatte offenbar den Kern der Sache getroffen.
»Glauben Sie denn, ich würde hier leben, wenn es mir bloß um Geld und Luxus ginge?«, wiederholte ich herausfordernd.
Langsam schüttelte er den Kopf. »Doch warum sind Sie dann Anwalt geworden?«, wollte er nun von mir wissen.
Seine Neugier schien aufrichtig zu sein. Daher ließ ich mich darauf ein: »Am Anfang geschah es, um mich selbst, meine Familie und meine Freunde besser schützen zu können«, erklärte ich. »Aber auch, um die Rechte meines Volkes zu wahren, das hier schon seit Jahrhunderten lebt. Es bewohnte diese Insel schon Jahrhunderte bevor die europäischen Einwanderer kamen, die uns ihre Rechtsordnung aufzwangen. Auch Sie selbst haben doch am eigenen Leib erfahren, wie wenig es einem hilft, wenn man bloß ehrlich ist und sich im Recht weiß, sich im Ernstfall aber nicht mit all den juristischen Formfragen auskennt, die einzuhalten sind, sobald man sein Recht tatsächlich durchsetzen muss.«
Wieder nickte er, nachdenklich geworden.
»Wenn ich Sie richtig verstehe«, fuhr ich fort, »hatten auch Sie sich einen Anwalt nehmen müssen, der Ihnen Gerechtigkeit verschaffen sollte. Dieser Anwalt hat Ihnen jedoch nicht geholfen — im Gegenteil: Er hat Sie betrogen.«
Der andere nickte.
»Aber das war dieser eine Anwalt«, betonte ich. »Nicht alle Anwälte sind so wie er. Und auch in anderen Berufsgruppen werden Sie stets Menschen finden, die Sie über den Tisch ziehen wollen.«
Nun zögerte der Riese. So ganz traute er meinen Worten nicht. »Was machen Sie denn dann hier, wenn Sie angeblich Ihrem Volk helfen wollen?«, kam er auf den Punkt. »Ihre Freunde sind doch gar nicht mehr auf dieser Insel, sondern auf dem Festland. Benötigen sie Ihre Hilfe nicht dort?«
Dieses Argument traf mich unerwartet. Tatsächlich hatte ich bei meinem Zurückbleiben auf Keras zunächst an mich selbst gedacht. »Ich bin kein junger Mann mehr«, verteidigte ich mich. »Seit ich im Ruhestand bin, übernehme ich nur noch dann einen Fall, wenn Familie oder enge Freunde meine Hilfe benötigen.« Auch in meinen eigenen Ohren klang diese Antwort schal.
»Aber was tun Sie stattdessen hier? Was hält Sie an diesem Ort? Sie wirken doch noch rüstig genug, um diese Insel zu verlassen, bis der Vulkan ausgebrochen ist.«
»Danke für dieses zweifelhafte Kompliment«, kommentierte ich seine letzten Worte trocken und kehrte dann zum eigentlichen Thema zurück: »Im Moment verfasse ich eine Geschichte meines Volkes«, erklärte ich. »Das ist meine Art, im Alter noch etwas für mein Volk zu tun. Bevor alles Wissen darum in Vergessenheit gerät. Das hatte ich mir schon vor Jahren zum Ziel gesetzt. Auf diese Weise helfe ich meinem Volk, sich seine Identität zu bewahren.«
Diese Erklärung leuchtete ihm schon eher ein. Da er mich neugierig musterte, ging ich näher darauf ein: »Unsere Überlieferungen sind fast alle mündlicher Natur. Viele junge Menschen verlassen jedoch die Insel, um auf dem Festland Arbeit zu finden, und das nicht erst, seit der Vulkan auszubrechen droht. In der Fremde vergessen sie die Überlieferungen oder lernen sie sogar überhaupt nie kennen. Und selbst wenn sie hierbleiben und von den Überlieferungen hören, interessieren sie sich oft nicht mehr für die Kultur unserer Ahnen, weil ihnen die Medien eine so viel interessanter wirkende Scheinwelt vorführen. Unsere Kultur soll jedoch nicht spurlos verloren gehen, solange ich es verhindern kann.«
Er nickte. »Ist das alles, was Sie an diesem Ort hält?«
Zurecht vermutete er mehr hinter meinem Eremitendasein. Diese Frage zu beantworten fiel mir jedoch nicht schwer: »Nein, gewiss nicht. Es ist auch das Leben in der Natur; das Leben in Ruhe und Frieden und Harmonie. So etwas ist in den Großstädten des Festlandes kaum möglich. Hier auf Keras habe ich mein wahres Zuhause wiedergefunden. Daraus lasse ich mich nicht mehr vertreiben.«
Offenbar verstand er mich nun, denn seine Züge entspannten sich.
»Ich habe hier außerdem meine Freiheit wiedergefunden«, setzte ich hinzu. »Es heißt so oft, der Mensch sei das einzige freie Lebewesen auf dieser Welt; das einzige Lebewesen, das einen freien Willen besitzt. Solche Floskeln klingen beeindruckend und erhaben, und sie schmeicheln unserem Selbstwertgefühl. Doch in den seltensten Fällen trifft es tatsächlich zu; denn kein anderes Lebewesen auf dieser Welt muss derart viele Gesetze und Regeln befolgen wie der Mensch. Kein anderes Lebewesen ist derart von den Meinungen und Verhaltensweisen seiner Artgenossen abhängig. In der menschlichen Gesellschaft, vor allem in der Massengesellschaft, bleibt nicht mehr viel übrig von Individualität und von dem sogenannten freien Willen des Einzelnen. Der Mensch verfügt sicherlich noch über den freien Willen; doch er wird oft durch die Umstände daran gehindert, ihm zu folgen, sobald es um mehr geht als um Fragen wie die, wann man zu Abend essen will. Einzig hier auf Keras fühle ich mich wirklich frei. Hier, am Ort meiner Geburt.«
»Inmitten dieser freien und wunderbaren Natur«, ergänzte der andere und nickte verständnisvoll. Offenbar hatte ich ihn von der Aufrichtigkeit meiner Worte überzeugt. »Lassen Sie uns zu Ihrem Haus gehen, wie Sie es vorgeschlagen haben«, erklärte er sich bereit. »Dort werde ich Ihnen von meiner Vergangenheit berichten. «
IMMER NOCH WAR ICH SKEPTISCH, was die scheinbare Freundlichkeit des Alten anging. Denn einmal mehr war ich an einen jener Paragrafenzauberer geraten, von deren Integrität und Ehrlichkeit etwas zu erhoffen ich wenig Anlass sah. Seinesgleichen hatte mir mein Leben in dem von ihnen errichteten gefühlskalten System Stück für Stück zerstört.
Andererseits hatte der Alte eine Art, die Dinge offen auszusprechen, die mich davon überzeugte, er meine es ehrlich mit mir. Darüber hinaus war er auf seiner Heimatinsel geblieben, trotz aller Gefahren, weil er sich mit diesem Flecken Erde verbunden fühlte; es gab also ethische Werte, die für ihn höher zählten als Profit und materieller Wohlstand.
Vielleicht hatte er seinen Beruf tatsächlich gewählt, um die Rechte seiner Familie und seines Volkes zu schützen — und nicht bloß, um Geld zu scheffeln. In diesem Fall hatte er vielleicht sogar ein Verständnis für jene Ungerechtigkeiten entwickelt, die den Schwächeren und Mittellosen in der Gesellschaft regelmäßig zugefügt werden. In diesem Fall kannte er womöglich nicht nur das geschriebene Gesetz und konnte nicht bloß die Präzedenzfälle liefernden Gerichtsentscheidungen wie ein Mantra nachbeten, womöglich besaß er stattdessen sogar ein natürliches Empfinden für Gerechtigkeit — jenen Gerechtigkeitssinn also, den man sich auch in noch so vielen juristischen Repetitorien nicht einbläuen lassen konnte.
Durfte ich ihm also vertrauen? Oder versuchte er nur, mich in Sicherheit zu wiegen? War es ihm ernst damit, mir zu helfen?
Ich hatte nichts zu verlieren. Wenn überhaupt, konnte ich etwas gewinnen, indem ich mich auf seinen Vorschlag einließ.
Wenig später erreichten wir das bescheidene Haus Maleko Nainoas — mit diesem Namen stellte er sich mir auf dem Weg dorthin vor. Das Haus war ohne Pomp eingerichtet. Es war sauber und weitgehend aufgeräumt, abgesehen von den überall stapelweise herumliegenden Büchern und Papieren. Die Räume wirkten einladend. An den Wänden hingen abwechselnd farbenfrohe Ölgemälde und Fotografien, meist Naturaufnahmen. Viele stellten offenbar die schönsten Winkel der Insel Keras dar und stammten, wie mir Nainoa erklärte, von einem der vielen Neffen seiner verstorbenen Frau.
Luxusgegenstände sah ich wenige, auch wenn manches kostspieliger schien als vergleichbare Gebrauchsgegenstände in den Hütten weiter unten im Tal, die ich in der gestrigen Nacht auf der Suche nach meinem Verfolger durchstöbert hatte.
Insgesamt sprach daher auch Nainoas Haus dafür, dass er aufrichtig zu mir war. Er hatte seinen Beruf nicht bloß deshalb gewählt, um dadurch Reichtümer anzuhäufen.
Trotzdem blieb ich skeptisch. »Haben Sie Ihr Geld auf dem Festland angelegt?«, wollte ich von Nainoa wissen.
Dem alten Mann war die Frage nach seinem Vermögen unangenehm. »Ich habe so viel Geld auf dem Festland angelegt, dass ich davon ohne Not leben und meine Interessen, die nicht kostspielig sind, verfolgen kann«, erklärte er mit Zurückhaltung. »Da ich niemanden mehr zu versorgen habe, außer mich selbst, benötige ich weniger als Sie vielleicht vermuten. Stattdessen habe ich einiges Land auf der In