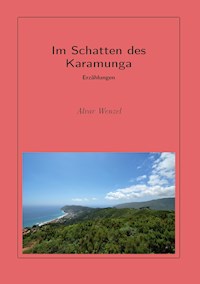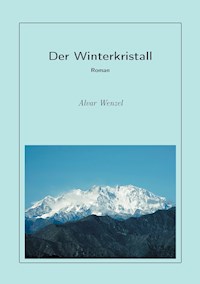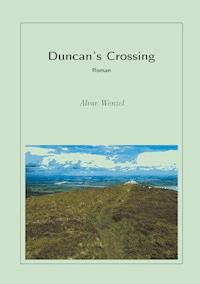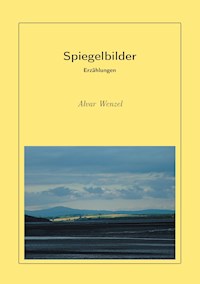
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Lassen Sie sich in sieben lose miteinander verknüpften Erzählungen in verschiedene Epochen der Menschheitsgeschichte entführen, von den Sonnenpriestern der Maya bis hinein in eine nicht mehr allzu ferne Zukunft: * Gegen Ende des ersten Jahrtausends kämpft ein indianischer Sonnenpriester um Toleranz und Gerechtigkeit, vor allem primitiveren Völkern gegenüber, in denen sein eigenes Volk "Die Schuldigen" am Zorn der Götter sieht. * Pioniere, die als Nachfolger von Kolumbus und Raleigh die neue Welt entdecken, suchen nach einer neuen Gesellschaftsform, um die "Freiheit" jenseits des Ozeans zu finden. * In einer streng religiösen Gemeinschaft der amerikanischen Gründerzeit lebt eine Mutter in ungerechter "Schande", zusammen mit ihrer unehelichen Tochter, und sehnt sich nach Befreiung von diesem Los. * Von den Grausamkeiten des amerikanischen Bürgerkriegs verbittert, erlebt ein Ruheloser einen unheimlichen "Totentanz". * Unter den Zwängen des Lebens einer lateinamerikanischen "Großstadt" lernen sich zwei ehemalige Brieffreunde endlich persönlich kennen und teilen ihre Hoffnungen und Sorgen. * "Spiegelbilder" des Individuums in der modernen Massen- und Mediengesellschaft quälen einen Schlaflosen. * An Bord eines Raumschiffs auf dem Flug zu einer neuen Welt und einem gesellschaftlichen Neuanfang vernimmt man "Die letzte Stimme der Erde". Weitere Informationen zu diesem Buch finden Sie auf der Homepage des Autors (www.alvarwenzel.de).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 519
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Die Schuldigen
Freiheit
Schande
Totentanz
Großstadt
Spiegelbilder
Die letzte Stimme der Erde
Epilog
Entstehungsgeschichte
Literaturverzeichnis
Anmerkungen
Prolog
Ein unter hauchdünnem Wolkengespinst blaugrün schimmernder Planet zog, den Kräften der Schwerkraft folgend, seine weite Bahn um eine orangegelbe Sonne, die mit ihrer Wärme das Leben auf der Planetenoberfläche nährte. Dort waren die ersten Spuren einer neu gewachsenen Zivilisation zu erkennen, deren Stimmen sich aber nur leise artikulierten. Noch war das natürliche Gleichgewicht des Lebens gewahrt.
Es war eine Welt, auf der man in Frieden leben konnte.
Die Schuldigen
AUCH AN DIESEM MORGEN stieg die Sonne in einen klaren, fast wolkenlosen Himmel empor. Ihr Erscheinen am Firmament wurde, wie an jedem Tag seit fast dreißig Jahren, von Karpak, einem der letzten Sonnenpriester seines Volkes, in feierlicher Andacht auf der obersten Plattform des Haupttempels begrüßt. Nur seine treuesten Tempelwachen durften diesen Augenblick mit ihm teilen, und manchmal, an Tagen wie diesem, stand er allein dort oben und überließ sich ganz seinen Gedanken: Das Aufgehen der Sonne bewies ihm jeden Morgen aufs Neue die Größe und Allgewalt der Natur, durch die ihrer aller Leben beherrscht wurde. Ihre Macht war überwältigend.
Es gab jedoch noch eine andere Naturerscheinung, deren Kräfte sich seinem Volk in den kommenden Wochen des hereinbrechenden Herbstes auf besondere Art erweisen würden. Denn es brach die Zeit der Stürme und Unwetter an, die von der Küste im Osten, die Karpak einst als Kind besucht hatte, mit unwiderstehlicher Gewalt heraufzogen. Auf ihrem Weg ins Innere des Kontinents zerstörten sie alles Leben, das ihren Pfad kreuzte.
Die Priester der Sonne glaubten allerdings nicht, dass mit dem Hereinbrechen der Stürme und den damit einhergehenden Zerstörungen ein göttlicher Wille oder gar eine Strafe der Natur für Fehler im Verhalten der Menschen verbunden sei, auch wenn viele im Volk von genau diesem Zusammenhang überzeugt waren. An diesem Aberglauben hatte es auch nichts geändert, dass die Priester seines Tempels das Volk stets gelehrt hatten, die Kräfte der Natur interessierten sich in ihrer überwältigenden Allmacht überhaupt nicht für die Menschen in deren unbedeutender Schwäche, dass es also erst recht keine tiefere Bedeutung hatte, wenn in dem einen Jahr die Stadt von den Stürmen verwüstet wurde und im darauf folgenden Jahr von ihnen verschont blieb. Es war bloß ein auf Zufall beruhendes Schicksal, wenn auch ein furchtbares, das den Menschen unabhängig von seinem Handeln und Wollen ereilte.
Doch im Volk wucherte erneut der verderbliche Aberglaube der Vorfahren, und Karpak, der stets jeden Aberglauben bekämpft hatte, wagte es seit einiger Zeit nicht mehr, sich dem Volk gegenüber zu seinem wohldurchdachten Weltbild zu bekennen. Nur unter den Bewohnern des Tempels konnte er mit Verständnis für seine Ansichten rechnen — denn hier war man es gewohnt, über die Fragen des Lebens tiefgründiger nachzudenken. Die Menge jedoch hielt an der einfacher zu begreifenden Vorstellung fest, die jedem Tod durch die Gewalten der Natur, der andernfalls sinnlos erschienen wäre, eine besondere Bedeutung verlieh. Warum, so hätte man Karpak mit Entrüstung entgegengehalten, vernichtete die Natur in manchen Jahren keine Menschenleben, in anderen Jahren aber Dutzende, manchmal sogar Hunderte? Dies könne doch nichts anderes sein als eine Bestrafung für die Sünden der Menschen, die in manchen Jahren gering, in anderen aber zu groß waren. Hinzu kam, dass Karpaks Weltbild bedeutet hätte, dass alle diese Tode der Vergangenheit gar keinen Sinn hatten, dass Menschen nicht etwa deshalb umgekommen wären, weil ihr Verhalten Strafe herausgefordert hätte, sondern aus reiner Willkür. Eine solche Ungerechtigkeit könne aber doch unmöglich die Grundessenz der Welt ausmachen, in der man lebte.
Doch genau dies entsprach Karpaks Überzeugung: Nach seiner Ansicht interessierte sich die Natur nicht dafür, ob Menschen sündigten und ob ihr Verhalten demnach Strafe verdiente. Die Menschen vermochten allein durch die Gnade der Natur in dieser Welt zu existieren; kamen sie ihren Gewalten in die Quere, so verloren sie ihr Leben. Ein Sinn, gemessen an menschlichen Kriterien, lag in diesem Schicksal jedoch nicht.
Hätte Karpak seine Auffassung allerdings öffentlich ausgesprochen, so hätte er unweigerlich den Zorn der Menge auf sich gezogen und weiter an Einfluss verloren. Denn die Masse der Menschen wollte von philosophischen Fragen, auf die es keine sie befriedigende und möglichst auch noch ihrer Eitelkeit schmeichelnde Antwort gab, nichts hören; sie wollte in allen wesentlichen Ereignissen das Wirken eines höheren Sinnes erblicken, der ihre Existenz weniger unbedeutend und von zufälligen Schicksalsschlägen abhängig erscheinen liefe.
Diesen Wunsch nach einem tieferen Sinn in den Ereignissen des Lebens verstand Karpak durchaus, und er fühlte einen solchen Wunsch auch in sich selbst. Aber wo es einen solchen Sinn nicht gab, konnte man ihn nicht dadurch erschaffen, dass man ihn sich einfach herbeiwünschte oder lautstark über ihn argumentierte.
Der Aberglaube der Masse führte jedoch nicht nur zur Selbsttäuschung, die für sich genommen noch vergleichsweise harmlos gewesen wäre, er hatte in den vergangenen Jahren zudem die Überzeugung genährt, alle Ereignisse, die sich auf das Leben der Menschen auswirkten, hätten schon von Anfang an nur diese eine Wirkung bezweckt. Die menschliche Existenz gewinnt freilich stark an Bedeutung, wenn man sich vormacht, selbst die Natur versuche unentwegt, darauf Einfluss zu nehmen.
Besonders gefährlich waren verschiedene Schlussfolgerungen, die man im Volk aus dem derart wiederauflebenden Irrglauben zog: Wenn die Unwetter, die jetzt heraufzogen, gegen die Menschen gerichtet waren, wenn sie eine Bestrafung durch die Götter der Natur darstellten, so musste diese Strafe eine Ursache haben. Eine willkürliche, ungerechte Bestrafung wollte man sich ebenso wenig vorstellen wie die Möglichkeit, die Naturkatastrophen könnten überhaupt keinen Bezug zum menschlichen Handeln haben. Bei diesem Argument unterschied man also auf einmal zwischen der Gewalt der Natur und der Gewalt der Menschen: Denn der menschlichen Gewalt ist willkürliche und ungerechte Bestrafung keineswegs fremd.
Man glaubte also, dass man nur die Gründe für die Bestrafung durch die Natur erkennen müsse, um dann durch Beseitigung jener Gründe auch die darauf beruhende Bestrafung abwenden zu können. Was aber waren die Ursachen für die Bestrafung der Menschen durch die Natur? Es musste das Verhalten bestimmter Menschen sein, das den Göttern missfiel. Die meisten Menschen sind allerdings davon überzeugt, dass sie selbst keine Untaten begehen, die eine Bestrafung verdienen; es sind immer die Fehler der anderen, die eine Vergeltung erfordern. Unter der Vergeltung der Natur haben dann jedoch auch die unschuldigen Nachbarn mitzuleiden, also man selbst.
Das Volk suchte daher nach den anderen, den Schuldigen, den Sündern, den Fremden und den von der Mehrheit in irgendeiner Form Abweichenden; nach jenen, die sich nicht anpassten. Diese anderen mussten es sein, die den Anlass für die Bestrafung gaben; bei ihnen lag die Schuld, wenn ein Unwetter die Stadt heimsuchte und verwüstete. Gelang es, die Schuldigen zu finden, bevor das Unwetter über das gesamte Volk hereinbrach, so konnte man die drohende Katastrophe womöglich abwenden: Bestrafte das Volk selbst die Schuldigen für das, was den Zorn der Naturgötter auf sich gezogen hatte, so blieb die Bestrafung aller durch die Natur hoffentlich aus.
Nach den Aufzeichnungen der Sonnenpriester hatte dieser Aberglaube allerdings noch nie zu einem feststellbaren Erfolg geführt. Vielmehr waren die Unwetter stets von Neuem über die Stadt hereingebrochen, in vergleichbarem Rhythmus und mit ähnlicher Gewalttätigkeit. Die von der Masse zur Besänftigung der Götter verübten grausamen Menschenopfer waren also stets vergeblich gewesen.
Die Priester bemühten sich daher, den Aberglauben und seine Folgen zu bekämpfen, wenn auch ohne nennenswerten Erfolg. Die Menge vermutete weiterhin einen göttlichen, sie betreffenden Willen hinter den Gewalten der Natur, einen Willen, der für Menschen nicht zu erforschen war und den daher auch die Sonnenpriester nicht verstehen konnten. Und außerdem, so glaubte die Masse, waren die Menschenopfer im Grunde doch wirksam: Gewiss wären die Katastrophen noch sehr viel schlimmer ausgefallen, wenn man die Schuldigen nicht schon selbst bestraft und somit die Götter zumindest ein wenig besänftigt hätte. Auch dies war doch möglich! Und eben darum war man den Gewalten der Natur doch nicht so hilflos ausgeliefert, wie die Sonnenpriester behaupteten.
Begründungen dieser Art hatten, trotz ihrer elementaren Fragwürdigkeit, den Stadtbewohnern seit jeher zur Rechtfertigung jener Gewalttätigkeit gedient, die sich vor allem in den Sommer- und Herbstmonaten gegen Minderheiten oder Fremde entlud. Konnte die Gemeinschaft nur durch Menschenopfer überleben, so mussten Einzelne für das Wohl der Vielen leiden. Die Gewissenloseren im Volk nutzten diesen Aberglauben überdies geschickt zu ihrem eigenen Vorteil aus, indem sie den Zorn der Masse gegen ihre persönlichen Feinde oder gegen von ihnen Beneidete lenkten.
Die Sonnenpriester hatten mit der Zeit die Augen vor diesen Geschehnissen verschlossen. Sie hatten die Hoffnung verloren, etwas daran ändern zu können. Nur Karpak besaß eine besondere, ihm eigene Halsstarrigkeit und hoffte immer noch, dass wenigstens in diesem Jahr der Ablauf ein anderer sein würde. Diesmal würde er sich nicht abwenden, wenn es erneut geschehen sollte.
Während sich vor seinen Augen am östlichen Horizont das erste Unwetter des Jahres mit seinen Stürmen und Gewittern zusammenbraute, bildeten sich auch in den Seelen der Stadtbewohner die ersten Wirbel eines heraufziehenden Sturms. Die Angst des Volkes vor göttlicher Bestrafung war in diesem Jahr besonders groß, seitdem auch der Morgenstern am Firmament erschienen war, was als weiteres böses Vorzeichen gewertet wurde.
Karpak glaubte dennoch, den geradezu vorherbestimmt erscheinenden Ablauf der Ereignisse abwenden und der Gewalttätigkeit des Volkes endlich Einhalt gebieten zu können. Jene Gewalttätigkeit widersprach in seinen Augen so sehr der Heiligkeit des Lebens in all seinen Formen, und diese Heiligkeit fand für ihn ihr bedeutendstes Symbol in der allmorgendlich aufgehenden Sonne.
Lange Zeit noch starrte Karpak in das grelle Licht des Himmelsgestirns, das er als Lebensspenderin verehrte. Dann ließ er seinen Blick langsam über die Stadt wandern. Warum nur empfand sein Volk beim Anblick der Morgensonne in seiner Seele nicht auch etwas von dem tiefen Frieden mit sich selbst und mit allen Geschöpfen dieser Erde, der Karpak dadurch geschenkt wurde?
DIE SCHULDIGEN, die nach dem Willen des Volkes in diesem Jahr für die drohende Bestrafung durch die Natur büßen sollten, die ersten Menschenopfer also, würden zwei aus dem Volk der Waldbewohner sein, die am Vortag in der Stadt aufgegriffen worden waren und seither im Kerker des Tempels gefangengehalten wurden. Das Volk der Waldbewohner hauste tiergleich im westlich gelegenen Regenwald, und mit den Tieren teilte es dort auch seinen Lebensraum. Die Waldwilden existierten ohne Gesetz und ohne Kultur, und sie hatten sich offenbar nie darum bemüht, ihr Dasein durch Prinzipien des Verstandes oder durch moralische Ideale auf eine höhere Stufe zu heben. Es war daher nicht überraschend, dass die Stadtbewohner mit Verachtung auf sie hinabsahen.
Von Zeit zu Zeit besuchten kleine Gruppen dieser Wilden die Stadt, um in ehrfürchtigem Staunen die gewaltigen Bauwerke zu betrachten, die aus der Ferne ihre Neugierde geweckt hatten. Nach wenigen Stunden Aufenthalts kehrten sie dann, aufgeregt und eingeschüchtert durch das, was sie gesehen hatten, in den Urwald zurück, um ihren Mitgeschöpfen ausführlich von ihrem Mut und ihren Heldentaten zu berichten.
Doch in der Zeit der Wirbelstürme war es für die Waldbewohner gefährlich, die Stadt aufzusuchen. Das Stadtvolk hatte in den vergangenen Jahren die Überzeugung entwickelt, die Strafe der Natur müsse gar nicht der Stadt selbst gelten, sondern könne genauso gut gegen jene Nachbarn gerichtet sein, die am anderen Ende des weit gestreckten Tales lebten. Mit ihrer primitiven Lebensweise mussten die Urwaldbewohner doch zwangsläufig den Zorn der Götter auf sich ziehen. Diese Betrachtungsweise hatte überdies den praktischen Vorteil auf ihrer Seite, dass es den Stadtbewohnern im Allgemeinen leichter fiel, Fremde hinzurichten anstelle ihrer eigenen Mitbürger.
Als am Vortag daher zwei unbewaffnete Waldbewohner unvorsichtigerweise in der Stadt erschienen waren, hatte man sie sogleich aufgegriffen und in die Kerkergewölbe gesperrt, die unter dem Sonnentempel lagen. Wie Karpak berichtet wurde, handelte es sich bei den Ergriffenen um einen Mann und eine Frau, die sich bei ihrer Gefangennahme zunächst gewehrt und danach schamlos aneinandergeklammert hätten. Die deutlichen Anzeichen ihrer Angst nahm das Stadtvolk als weiteren Beweis dafür, dass beide sich tatsächlich einer Schuld bewusst seien und den gerechten Zorn der Götter zu fürchten hätten.
Karpak freilich hatte die Schamlosigkeit der Wilden, die am auffälligsten in ihrer Bekleidung beziehungsweise deren weitgehendem Fehlen zum Ausdruck kam, schon häufig beobachtet; sie war genauso wenig wie ihre Furcht als Zeichen ihrer Schuld anzusehen. Auch hatten fast alle Waldbewohner, wenn sie die Stadt mit ihren hohen und Ehrfurcht einflößenden Steingebäuden, ihren Tempeln, Pyramiden, Statuen und riesigen Plätzen betreten hatten, sich ängstlich aufgeführt und aneinandergedrängt, um sich gegenseitig Schutz zu bieten. Vor allem die riesige Steintreppe der Schriftzeichen auf der Tempelvorderseite wirkte zumeist einschüchternd auf sie. Angesichts der in ihrer Größe erdrückend wirkenden Bauwerke verließ sie ihr Mut meist endgültig, bis nichts anderes ihnen mehr Kraft zu verleihen vermochte als der instinktive Halt, den sie daraus gewannen, sich wie verängstigte Tiere aneinanderzudrängen. Doch obwohl Karpak grundsätzlich Verständnis für die Furcht der Wilden aufbrachte und nicht an ihre Schuld glaubte, musste er doch zugeben, dass es wahrhaft abscheulich anzusehen war, wie Gruppen halb nackter Männer, Frauen und Kinder mit ihrem absonderlichen Körperschmuck sich ohne Scham derart aufführten. Im Grunde ihres Wesens waren sie daher auch in seinen Augen wenig mehr als Tiere.
Das gestern gefangen genommene Wildenpaar war von Karpaks Tempelwachen widerspruchslos in Empfang genommen worden, als man es ihnen übergeben hatte. Denn dadurch konnte man die Gefangenen vor den Augen des Volkes verbergen, das sich bei ihrem Anblick vielleicht nur noch weiter in Zorn hineingesteigert hätte und sofort zum Menschenopfer geschritten wäre. Womöglich konnte man nun, so war es jedenfalls Karpaks Plan, ihre Hinrichtung sogar verhindern, indem man die Wilden heimlich freiließ. Es ging Karpak dabei nicht so sehr um das Leben der ihm wegen ihrer Primitivität fernstehenden Waldwesen; vielmehr waren ihm die Unruhe der Stadtbewohner und das Toben und Wüten der Masse, die jedes Menschenopfer begleiteten, aus tiefstem Herzen zuwider. Falls es in seiner Macht stand, würde er diese allgemeine Selbsterniedrigung diesmal abwenden.
Seit jeher hatte es ihn abgestoßen, sein Volk auch bei eigentlich religiösen Anlässen als rasende Menge in den Straßen beobachten zu müssen, eine Masse ohne Verstand und bar aller Lehren der im Tempel unterrichteten Sonnenreligion, verloren in einem Zustand wahnsinniger Tollheit. Dann unterschied das Stadtvolk sich in seiner Primitivität kaum mehr von jenen Wilden, die oft zu seinen Opfern wurden. Vielleicht war seine Primitivität dann sogar noch größer als die der Wilden, denn die Stadtbewohner waren, anders als die Waldbewohner, zu einem erhabenen Leben befähigt und ließen diese Fähigkeit trotzdem auf einen Schlag und in vollem Bewusstsein der Folgen entgleiten, um sich wie Wahnsinnige zu gebärden, während die Wilden von Natur aus nichts anderes als tierhaft sein konnten.
Abgesehen davon: Auch Tiere verdienten in Karpaks Augen Mitleid. Und die Wilden waren für ihn dann doch mehr als bloß Tiere. Ihr sinnloser Tod bei einer Opferzeremonie widersprach der Harmonie der Natur, an die Karpak glaubte. Daher wollte er nun den Kerker aufsuchen und die beiden Insassen begutachten, um festzustellen, ob sie tatsächlich Gnade verdienten. War dies der Fall, so würde er sich für ihr Wohl einsetzen und sie retten, solange die Menge sich noch nicht in ihre scheinheilige Wut hineingesteigert hatte.
Über schmale und verwinkelte, von zahlreichen Fackeln erhellte Treppen begab Karpak sich von der obersten Tempelebene hinab zu den Kerkergewölben. Die Gänge, denen er dabei folgte, wurden zumeist von nach oben hin schmaler werdenden Steinwänden begrenzt und führten an zahlreichen Türöffnungen vorbei, die durch Vorhänge verschlossen waren. Vor einem der Räume, der zur östlichen Außenwand des Tempels hin lag, fehlte der Vorhang jedoch. Der Raum wurde von dem hellen Licht der Morgensonne durchflutet, und Karpak trat nach kurzem Zögern ein, um für einige Minuten den besänftigenden Anblick der smaragdgrün gefiederten Quetzalvögel auf sich wirken zu lassen, die hier ihr Zuhause hatten. Sie hockten in ihren von der Decke herabhängenden Käfigen aus Gold, und ihr buntes, meterlanges Schwanzgefieder hing weit aus den Käfigen heraus, fast bis zum Fußboden, wo es leicht im Luftzug der Morgenwinde wogte. Die zinnoberroten Bauchpartien der Männchen blendeten das Auge, wenn das Sonnenlicht auf sie fiel. Die schönen Quetzals galten dem Volk als heilig; wer einen von ihnen tötete, wurde selbst mit dem Tode bestraft. Im Tempel gab es einen jungen Priesterschüler, dessen einzige Aufgabe darin bestand, für das Wohlergehen dieser Tiere zu sorgen. Gelegentlich wurden ihnen einige ihrer langen Schwanzfedern abgenommen, mit denen sich dann die Vornehmen, Wohlhabenden und Einflussreichen der Stadt schmückten, um ihren Status auch äußerlich zur Schau zu stellen. Die Federn der Tiere wuchsen bald nach, und oft entliefe man die heiligen Vögel nach dieser Prozedur in die Freiheit. Denn ihr Anblick war noch eindrucksvoller, wenn man das seltene Glück hatte, sie in unberührter Natur anzutreffen.
Doch Karpak hatte heute anderes im Kopf als die Schönheit dieser Tiere. Bald verliefe er den Raum der Quetzals wieder, wenn auch ein wenig heiterer als zuvor, und stieg in die Tiefen des Tempels hinab.
Was für einen Charakter hatten wohl die gefangenen Wilden? Waren sie sanftmütig oder aggressiv, zurückhaltend oder offensichtlich abstoßend in ihrem Benehmen? Er hoffte, auf wenigstens so viel Seele bei ihnen zu stofeen, wie sie auch manches Tier in seiner gelegentlich erstaunlichen Individualität besafe. Die Wilden sollten Karpak gegenüber genug Persönlichkeit und Verstand beweisen, dass er sie für wert erachten konnte, ihr Leben vor der Gewalttätigkeit der Masse zu beschützen. Dann würde er sie von den ihm treu ergebenen Tempelwachen heimlich aus dem Kerker bringen lassen, damit sie zu ihrem Dasein im Urwald zurückkehrten.
Verdienten sie seine Großzügigkeit allerdings nicht, so würde Karpak sich in seine Gemächer in der obersten Ebene des Tempels zurückziehen, sobald die Unruhen begannen, da er dort die Ereignisse der Außenwelt nicht wahrnehmen musste, auf die er dann ohnehin keinen Einfluss mehr besaß und die er in seiner Seele verabscheute. Auf diese Weise konnte er sich auch das Trugbild der Zivihsiertheit, Güte und Herzlichkeit erhalten, das er sich von seinem Volk herangebildet hatte. Es würde nicht durch den Anblick einer mitleidslosen und brutalen Masse zerstört werden, die ihren niedersten Trieben folgte. Wenn er das Unrecht nicht persönlich mit ansah, konnte er es später leichter verdrängen und sich dadurch die innere Kraft erhalten, die ihn dazu befähigte, überhaupt weiterhin an das Gute in seinen Mitmenschen zu glauben. Aber ein Trugbild war es dennoch, das er sich da aufbaute, und Karpak war sich dessen bewusst. Dieser Widerspruch nagte schon seit Langem an seinem Seelenfrieden.
Am liebsten hätte er die Opferungen generell verhindert oder gar verboten. Doch dazu fehlte es den Priestern inzwischen an Einfluss. Karpak durfte nicht einmal zu viele Gefangene retten, denn dadurch hätte er den Rest seines Einflusses auf das Volk verloren. Daher hatte Karpak sich in der Vergangenheit darauf beschränkt, nur diejenigen Individuen unter den Wilden vor dem Tode zu bewahren, die ihm der Rettung für wert erschienen.
Sein selektives Verhalten brachte allerdings eine wenig angenehme Nebenerscheinung mit sich: Denn es machte ihn in den Augen des Volkes zu dessen Verbündetem bei jenen Menschenopferungen, die er zuließ, zum Mittäter also bei der Hinrichtung derjenigen Wilden, die er nicht befreite und somit dem Zorn des Volkes überließ. Nachdem das Stadtvolk von verschiedenen Fällen erfahren hatte, in denen Karpak in den vergangenen Jahren mit Hilfe der Tempelwachen Gefangenen aus dem Kerker zur Flucht in die Wildnis verholfen hatte, sah man umgekehrt all jene, die zu retten er sich, aus welchen Gründen auch immer, nicht entscheiden konnte, als von ihm als Sonnenpriester offiziell gebilligte Menschenopfer an. Das Volk glaubte von da an, Karpaks Segen läge über der Hinrichtung all jener, die er nicht befreite.
Karpak schmerzte es, auf diese Weise Mitschuld an derart widerlichen Ereignissen zu tragen. Doch er sah nur diesen einen Weg, um überhaupt einige der Gefangenen zu retten, die sonst allesamt hingerichtet worden wären. Mochte die Menge dadurch auch zu der Ansicht gelangen, er sei mit den anderen Menschenopfern einverstanden — ihm selbst war dies gleichgültig, solange er überhaupt Leben bewahren konnte. Doch auf seiner Seele lastete die Erkenntnis, dass er sich mit seinem Verhalten letztlich zum Richter über die Gefangenen erhob: Denn nun war er selbst derjenige geworden, der entschied, welche von ihnen weiterleben durften und welche von ihnen sterben mussten. Er war zum Richter über Leben und Tod geworden für Wesen, von denen er mit Sicherheit wusste, dass sie nicht die Schuld an den Unwettern trugen, die das Tal und die Stadt heimsuchten, und von denen dennoch viele deswegen ihr Leben lassen mussten. Ein Teil von ihm fürchtete sich daher bereits davor, eines Tages Gefallen an dieser unfreiwilligen Richterrolle zu finden — und dadurch jene Menschlichkeit und Demut zu verlieren, auf die sein Glaube so viel Wert legte und die als Einzige die Objektivität der Mächtigen gewährleisteten.
DIE VERLIESE, in die man die Wilden gesperrt hatte, waren in kleine Steinhöhlen eingelassen, die vor Generationen in die Felsen unterhalb des Sonnentempels geschlagen worden waren. Ursprünglich hatten sie als Lagerräume gedient. Inzwischen waren die Eingänge zu den einzelnen Höhlenkammern jedoch mit schweren Holztüren versehen worden, die sich mit einem Balken von außen versperren ließen. Nur eines der Verliese wurde derzeit genutzt. Davor stand ein Wachposten, gekleidet in die traditionell bunte Tracht der Tempelwächter. Es war Aron-tak selbst, der Anführer der persönlichen Leibwache Karpaks, und er erwartete den Sonnenpriester bereits.
Arontak grüßte respektvoll. Karpak erwiderte den Gruß freundlich, doch ohne übermäßige Vertraulichkeit. In kritischen Situationen hatte er sich stets auf Arontak verlassen können, und über ihren Rangunterschied hinweg empfanden sie füreinander sogar eine Form von Freundschaft; dies machte weitere Höflichkeitsfloskeln überflüssig. Echte Vertrautheit war zwischen ihnen jedoch nie entstanden.
Karpak forderte Arontak mit einer Handbewegung auf, die Tür zu der geschlossenen Kammer zu öffnen. Im Schein der Fackeln, die an den Wänden des Zellengangs loderten, schob Arontak den Holzbalken zur Seite und zog die Tür nach außen hin auf. Er tat dies mit Vorsicht, um gegen einen Angriff aus dem Inneren des Verlieses gewappnet zu sein. Doch aus der unbeleuchteten Kammer drang nicht der geringste Laut, und nichts rührte sich darin.
Karpak und Arontak bemühten sich, die Gefangenen im Inneren der Höhle auszumachen, die nur schwach durch die Fackeln im Raum davor erhellt wurde. Doch erst nach einigen Augenblicken erkannten sie zwei schemenhafte Gestalten, die sich am entferntesten Ende der Höhle mit steifen Gliedern aufrichteten und gegen das durch die Türöffnung auf sie fallende Licht erschrocken die Augen zusammenkniffen. Sie klammerten sich aus Furcht aneinander, wie sie es auch schon zuvor in der völligen Finsternis des Verlieses aufgrund der darin herrschenden Kälte getan hatten.
Ein Gefühl des Mitleids regte sich in Karpak, als er in die dunklen Augen der zitternden Gefangenen blickte, die ihn furchtsam anstarrten. Er trat einige Schritte auf sie zu und verspürte für einen winzigen Moment dieselbe Kälte, dieselbe Furcht, dieselbe Einsamkeit, dieselbe Verlorenheit und dasselbe Bedürfnis, sich an einen Gefährten zu klammern, von dem die beiden Wesen vor ihm tatsächlich erfüllt waren. In seinem Mitgefühl empfand Karpak ihre Furcht sogar fast körperlich und hatte für einen Augenblick die Illusion, an ihrer Stelle zu stehen.
Vielleicht war es die Kraft der Sonne, die ihm dieses außergewöhnliche Verständnis für die Seelen Fremder eingegeben hatte; vielleicht war es auch nur eine besondere Disposition seines empfindsamen Geistes, die ihn dazu befähigte, die Gefühle anderer Lebewesen zu erahnen. Aus solchen Momenten der Erkenntnis heraus hatte Karpak jedenfalls schon häufig Entscheidungen getroffen, die sein Leben und sein Verhältnis zu seinen Mitmenschen veränderten. Es waren Momente des wortlosen Verstehens anderer gewesen, Momente des Begreifens seiner eigenen Rolle in dieser Welt, Momente auch des Hoffens auf eine Erwiderung seines Mitgefühls. Diese Hoffnung auf gegenseitiges Verständnis, die tief in der menschlichen Natur verankert sein kann, ist aber auch, wenn sie enttäuscht wird, eine der häufigsten Ursachen für Ungerechtigkeit und Intoleranz, für Gewalt und Brutalität.
Während Karpak nun also einen Moment des Einfühlens in die Lage der Gefangenen erlebte, erblickte er in deren Augen kein Spiegelbild dieser Erkenntnis. Doch auch dies war für ihn keine neue Erfahrung. Gegenseitiges Verständnis war eine Seltenheit auf Erden. Die Wilden starrten ihn bloß aus vor Furcht glasig gewordenen Augen an; Augen, in denen kein Funke von Vernunft zu erkennen war, sondern eher etwas heimlich Drohendes zu schimmern schien. Vermutlich konnte man von ihnen in dieser Situation auch keine andere Reaktion erwarten als diese; und dennoch wurde Karpaks instinktives Mitgefühl gedämpft.
Er betrachtete die Gefangenen nun mit sachlicher Nüchternheit. Sie waren tatsächlich wie Tiere: zwei fast unbekleidete, sehnige und schlanke Wesen, die ihr schweres und karges Leben in der Natur des Urwalds kräftig und gesund gehalten hatte. Ihr Anblick bewies Karpak erneut, wie sehr sich Mensch und Tier ähnelten, erst recht dann, wenn der Mensch seinen Verstand nicht dazu einsetzte, um sich gegen den animalischen Kern in seinem Inneren aufzulehnen. Der Sonnenpriester fühlte sich jedoch gleichzeitig von dem Bild animalischer Einfachheit, das sich ihm hier bot, auch abgestoßen. Sein ganzes Streben hatte seit jeher dem Ziel gegolten, über die animalische Natur seiner Existenz hinauszuwachsen und diese nur als notwendige Voraussetzung seines geistigen Seins zu pflegen, eines geistigen Daseins, das für ihn im Zentrum des Lebens stand. Was er hier vor sich sah, erschien ihm als völlige Missachtung, wenn nicht gar als Umkehrung jenes Strebens nach Befreiung des Geistes vom Körper, das für ihn das wahre Menschsein definierte.
Doch Karpak war hierhergekommen, um den Gefangenen Rettung anzubieten, und nicht, um sie aufgrund abstrakter philosophischer Erwägungen zu verurteilen. Immer noch empfand er Mitgefühl für ihre Lage. Daher trat er weiter auf sie zu und streckte die rechte Hand mit der offenen Handfläche nach oben aus, um in einer symbolischen Geste seine Friedfertigkeit und Hilfsbereitschaft auszudrücken.
Die Wilden erstarrten jedoch nur, als er sich ihnen weiter näherte, und zeigten abgesehen davon keinerlei Reaktion. Offenbar trauten sie seinem Verhalten nicht und befürchteten eine Falle.
Karpak ging daher ganz zu ihnen hinein, während Arontak ihn besorgt beobachtete. Als der Sonnenpriester direkt vor den zitternden Gestalten stand, legte er der verängstigten Frau, die sich neben ihrem Begleiter duckte und sich an dessen Hüfte klammerte, in einer Geste der Versöhnung besänftigend die Hand auf das dicht behaarte Haupt. Langsam nickte er beiden zu.
Diese Gesten der Vertraulichkeit hätte Karpak jedoch besser unterlassen, wie ihn eigentlich auch seine Erfahrung hätte lehren müssen. Trotz seiner fast vierzig Sommer neigte er noch immer dazu, sich von den Gefühlen des Augenblicks leiten zu lassen. Karpak übersah daher in seinem aufrichtigen Mitgefühl für die Lage der Gefangenen, dass sein Verhalten bei Wesen, die in ihrem Leben von den Stadtbewohnern vor allem Tücke und Bosheit erfahren hatten, bloß zu Misstrauen über die wahren Motive des ihnen so Entgegenkommenden führen musste. Dies galt erst recht im Fall der beiden Gefangenen, die stundenlang und ohne Nahrung und Wasser in eine stockdunkle Felshöhle gesperrt worden waren, obwohl sie sich keiner Schuld bewusst waren.
So war es kein Wunder, dass der Mann, anstatt Karpaks Freundlichkeit zu begreifen oder gar zu erwidern, ihm einen raschen Tritt gegen die Beine versetzte, während die Frau, mehr aus Solidarität mit ihrem Gefährten denn aus Bosheit, die ihr entgegengestreckte Hand ergriff und dann biss, wenn auch nicht kräftig. Beide Gefangenen stießen dabei grimmige, schrille Laute aus, die wie ein Bellen klangen.
Karpak sprang rasch zum Eingang zurück, mehr erschrocken als verwundet. Seine Verletzungen waren unbedeutend; doch sein Stolz war getroffen. Arontak eilte an ihm vorbei in die Höhle hinein und erhob drohend die Lanze gegen die Wilden, die sich nun wieder am Boden aneinanderklammerten. Der Wächter war bereit, auf ein Signal des Sonnenpriesters hin mit dem stumpfen Ende der Lanze zuzustoßen und die Gefangenen so zu bestrafen.
Karpak winkte jedoch ab. Sein Zorn war bereits verraucht. Eine körperliche Züchtigung war sinnlos und würde auch keine Bedeutung mehr haben; denn er wusste nun, was er hatte erfahren wollen. Die Gefangenen hatten sich mit ihrer Reaktion selbst gerichtet und ihm so die Entscheidung abgenommen.
Karpak bedeutete daher dem Wächter, das Verlies mit ihm zusammen zu verlassen und die Tür wieder von außen zu verriegeln. »Lass es gut sein, Arontak. Wir wollen gehen. Diese beiden Tiere verdienen unsere Hilfe nicht. Wir hatten schon andere hier, die wertvoller waren als diese, einen intelligenteren Blick besaßen und in ihrer verstandeslosen Art doch dankbar waren für unsere Hilfe. Diese beiden aber gehen uns von nun an nichts mehr an.«
»Dabei habt Ihr versucht ihnen zu helfen, mit einer Großzügigkeit, die dieses Getier gar nicht verdient«, bekräftigte der Wächter. Er war zornig auf die Gefangenen, da sie den von ihm verehrten Sonnenpriester angegriffen hatten.
Karpak allerdings war von Arontaks Wortwahl enttäuscht; die Bezeichnung ‘Getier’ missfiel ihm, denn sie brachte gerade jene Verachtung zum Ausdruck, welche die Stadtbewohner im Allgemeinen den Urwaldmenschen gegenüber empfanden und von der er wenigstens die Bewohner des Tempels frei glaubte. Wenn Karpak selbst die Waldwilden als ‘Tiere’ bezeichnete, so war dies nicht abfällig gemeint, es war vielmehr eine Wertung ihres kulturellen Standes. Er vergaß dabei auch nicht, dass selbst das Stadtvolk in seiner Raserei Tieren ähnlich sein konnte und dass die Menschen generell in ihren körperlichen Begierden, die sie zeitlebens nur mühevoll unter Kontrolle zu bringen vermochten, wie Tiere gefangen waren. Die beiden menschlichen ‘Tiere’ im Verlies hinter ihnen zeigten ihre Tierhaftigkeit nur deutlicher als es die Menschen der Stadt taten. Darum waren sie noch lange kein ‘Getier’, das man wie Ungeziefer verachten konnte; und was das anging, so besaß selbst Ungeziefer grundsätzlich ein Lebensrecht, wie auch jede andere Kreatur.
Karpak erkannte jedoch, dass auch er selbst in seinen Gedankengängen nicht gerade konsequent war, wenn er die Wilden zwar gegen die Bezeichnung ‘Getier’ in Schutz nahm, sie gleichzeitig aber praktisch ihrem Schicksal überließ aufgrund des negativen Urteils, das er über sie gefällt hatte. Doch was hätte er tun können? Schließlich konnte er nicht allen Gefangenen das Leben retten, die sich das Volk als Opfer auserkoren hatte; denn dann wäre es mit seiner Macht als Sonnenpriester zu Ende gewesen, und er hätte überhaupt niemanden mehr retten können. Außerdem war er undankbar gegenüber Arontak, hatte aus dessen Worten doch vor allem Besorgnis um Karpaks Wohlergehen gesprochen.
Daher entschloss Karpak sich, die Wortwahl Arontaks nicht zu korrigieren und ihm nur schweren Herzens einige abschließenden Anweisungen zu geben: »Wir behalten die beiden Waldbewohner im Verlies. Wenn die Menge nach ihnen verlangt, so verteidigt sie nicht. Übergebt sie ihnen nicht, aber verhindert auch nicht, dass sie geholt werden. Wir werden sie nicht vor der Menge beschützen. Wenn das Volk sie sich als Opfer nehmen will, so soll es das tun. Es ist jetzt nicht mehr unsere Angelegenheit.«
Arontak nickte. Seiner Ansicht nach bemühte der Sonnenpriester sich ohnehin allzu sehr um das Wohlergehen irgendwelchen Gesindels, das sich in der Stadt herumtrieb und eine derartige Rücksichtnahme nicht verdiente.
SEIT STUNDEN befand Karpak sich in seinem Arbeitsraum in der obersten Tempelebene, von dem aus man durch schmale, keilförmige Öffnungen in alle vier Himmelsrichtungen blicken konnte. Er saß vor einigen Schreibsteinen und hatte neben sich ein Tongefäß mit in heißem Wasser aufgelöstem Kakaoextrakt, aus dem er gelegentlich einen Schluck nahm. Doch anstatt zu schreiben, blickte er nur nachdenklich durch die nach Westen zeigenden Fensteröffnungen in eine unbestimmte Ferne jenseits des Horizontes. Seine Seele war unruhig, obwohl er am Morgen dem Wunsch seines Gewissens nach einer versöhnlichen Verständigung mit den Wilden nachgegeben hatte.
Vielleicht war er aber auch gerade deshalb unruhig, weil diese Verständigung zu keinem Erfolg geführt hatte. Ein Teil seines Ichs empfand eine dumpfe Enttäuschung über die Vergeblichkeit seiner Bemühungen und über den Angriff der Gefangenen, der ihn dazu gebracht hatte, sich von ihrem Schicksal zu distanzieren. Er fühlte jene Form der Enttäuschung, die man stets empfindet, wenn sich einmal mehr die Erwartungen nicht erfüllen, die man an seine Mitmenschen stellt.
Doch konnte man seine Mitmenschen nicht ändern, solange diese selbst es nicht wollten. Auch bei den Stadtbewohnern hatte die Religion der Sonne nur geringe Veränderungen zum Besseren bewirkt. Erst recht ließen sich daher die Wilden nicht von den Prinzipien einer Religion der Gleichheit und Harmonie beeinflussen, von der sie im Grunde nichts verstanden. Es gab Beweggründe und Antriebe im menschlichen Verhalten, die so stark waren, dass sie sich von einer bloßen Idee, wie sie der Glaube an die allgütige Macht der Sonne darstellte, niemals würden grundlegend beeinflussen lassen. So fühlten manche Wesen den instinktiven Drang, sich aus Furcht aneinanderzu-klammern, wie es die beiden Wilden im Verlies taten, überwältigt von ihrer eigenen leiblichen Existenz und verbunden in der vermeintlichen Sicherheit ihrer gegenseitigen Nähe. Gegen solche Bedürfnisse ist der Verstand zunächst machtlos.
Aber auch die Masse der Stadtbevölkerung bot in ihrer verbrecherischen Raserei, wenn sie auf Menschenopfer aus war, dem Einzelnen vermeintliche Sicherheit und ein Gefühl der Stärke durch die unmittelbare körperliche Nähe scheinbar Gleichgesinnter. Doch in keiner Menschenmasse geht die Verbundenheit tief, und die Sicherheit, die sie bietet, ist zumeist trügerisch, weil das Individuum sich in der Menge auf den minimalen, triebhaften Kern seiner Natur reduziert. Nur dieser Kern ist in der Masse gemeinsam, und er ist darin auch das Einzige, das vom Individuum übrig bleibt. Karpak, dessen Natur jener Trieb zum Aufgehen in der Masse fremd war, schien es so, als suchten viele im Volk auf diese Weise geradezu nach dem Verlust ihrer eigenen Individualität. Anscheinend bot ihnen dies Erleichterung, vielleicht auch deshalb, weil sie mit sich selbst andernfalls wenig anzufangen wüssten.
Doch das Dasein war zu ernst für derartige Exzesse, insbesondere wenn man die Absicht hatte, es zu verbessern. Wenn Menschen nach Glück strebten, so war das die Natur der Welt, und auch Karpak selbst strebte danach. Für jene jedoch, die nie den Wunsch hegten, in ihrem Leben etwas zu erschaffen, das über sie selbst, über ihre eigene Existenz hinausging, und für die Glück stattdessen gleichbedeutend schien mit triebhaftem Vergnügen, brachte Karpaks Natur wenig Verständnis auf. Seinem eigenen Leben gaben derart vergängliche Vergnügungen keine Bereicherung, sie hinterließen in seiner Seele nur eine besondere Form von Leere. Die Früchte ernsthafter Beschäftigung und kreativer Interessen waren es, die allein seine Seele zu erfüllen und ihn glücklich zu machen vermochten; selbst Jahre danach, wenn Karpak an frühere Bemühungen, an Erfolge und selbst an Fehlschläge zurückdachte, fühlte er sich durch sie bereichert. Doch welchen moralischen Wert besaß diese Selbstverwirklichung, wenn man auf dem Weg dorthin Mitverantwortung trug an der Tötung anderer Menschen?
Der Priester erwachte aus seinen ihm letztlich nutzlos erscheinenden Grübeleien. Wieso eigentlich machte er sich weiterhin um das Schicksal der Gefangenen Gedanken, nachdem er zuvor im Verlies bereits eine Entscheidung getroffen hatte? Wieso konnte er nie aufhören, über Dinge nachzudenken, selbst wenn er schon zu einem Entschluss gekommen war? Warum stellte er sich immer wieder selbst infrage, während andere von Anfang an keinen Gedanken an das Schicksal der Wilden verschwendet hätten? Warum meinte ausgerechnet er, die Stärke beweisen zu müssen, die darin liegt, eine einmal getroffene Entscheidung gegebenenfalls umzuwerfen, sofern man durch weiteres Nachdenken an deren Richtigkeit zu zweifeln beginnt?
Auch wenn er den Gefangenen, die in seelenloser Hingabe an die Triebe ihres Körpers im Urwald lebten, keine Zuneigung entgegenbrachte, fühlte er sich doch verantwortlich für das Schicksal, das sie in seiner Stadt traf. Was hatte es schon zu bedeuten, dass die beiden ihn im Verlies angegriffen hatten? Es war eben ihre Natur, so zu handeln. Sie hatten ihn nicht einmal nennenswert verletzt, und vermutlich hatten sie ihn überhaupt nur deshalb attackiert, weil sie glaubten, sich gegen ihn verteidigen zu müssen. Schließlich hatte man ihnen zuerst Unrecht getan, und sie hielten Karpak für den dafür Verantwortlichen. Sie hatten ihn im Grunde nur aus ihrer Nähe verscheuchen wollen, wie Tiere das eben tun, wenn sie ihr Rudel verteidigen. Auch darin unterschieden sie sich nicht einmal so sehr von den Menschen der Stadt. Dass die Gefangenen seine Hilfsbereitschaft in ihrer primitiven Natur nicht zu erkennen vermochten, durfte man ihnen also nicht vorwerfen, schadeten sie sich damit doch selbst am meisten. Gerade weil sie primitiv und unverständig waren wie Tiere, verdienten und benötigten sie um so mehr Karpaks Hilfe.
So verwarf der Sonnenpriester nunmehr seine im Kerker getroffene Entscheidung und gab durch einen Boten Arontak Weisung, man solle die beiden Gefangenen nun doch in der Hitze des frühen Nachmittags, wenn das Stadtvolk zu ruhen pflegte, in aller Heimlichkeit aus dem Kerker entlassen und ihnen so die Möglichkeit geben, aus eigener Kraft in den Urwald zu entkommen. Wenn die Menge Opfer wünschte, musste sie sich diese selbst einfangen; diesmal würde man sie nicht im Tempel für das Opferritual bereithalten. Der Sonnentempel durfte niemals wieder zum Ausgangspunkt von Menschenopfern werden.
Karpak fühlte sein Gewissen erleichtert, nachdem er Arontak entsprechend Anweisung gegeben hatte. Gleichwohl hob seine Stimmung sich nur wenig. Ihn belastete weiterhin der Gedanke, in einer Welt und in einer Gesellschaft zu leben, in der Menschenopfer überhaupt möglich waren. In diesem Seelenzustand wünschte er sich, für den Rest des Tages keine anderen Lebewesen mehr zu Gesicht zu bekommen, so sehr verabscheute er an diesem Tag die Gesellschaft anderer. Ihm wurde mit einem Mal bewusst, wie wenige seiner Ideale aus der Jugendzeit er als Sonnenpriester in das Gemeinschaftsleben hatte einbringen können. Gerade heute würde ihn der Anblick seiner Mitmenschen besonders an die Brutalität erinnern, die in jedem Menschen lauerte und die in der Masse oft unkontrolliert hervorbrach. Diese Brutalität, die Karpak auch in sich selbst verborgen wusste und die er nur mit Hilfe seines Verstandes zu unterdrücken vermochte, stieß ihn ab. War es demgegenüber nicht sogar vorzuziehen, seinen Bedürfnissen immer nur so weit zu folgen, wie es die beiden Wilden in ihrer triebhaften Koexistenz taten, in der sie überdies vielleicht sogar zufriedener waren als die Masse der Stadtbewohner, die stattdessen in eine stets wiederkehrende Raserei verfielen? Er versuchte vergeblich, all die hässlichen Vorstellungen zu verdrängen, die sich seiner Seele nunmehr bemächtigten.
In Seelenzuständen wie diesem wünschte Karpak sich oft, einer jener Geister zu sein, von denen sein Volk glaubte, sie existierten ohne einen Körper, der sie nur behinderte und die Seele fesselte; gegen dessen Eigenleben mussten die Geister, anders als die Menschen, nicht ankämpfen. Mit derartigen Geistern bevölkerte die Mythologie alle Aspekte der Natur. Vielleicht existierten die Seelen der Verstorbenen ja tatsächlich in diesen Geistern fort, nachdem sie den Kampf gegen die Geschöpfe der Unterwelt erfolgreich bestanden hatten. Karpak gab dieser verlockenden Illusion für einige Minuten nach, während derer sie ihm Erleichterung von der bedrückenden Atmosphäre seiner augenblicklichen Realität verschaffte. Er war jedoch zu klarsichtig, um ernsthaft und auf Dauer an solche Mythen glauben zu können.
Allerdings war Karpak in seinem jetzigen Zustand einem jener mystischen Geister zumindest insoweit ähnlich, als auch er keine Ruhe zu finden vermochte. Innerlich aufgerieben warf er sich Oberflächlichkeit vor, weil er sich selbst in der Vergangenheit von Schuld freigesprochen hatte, da er persönlich bei den Menschenopfern nicht aktiv beteiligt war. Obwohl ihn tatsächlich keine Schuld daran traf, dass das Volk überhaupt nach Menschenopfern verlangte, trug er doch Mitschuld daran, wenn etwa gerade heute dieses spezielle Waldbewohnerpaar zu Opfern der Raserei würde; denn in seinem Tempel wurden auch sie gefangengehalten, wie schon so viele vor ihnen. Karpaks Schuld bestand darin, untätig dabeizustehen und es geschehen zu lassen, dass Gefangene von der Menge ergriffen und getötet wurden, obwohl dies gegen seine eigenen Überzeugungen verstieß.
Nun kamen Karpak jedoch auch Gründe in den Sinn, die gegen seine Schuld sprachen: Verbrachte er den heranbrechenden Nachmittag und Abend in seinem Schreibzimmer und kümmerte er sich um nichts, was draußen vor sich ging, so würde er auch nichts Unrechtes getan haben. Vielmehr hätte er den Gefangenen sogar für den Nachmittag eine Fluchtchance eröffnet, die sie ohne sein Eingreifen niemals erhalten hätten. Man hätte sie andernfalls vielleicht sogar schon gestern auf der Stelle hingerichtet. Darüber hinaus hatte Karpak keinen Einfluss auf die Taten des Volkes; er hatte oft genug vergeblich versucht. Menschenopfer durch seine Autorität zu verhindern. Aber gegen das Tier im Menschen waren die Bewohner des Tempels machtlos.
Doch am heutigen Tage erleichterte ihn auch diese Erkenntnis nicht in dem Maße, wie es früher in ähnlichen Situationen der Fall gewesen war. Zu oft in seinem Leben hatte Karpak den Dingen ihren Lauf gelassen. Zu oft schon hatte er sich in den Tempel zurückgezogen, während draußen auf dem Vorplatz Abscheulichkeiten geschahen. Zu oft schon hatte er seine Rolle in dem Kampf gegen den Aberglauben und dessen böse Begleiterscheinungen ignoriert und seine eigene Passivität zu vergessen versucht. So konnte es nicht weitergehen.
Doch was sollte er tun? Er besaß, selbst mit Unterstützung der Tempelwachen, nicht die Macht, um die Menge aufzuhalten. Dennoch würde er sich heute zumindest der Hässlichkeit des Menschenopfers stellen, wenn es dazu kommen sollte; er würde es zumindest mit ansehen und sich nicht mehr davon abwenden, um später so zu tun, als sei nichts geschehen. Wenn er danach seine Mitbürger aufgrund der Taten verachtete, deren Zeuge er würde, so sollte es eben so sein.
Als die Stunde anbrach, in der die Gefangenen auf seine Anweisung hin aus dem Verlies entlassen werden sollten, begab Karpak sich auf die oberste Plattform des Tempels, an fast genau jene Stelle, an der er am Morgen die aufgehende Sonne begrüßt hatte. Von dort bot sich ihm ein ungehinderter Ausblick auf die Stadt, insbesondere auf den weiten Tempelvorplatz, an dessen der Tempelpyramide gegenüberliegender Seite der große Opferschacht lag, der durch künstliche Erweiterung eines natürlichen Felsspalts geschaffen worden war. Dieser Schacht war fast kreisförmig und ursprünglich nur für Sachopfer bestimmt gewesen, wie Speise- und Trankopfer zur Erntezeit. An besonderen Tagen des Jahres, etwa zur Winter- und Sommersonnenwende, seltener auch bei anderen astronomischen Ereignissen, wurde er selbst heutzutage noch zum Schauplatz fröhlicher Feiern, bei denen jeder Teilnehmer großzügig Teile seines Mahls in den Schacht schleuderte, um so den Göttern Dank für die ihm erwiesene Gnade zu erweisen.
Heute, zur Mittagszeit, schien die Sonne erbarmungslos heiß auf die Stadt, und Karpak suchte bald den wohltuenden Schatten der Säulen am südöstlichen Rand der Plattform. Er war abermals allein hier oben, und auch die Stadt unter ihm war wie leergefegt; die Straßen lagen verlassen, fast ohne ein Zeichen von Bewegung. Über dreißigtausend Einwohner zählte die Metropole, doch ihre Bewohner hatten sich allesamt in ihre Behausungen zurückgezogen, um Schutz vor der sengenden Hitze und ein wenig Ruhe zu finden.
Karpaks Blick wanderte über die gewaltigen Gebäude der Stadt, voller Bewunderung für die architektonischen Leistungen seiner Vorfahren; er dachte an die gemeinschaftlichen Anstrengungen von Generationen, die in diesen herrlichen Bauwerken ihren zeitlosen Ausdruck fanden. Wie großartig waren doch diese Gebäude, wie erhaben war ihre Bauweise; und doch waren sie von Menschenhand geschaffen, klein zwar im Vergleich zu den gigantischen Schöpfungen der Natur, ohne Zweifel aber groß unter den Schöpfungen der Menschen — der gleichen Menschen jedoch, die mit ähnlicher Intensität und Ausdauer auch zu Zerstörung und Grausamkeit fähig waren.
Am Horizont zogen derweil weitere Sturmwolken herauf und schienen damit das Schicksal der Gefangenen zu besiegeln, falls es ihnen nicht gelingen sollte, rechtzeitig in den Urwald zu entkommen. Das nahende Unwetter brachte überdies eine gewisse Abkühlung mit sich: Heute würde die Mittagsruhe der Stadtbewohner früher enden als an den vorausgegangenen Tagen. Es wurde daher Zeit, die Wilden aus dem Kerker zu entlassen. War es erst einmal soweit, dass die kalten Vorboten des drohenden Sturms die Stadtbewohner beunruhigten und aus ihren Häusern trieben, so würde die gestaltlose Seele der Masse bald die Oberhand gewinnen und darauf drängen, das Opfer endlich zu vollziehen.
In diesem Augenblick fühlte Karpak sich einsam wie selten in seinem Leben. Es wäre ihm eine große Erleichterung gewesen, seine Überlegungen mit einem Vertrauten zu teilen. Doch seit vor sieben Sommern der letzte andere Sonnenpriester des Tempels gestorben war. sein alter Lehrer und Meister, gab es für Karpak keinen Vertrauten mehr. Die jungen Priesterschüler waren noch nicht reif genug, um mit ihnen derartige Gedanken zu diskutieren, wie sie Karpak nun bewegten; sie waren noch nicht einmal reif genug, um von ihnen für derartige Überlegungen überhaupt Verständnis zu erwarten, hätte er sie ihnen dennoch anvertraut. Sie hätten ihn nur für schwach gehalten, weil er seine Grenzen kannte und akzeptierte. Sie hätten nicht begriffen, dass seine Grenzen zu kennen in Wirklichkeit sogar eine große Stärke bedeutete. Andere Sonnenpriester gab es nur in weit entfernt gelegenen Städten. Doch wer wusste schon, ob diese ihn nicht sogar als Ketzer betrachtet hätten wegen solcher Überlegungen; denn jeder Tempelbezirk hatte seine eigenen Lehren entwickelt.
Fast beneidete Karpak in diesem Moment die beiden Wilden im Verlies unter ihm um den animalischen Halt, den sie aneinander fanden, und um die Vertrautheit und Kameradschaft, die ihnen ihre gegenseitige Nähe gab. Zu seinem Erstaunen erkannte er aber auch, dass dieser plötzliche Neid zudem eine gewisse Abneigung gegen die Wilden in ihm hervorrief. Es war freilich eine äußerst ungerechte Empfindung, die er schnell wieder aufzulösen verstand, indem er sich an die verzweifelte Situation erinnerte, in der die Gefangenen sich befanden und die alles andere als beneidenswert war. Ihr animalischer Zusammenhalt war sicherlich das Einzige, das sie ihre Lage überhaupt noch ertragen ließ, während ihm an ihrer Stelle Kultur und Bildung einen Rückhalt hätten geben können. Und doch beneidete er sie um einer engen Kameradschaft willen, wie er sie selbst nie kennengelernt hatte.
Indem er seine eigenen Neidgefühle beiseiteschob, eröffneten diese Karpak allerdings den Weg zu einer neuen Erkenntnis: Vielleicht wurden die Wilden ja auch deshalb als Opfer von den Stadtbewohnern ausersehen, weil sie in ihrer tierhaften Existenz etwas zu verlieren hatten, um das viele der Stadtbewohner sie ebenfalls beneideten: den gegenseitigen Halt, den sie einander boten und der unter den mit aller Kraft um den eigenen Vorteil kämpfenden Städtern selten war. War ihre Opferung etwa auch ein Ausdruck dieses Neids? Karpak schüttelte heftig den Kopf und versuchte, sich von derartigen Gedanken zu befreien. Offenbar leitete dieser Tag sein Denken stets zu den düstersten Aspekten des Menschseins.
Aufmerksam beobachtete er das seitliche Tor des Tempels, das in die unterste der zwölf Tempelebenen eingelassen war. Dort mussten die beiden Waldbewohner erscheinen, sobald die Wachen sie freiließen. Immer noch rührte sich dort jedoch nichts.
Karpaks Blick wanderte über die zwölf mal zwölf Stufen der großen Tempeltreppe, die zum Vorplatz hinab führten. Er musterte insbesondere die zahlreichen Bilder und Schriftsymbole, die darin eingraviert waren und die er in seiner Jugend studiert hatte. Die Treppe der Schriftzeichen erzählte viele Geschichten. — Was würde dort einst über ihn selbst zu lesen sein? Würde man überhaupt Anlass haben, sich seiner zu erinnern?
Als sich endlich etwas unten am Seiteneingang des Tempels regte, stand Karpak ganz im Schatten zweier senkrecht stehender Säulen, die den Punkt des Sonnenaufgangs zur Sommersonnenwende markierten. Von dort aus sah er, wie das Tor vorsichtig geöffnet wurde und Arontak selbst erschien, gefolgt von zwei Wachen, die zwischen sich die beiden Gefangenen führten. Mit angedeuteten Stößen ihrer Lanzen trieben sie die Gefangenen auf eine der Querstraßen hinaus, die in Richtung auf den östlich gelegenen Urwald führte.
Die Waldbewohner wichen ängstlich vor den Lanzenspitzen zurück und klammerten sich aneinander, wobei der Mann die Frau zu schützen suchte. Im Sonnenlicht enthüllte sich die imponierende Kraft und Geschmeidigkeit ihrer Gestalten, die im Verlies nicht zur Geltung gekommen war. Die Natur hatte diese ihr am nächsten stehenden Wesen mit beneidenswerter Anmut und Stärke ausgestattet. Der Mann war kräftig und sehnig, und die Frau mochte in ihrer Welt als Schönheit gelten. Doch die Furcht, die sie empfanden, und das Fehlen von Selbstsicherheit in ihrem Verhalten reduzierten den Eindruck beträchtlich, den ihr Äußeres andernfalls beim Betrachter hinterlassen hätte.
Die Seitenstraße, auf der sich dies abspielte, war menschenleer und konnte glücklicherweise vom Tempelvorplatz aus nicht eingesehen werden, auf dem sich nun die ersten Schaulustigen einfanden, um der für den späten Nachmittag erwarteten Opferzeremonie beizuwohnen. Es würde daher nicht mehr lange dauern, bis auch die Seitenstraße sich mit Leben füllte. Somit war Eile geboten.
Doch die Wilden rührten sich nicht, da sie eine Falle vermuteten und auch nicht verstanden, was von ihnen erwartet wurde. Arontak gab ihnen daher ein weiteres Zeichen, indem er die Lanze bis zur Schulter hob und mit deren Spitze die Seitenstraße entlang wies. Dann deutete er mit der linken Hand in Richtung auf den hinter den Gebäuden der Stadt dunkelgrau schimmernden Urwald.
Nun endlich begriffen die Gefangenen. Schon ihr erster Blick, als sie aus dem Tempel gezerrt worden waren, hatte ihrer Heimat, den in der Ferne liegenden Wäldern gegolten. Die Sehnsucht in ihren Herzen, an den ihnen einzig vertrauten Ort zurückzukehren, war durch die langen Stunden im Verlies des Tempels ins Unermessliche gestiegen. Als der hochgewachsene Wächter ihnen nun mit der Lanze bedeutete, sie sollten in diese Richtung gehen, hielt sie nichts mehr zurück. Erst zögernd, ein falsches Spiel befürchtend, dann rascher, als die Wachen keinerlei Anstalten machten ihnen zu folgen oder die Lanzen nach ihnen zu werfen, bewegten die Freigelassenen sich die Seitenstraße entlang.
Karpak beobachtete von der obersten Tempelebene aus, wie ihre vorher geduckten Körper sich beim Laufen allmählich aufrichteten. Jetzt zeigte sich die animalische Geschmeidigkeit dieser sich eigentlich ständig in Bewegung befindlichen Wesen. Ihre unerwartete Befreiung ließ sie Kraft und Sicherheit wiederfinden; ihre ureigensten Triebe brachen aus ihnen heraus, und ihre Lebensgier wurde unbezähmbar. Immer schneller rannten sie in Richtung des Urwalds, der ihre Rettung bedeutete.
Gerade dieses rasche Laufen war es jedoch, das schließlich zu ihrer Entdeckung führte. Wäre ihr Gang ruhig und damit unauffällig gewesen, so hätte keiner der in der gerade erst abnehmenden Mittagshitze noch träge in ihren Heimen verharrenden Stadtbewohner die Schritte der Freigelassenen sonderlich beachtet. Die Geräusche schnellen Rennens allerdings, das heftige Atmen, die festen und wie Trommelschläge aufeinanderfolgenden Schritte in der feuchten Schwüle des Nachmittags erweckten den Argwohn derjenigen, die mit einer Flucht der Wilden aus der Stadt gerechnet hatten, weil ihnen die Weichherzigkeit des Sonnenpriesters schon seit jeher suspekt war. Man glaubte von Karpak, dass er den notwendigen Härten des Lebens nicht gewachsen sei und es in seiner vermeintlichen Schwäche vorzog, Ideale und theoretische Betrachtungen in weltfremder Abgeschiedenheit zu verfolgen, dabei sein Volk im Stich lassend, anstatt die Macht mit beiden Händen zu packen, die sich ihm in seiner Position bot. Hatte er heute etwa schon wieder zum Schaden der Stadt gehandelt und Gefangenen die Flucht ermöglicht?
Als argwöhnisch gewordene Anwohner auf die Seitenstraße hinaus eilten und die Flüchtenden entdeckten, war Arontak mit den Wächtern längst wieder im Tempel verschwunden. Einige der Anwohner folgten den Flüchtenden bloß verärgert mit den Augen. Viele trachteten jedoch sofort danach, ihnen den Weg zu versperren und sie einzukreisen, um die Beute festzuhalten.
Karpak richtete sich im Schatten der Säulen auf der obersten Ebene des Tempels auf, um die Ereignisse besser verfolgen zu können. Er empfand das, was dort unten geschah, als zutiefst ungerecht und erkannte, dass es einen gewaltigen Unterschied machte, ob man die Augen verschloss und nur intellektuell vermutete, was sich außerhalb des Tempels ereignete, oder ob man tatsächlich dabei zusah, wie scheinbar friedliebende Menschen, denen man sich mehr oder weniger verbunden fühlte, anderen Wesen Leid und Schmerz zufügten, in der Absicht, ihnen schließlich das Leben zu nehmen. Den konkreten Anblick des Unrechts würde er wohl kaum so leicht verdrängen können wie in den vorausgegangenen Jahren die abstrakte Vorstellung davon.
In diesem Augenblick fühlte Karpak sich seinem Volk erschreckend fremd. Zwar hatte er, als einer der wenigen zum Sonnenpriester Berufenen, schon immer eine Sonderrolle unter seinen Mitmenschen eingenommen; doch war es die Rolle eines tolerierten und auch respektierten Außenseiters gewesen, der im Grunde Teil des Ganzen war, Teil der Stadt und Teil eines Tempellebens, in das auch alle anderen von Zeit zu Zeit eingebunden waren. Nun aber empfand Karpak mit den Opfern des Unrechts eine weitaus engere Verbundenheit als mit den Bewohnern seiner Stadt. Nur noch mit Ersteren konnte er sich in dieser Situation identifizieren.
Die Verfolgten waren mittlerweile umzingelt worden und standen daher bewegungslos auf der Seitenstraße. Sie umklammerten einander furchtsam, umringt von einer kalt drohenden Menge, die den Kreis immer enger um sie schloss.
Wieder regte sich Karpaks Mitgefühl, wieder konnte er die Ängste der Wilden nachempfinden, fast so als wären es seine eigenen. Er erinnerte sich daran, wie er selbst sich als Kind in ähnlich beängstigenden Situationen befunden hatte. Damals hatte er es nicht selten vorgezogen, anstatt sich an den Spielen der Gleichaltrigen zu beteiligen, seine Zeit im Tempel mit seinem Lehrer zu verbringen, dem alten Sonnenpriester, um diesem die Fragen zu stellen, denen sein kindliches Gemüt sich in großer Hingabe widmete. Einige andere Kinder hatten Karpak daher auf seinem Weg zum Tempel regelmäßig aufgelauert und bedroht — denn sie hatten vor Karpak erkannt, was ihm selbst als Kind noch nicht bewusst gewesen war: dass er sich von ihnen unterschied. Was wäre damals wohl geschehen, wenn sein Meister, der diese Entwicklung in seiner großen Weisheit vorausgeahnt hatte, nicht rechtzeitig eingegriffen und ihm beigestanden hätte?
Unruhig beobachtete Karpak, wie der Kreis der Stadtbewohner sich um die Wilden schloss und das Paar an der Tempelseite entlang auf den großen Vorplatz gezerrt wurde. Das Volk begleitete diese Gewalttätigkeit, wie um sie zu rechtfertigen, mit üblen Beschimpfungen und Beleidigungen gegen die Opfer, die sich hilflos zu wehren versuchten. Vergeblich bemühte sich der Mann, wenigstens die Frau gegen die nun einsetzenden Schläge zu schützen.
Ihre Wehrlosigkeit war mitleiderregend; doch Karpak war offenbar der Einzige, der im allgemeinen Rausch der Gewalt zu Mitleid fähig war. Er stellte mit Entsetzen fest, dass es einer gewalttätigen Minderheit gelungen war, der passiven Mehrheit, die sie gewähren ließ, ihren Willen aufzudrücken. Warum verhinderten die abseitsstehenden Zuschauer das Unrecht nicht? Eigentlich waren die anderen, die Passiven doch in der Überzahl! Aber hatte nicht auch Karpak selbst sich bisher abseits gehalten, weil er das Gesetz der Gewalt, das die Masse beherrschte, für unüberwindlich hielt? Hatte nicht auch er sich mit der Gewalttätigkeit abgefunden? Würde er überhaupt etwas ändern können, wenn er nun hinunterging und sich auf die Seite der Gefangenen stellte; wenn er versuchte, die passiv Dabeistehenden gegen die Tobenden in der Menge zu vereinen? In den Tiefen seines Verstandes hielt Karpak diesen Versuch für sinnlos; denn schon sein Meister hatte ihm berichtet, wie solche Bemühungen in der Vergangenheit stets erfolglos geblieben waren, weil die aggressive Gewalttätigkeit der Wenigen sich gegen die Passivität der Vielen stets durchzusetzen vermochte. Doch Karpaks Herz wollte diese Wahrheit nicht akzeptieren.
Schließlich gab ein anderer Umstand den Ausschlag dafür, dass Karpak sich trotz aller Vorbehalte entschloss, einzugreifen: Unter den Tobenden in der Masse erkannte er einige derjenigen wieder, die ihn selbst vor vielen Jahren in seiner Kindheit auf dem Weg zum Tempel angegriffen hatten und gegen deren feige Übermacht er sich allein nicht hatte verteidigen können. Damals hatte ihn der alte Sonnenpriester beschützt. Heute würde Karpak genauso wenig dabeistehen und dieselben Menschen gewähren lassen, die er seither gering achtete; er würde ihnen das Vergnügen nehmen, andere zu quälen; er würde ihnen die Macht wieder entreißen, die sie durch seinen Rückzug in den Tempel gewonnen hatten. Karpak vergaß seine Furcht vor den Schlechtesten im Volk und hoffte, die Abseitsstehenden würden nur auf jemanden warten, der bereit war, den ersten Schritt zu tun und sich den Wütenden in den Weg zu stellen, um es ihm dann nachzutun. Nicht, weil die Abseitsstehenden die Wilden um jeden Preis retten wollten, sondern weil sie wieder einen Zustand der Ordnung herbeiwünschen mussten, der allein ein gemeinschaftliches Leben in der Stadt auf Dauer ermöglichte.
Würden sie aber auch tatsächlich den Mut haben, Karpak zur Seite zu stehen, wenn er eingriff? Oder würden sie weiterhin distanziert bleiben, um sich selbst keiner Gefahr auszusetzen? Karpak war die Antwort auf diese Frage nunmehr jedoch fast gleichgültig. Denn bei seiner Entscheidung kam es letztlich nur auf ihn selbst an, darauf, was er selbst von seiner bisherigen Apathie hielt. Heute würde er handeln; zu oft schon hatte er sein Gewissen durch Untätigkeit belastet. Obwohl er einer jener Menschen war, die reichlich Lebenszeit mit Betrachtungen über die Ideale verbrachten, denen sie folgen wollten, sich oft sogar in Fantasien über Idealsituationen verloren, in denen der Mensch einfach handeln muss und nicht theoretisieren darf, wenn er das Gute in sich beweisen will, vermochte Karpak sich doch nicht mehr damit zu begnügen, seine Ideale bloß zu predigen oder sie nur in solchen Situationen anzuwenden, in denen keine Gefahr damit verbunden war. Er musste sich endlich auch hier einmischen und verbessern, was er für schlecht hielt. Ideale, denen nicht die Tat folgte, waren auf Dauer nicht ernst zu nehmen. Auch wenn er als Einzelner weder die Welt noch die Natur des Menschen ändern konnte, so wollte er dennoch versuchen, einen Unterschied zu machen — und sei es nur für einen Augenblick.
Immer noch dauerte der Zweikampf der Gedanken in seinem Inneren an. Er zwang Karpak dazu, wie gelähmt von Zeit zu Zeit in seinen Überlegungen innezuhalten und sich nochmals darüber bewusst zu werden, welche Folgen sein Tun haben konnte und wem seine Hilfe überhaupt galt. Einerseits fand er in seiner eigenen, geistigen und den Körper wenig fordernden Lebensweise kaum Gemeinsamkeiten mit dem Leben der Wilden, denen seine Überlegungen galten; andererseits fühlte er sich ihnen doch verwandt in ihrer Verbundenheit zur Natur, die seiner eigenen Verehrung der Sonne als Lebensschöpferin ähnelte. Er beneidete die Waldbewohner sogar auf eine nicht ganz von negativen Gefühlen freie Weise um ihre von animalischen Instinkten geprägte Existenz, die nicht gefesselt war von den Zwängen der Stadtgesellschaft. Die Lebensweise der Wilden schien ihm frei von unnötigen Konventionen; sie gaben sich ihrer Natur ohne Hemmung und falsche Moral hin. In der Stadt dagegen pflegte man eine Kultur, in der die Natürlichkeit des Lebens durch Regeln und Vorschriften verdrängt und geknechtet wurde, auch wenn die Annehmlichkeiten des Stadtlebens einen nicht unbedeutenden Ausgleich dafür boten. Doch was zählte dieser Luxus, wenn die Seele darin gefangen war? Ein bisher allzu oft beiseite geschobener Teil seiner Persönlichkeit drängte Karpak dazu, die Unberührtheit der Natur, die das Waldbewohnerpaar in seiner unwissenden Unschuld für ihn verkörperte, gegen die brutale Ungerechtigkeit der Stadt zu verteidigen. Karpaks asketisches Leben inmitten einer gefühlsarmen Umgebung führte überdies dazu, dass er den mit diesen Überlegungen verbundenen Gefühlsaufwallungen nun besonders leicht erlag.
Die fundamentalen Unterschiede zwischen ihm und den Wilden, derer er sich durchaus bewusst war, änderten daher nichts mehr an seinem Entschluss, zu ihrer Rettung einzuschreiten. Endlich überwand Karpak sich und verliefe das Tempeldach — zuerst mit langsamen Schritten, dann immer rascher die langen, verwinkelten und schmalen Treppen und Gänge im Tempelinneren hinab eilend, vorbei an dem Raum mit den von der Decke hängenden goldenen Käfigen, in denen die durch seine Eile irritierten Quetzalvögel aufgebracht krächzten: vorbei auch an Wohnräumen und Lagerhallen, ungenutzten Lehrzimmern und verschlossenen Betkammern.
Als er die unterste Ebene des Tempels erreichte, war Karpak klar geworden, dass es nicht nur sein schlechtes Gewissen über frühere Menschenopfer war, das ihn heute zum Handeln drängte, es war auch der Wunsch, gerade diesen beiden Wilden, die er nunmehr wieder mit unschuldigen Tieren in Menschengestalt gleichsetzte, ihr so hart verteidigtes Dasein zu erhalten. Sie mussten in der Lage sein, Glück und Liebe zu empfinden — dies bewies ihm ihr enger Zusammenhalt. Und allein schon diese Empfindungen verdienten es, verteidigt zu werden. Karpak wünschte sich eine Welt, in der für alle Wesen ein Leben in Frieden und Einklang miteinander möglich war, in Einklang auch mit der eigenen animalischen Existenz, in einer Harmonie, wie sie die beiden Wilden vielleicht schon gefunden hatten; eine Welt der Gewalt-losigkeit, in der es keine Menschenopfer gab und in der jenen, die sich selbst die Fähigkeit erhalten hatten, auch aus simplen Dingen Glück zu ziehen, die Möglichkeit dazu nicht brutal genommen wurde.
Mit festem Schritt trat Karpak durch das weit ausladende Hauptportal des Tempels auf die breiten Stufen, die zum Vorplatz hinunterführten. Er vergaß jetzt die Grübeleien der letzten Stunden und eilte auf die Menge zu, die, von der Seitenstraße her kommend, auf den runden Opferschacht am gegenüberliegenden Ende des Tempelvorplatzes zustrebte. Die Wilden waren inzwischen aneinandergefesselt worden. Blut lief aus den misshandelten Gliedern über ihre Leiber hinab und tropfte zu Boden.
Nur wenige Menschen sahen den Sonnenpriester, während dieser auf sie zu eilte. Es waren jene, die unentschlossen nebenher liefen, sich an der Gewalttätigkeit nicht aktiv beteiligten und schon seit einigen Minuten immer wieder Rat und Hilfe suchend in Richtung des Tempels geblickt hatten, in der Hoffnung, dass der Sonnenpriester oder seine Leibwache dort erscheinen und ordnend eingreifen würden.
Als sie nun den Priester tatsächlich erblickten, noch dazu ohne Begleitung seiner Wachen, waren sie nichtsdestotrotz überrascht über sein Auftauchen. Karpak winkte ihnen zu, damit sie zu ihm kämen und bei seinem Rettungsversuch beistünden.