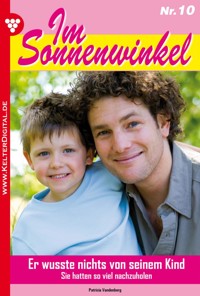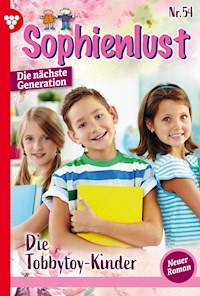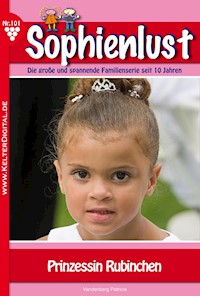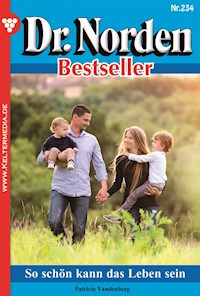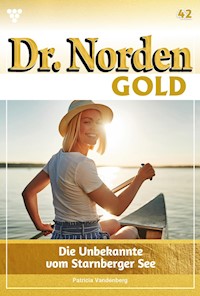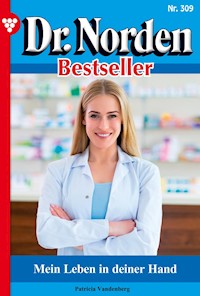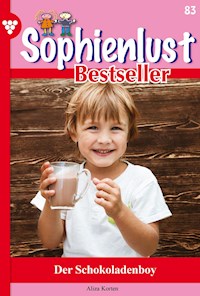Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Martin Kelter Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Im Sonnenwinkel
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Im Sonnenwinkel ist eine Familienroman-Serie, bestehend aus 75 in sich abgeschlossenen Romanen. Schauplätze sind der am Sternsee gelegene Sonnenwinkel und die Felsenburg, eine beachtliche Ruine von geschichtlicher Bedeutung. Wundervolle, Familienromane die die Herzen aller höherschlagen lassen. Noch vor ein paar Jahren hatte das Waisenhaus »Sankt Florian« vor den Toren der Stadt gelegen, umgeben von Wiesen und Feldern. Manche Kinder konnten sich noch genau daran erinnern. Aber dann war eine moderne Wohnsiedlung gebaut worden, die immer mehr wuchs und bald auch den Blick auf das Birkenwäldchen verdeckte. Das hatte vor allem dem jetzt fünfjährigen Mario weh getan, der so gern vom Fenster aus dort hinübergeschaut hatte. Das zarte Grün der Birken hatte ihm besonders gut gefallen, und wenn der Wind die biegsamen Stämme wiegte, hatte er dagesessen und geträumt, dass eine gute Fee eines Tages von dort kommen und ihn aus dem Heim fortholen würde. Ein Gutes hatte die Siedlung, wenn auch nicht für Mario, aber manche der Menschen, die dort wohnten, begannen sich für das Waisenhaus zu interessieren und auch für manches Kind, das dadurch ein richtiges Zuhause fand. Für Mario hatte dies keine Geltung. Über ihn sahen sie hinweg. Er war ein gar zu schmächtiges Bürschchen für seine Jahre und nicht besonders hübsch. Wenigstens konnte man nicht gleich auf den ersten Blick feststellen, wie schön die dunklen Augen waren und wie lieb sein Lächeln. Und zuerst schauten diese Menschen immer nach dem Äußeren. Mario hegte solche Gedanken nicht. Er war zu jung dazu. Es zog ihm nur das Herz zusammen, wenn eines nach dem anderen von den Kindern, die auch er mochte, weggeholt wurde. Er fragte nicht nach dem Warum. Fragen hatte keinen Sinn, denn solche Fragen überhörten die Betreuerinnen, die zwar gerecht, aber auch streng waren und sich dazu nicht
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 145
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Im Sonnenwinkel – 44 –
Ein Kind und keine Heimat
Mario träumt von Geborgenheit
Patricia Vandenberg
Noch vor ein paar Jahren hatte das Waisenhaus »Sankt Florian« vor den Toren der Stadt gelegen, umgeben von Wiesen und Feldern. Manche Kinder konnten sich noch genau daran erinnern. Aber dann war eine moderne Wohnsiedlung gebaut worden, die immer mehr wuchs und bald auch den Blick auf das Birkenwäldchen verdeckte.
Das hatte vor allem dem jetzt fünfjährigen Mario weh getan, der so gern vom Fenster aus dort hinübergeschaut hatte. Das zarte Grün der Birken hatte ihm besonders gut gefallen, und wenn der Wind die biegsamen Stämme wiegte, hatte er dagesessen und geträumt, dass eine gute Fee eines Tages von dort kommen und ihn aus dem Heim fortholen würde.
Ein Gutes hatte die Siedlung, wenn auch nicht für Mario, aber manche der Menschen, die dort wohnten, begannen sich für das Waisenhaus zu interessieren und auch für manches Kind, das dadurch ein richtiges Zuhause fand.
Für Mario hatte dies keine Geltung.
Über ihn sahen sie hinweg. Er war ein gar zu schmächtiges Bürschchen für seine Jahre und nicht besonders hübsch. Wenigstens konnte man nicht gleich auf den ersten Blick feststellen, wie schön die dunklen Augen waren und wie lieb sein Lächeln. Und zuerst schauten diese Menschen immer nach dem Äußeren.
Mario hegte solche Gedanken nicht. Er war zu jung dazu. Es zog ihm nur das Herz zusammen, wenn eines nach dem anderen von den Kindern, die auch er mochte, weggeholt wurde.
Er fragte nicht nach dem Warum. Fragen hatte keinen Sinn, denn solche Fragen überhörten die Betreuerinnen, die zwar gerecht, aber auch streng waren und sich dazu nicht um jedes Kind kümmern konnten, wie es nötig gewesen wäre.
Aber er dachte es sich wieder: Warum nimmt mich niemand mit? Nur einmal sehen wollte er, wie es in einem von diesen hübschen Häusern aussah, oder wie man in solch einer Wohnung im vierten oder fünften Stock lebte, die alle Balkone hatten. Und noch viel lieber hätte er zu ein paar Menschen gehört, die er auch einmal umarmen dürfte, die ihn in die Mitte nahmen, deren Hände er fassen könnte.
»Er sieht so kränklich aus«, hatte einmal eine junge hübsche Frau gesagt, als sie an ihm vorüberging. Er hatte es gehört. Danach hatte er lange geweint, aber Christel hatte ihn getröstet.
Christel war auch eines von den Kindern, über das hinweggesehen wurde. Ein zierliches blasses Mädchen, noch ein Jahr jünger als Mario. Sie war erst vor einem Jahr in das Waisenhaus gekommen. Mario war hier schon seit dem dritten Monat seines Lebens.
Mario lebte in der ständigen Angst, dass man Christel eines Tages doch wegholen könnte, und jedes Mal war er froh, wenn statt ihrer wieder ein anderes Kind mitgenommen wurde.
Heute war nun wieder so ein Tag, an dem ein Ehepaar erwartet wurde, das ein Kind adoptieren wollte.
»Nur ein Mädchen kommt infrage«, hatte die Oberin gleich gesagt. Die Jungen brauchten also gar nicht erst in Erscheinung zu treten. Mario starrte trübselig vor sich hin.
»Brauchst nicht traurig sein, Mario«, sagte Christel zu ihm. »Mich nehmen sie doch nicht, wenn ich jetzt auch herausgeputzt werde.«
Bald kam die Stunde, da die Mädchen zwischen drei und fünf Jahren geholt wurden. Er fand, dass Christel heute ganz besonders hübsch aussah. Für ihn war sie überhaupt die Hübscheste. Sein Herz hämmerte schmerzhaft. Eine bange Ahnung war in ihm, und sie sollte sich bewahrheiten.
Er erfuhr es von Christel selbst, weil man ihr gestattet hatte, sich von ihrem Freund Mario zu verabschieden.
Christel schluckte zweimal, bevor sie es Mario sagte. »Sie wollen mich haben, weil ich ihrer Ingrid so ähnlich sehe«, wisperte sie. »Sie hatten nämlich ein kleines Mädchen, das gestorben ist. Sie sind lieb, Mario. Wenn ich erst da bin, frage ich sie, ob sie dich nicht auch haben wollen, aber da soll die Oberin nicht dabei sein. Ich vergesse dich nicht. Du bleibst immer mein allerbester Freund.«
Christel war fort, und für Mario war die Welt nur noch grau, trostlos und ohne Hoffnung.
Es vergingen Tage und Wochen, die zu Monaten wurden, ohne dass er etwas von Christel hörte. Eines Tages wagte er dann doch eine Frage an die jüngste Schwester, die noch am zugänglichsten war.
»Oh, Christel geht es sehr gut«, sagte sie, und meinte, ihm damit eine Freude zu machen.
»Wo ist sie denn jetzt?«, fragte er scheu.
»In einem Ort, der Hohenborn heißt«, erwiderte die Schwester.
Hohenborn, das setzte sich in seinem kleinen Kopf fest. Er träumte davon und er dachte unentwegt daran, bis der Frühling kam und er nun schon bald sechs Jahre wurde und zur Schule kommen sollte. Nur noch ein knappes halbes Jahr, dann musste er Tag für Tag die Schulbank drücken, und jeder Tag entfernte ihn mehr von der Hoffnung, auch ein Zuhause zu finden, denn Kinder, die erst mal zur Schule gingen, blieben im Heim.
Es war ein Freitag und der erste schöne sonnige Tag. Die drei- bis fünfjährigen Kinder sollten mit Schwester Lore einen Ausflug machen. Mario hatte einen solchen Tag herbeigesehnt, denn er hatte schon lange einen Plan gefasst. Er wollte Christel suchen. Vielleicht würden ihre neuen Eltern ihn behalten, wenn sie merkten, wie lieb er Christel noch immer hatte.
Irgendwie würde er schon nach Hohenborn kommen, denn Schwester Lore hatte ihm mal gesagt, dass dies gar nicht so weit entfernt sei und dass Christel ihn womöglich doch mal besuchen würde, wenn erst wieder schönes Wetter wäre.
Warten wollte er nicht mehr. Und allein sein wollte er auch nicht mehr. Er hatte sich nicht wieder an neue Kinder angeschlossen, weil er Angst hatte, dass sie auch bald wieder fortgehen würden.
»Er ist ein Einzelgänger«, hatte die Oberin gesagt. »Man muss ihn gehen lassen.«
Man ließ ihn gehen. Auch auf dem Ausflug war er allein, und weil er sonst immer ein folgsames Kind war, hatte Schwester Lore auch kein besonderes Augenmerk auf ihn. Und dann war er verschwunden.
*
In Erlenried machte Pfarrer Frericks einen kurzen Entwurf für eine Predigt. Morgen sollte er in Hohenborn einen Kollegen, der erkrankt war, vertreten und ein junges Paar trauen. Es war ganz plötzlich gekommen, aber Pfarrer Frericks hielt sich ohnehin meist nicht an ein Konzept. Ihm kamen die Worte über die Lippen, wie er in Stimmung war. Aber bei einer Trauung musste doch auf das vorherige Leben des Paares Bezug genommen werden, und die Unterlagen musste er sich doch vornehmen.
Fritzi, seine junge Frau, Lehrerin an der Schule in Erlenried, kam vom Unterricht nach Hause und wunderte sich, ihren Mann am Schreibtisch zu finden.
»He, du, wie ist es denn?«, rief sie munter. »Morgen ist schulfreier Samstag. Da könnten wir doch heute mal nach Riesalm fahren und bis morgen bleiben. Seit wann machst du die Sonntagspredigt schon am Freitag, Holger?«
»Ich kann nicht fahren, Liebes«, erwiderte er. »Ich muss morgen den Kollegen in Hohenborn vertreten. Es ist eine Hochzeit.«
»Na, dann ist es nicht zu ändern«, sagte Fritzi. »Eine Trauung ist wichtiger.«
»Aber ich hab’s schon. Wir können wenigstens den schönen Nachmittag ausnutzen und ein bisschen wandern. Die Luft ist herrlich.«
»Dann mache ich schnell das Essen«, sagte Fritzi.
»Ach was, wir essen draußen. Dir tut es auch mal gut, wenn du nicht kochen musst«, meinte er.
»Wer heiratet denn?«, fragte Fritzi unterwegs. Es war nicht Neugierde, sondern einfach Anteilnahme am Beruf ihres Mannes.
»Ich kenne sie nicht. Die Braut heißt Petra Schüner. Sie wohnt noch nicht lange in Hohenborn. Der Bräutigam heißt Rolf Gerson. Es fällt mir immer ein bisschen schwer zu sprechen, wenn ich keine innere Beziehung zu den Menschen habe, das weißt du ja, Fritzi.«
Ja, dass wusste sie, aber wenn es ein glückliches Paar war, würde er die innere Beziehung schnell finden. Ihr Holger war für sie der beste Pfarrer, den es gab, und diese Meinung teilten alle, die in Erlenried und im Sonnenwinkel lebten.
*
»Es geht so ziemlich alles schief«, sagte Petra Schüner zu ihrer Freundin Viola Felding. »Jetzt ist auch der Pfarrer noch krank geworden, und Rolf ist auch immer noch nicht da.«
»Es wird ein anderer Pfarrer predigen, und Rolf wird rechtzeitig kommen«, sagte Viola aufmunternd.
»Und wenn Mama vor lauter Aufregung in Ohnmacht fällt?«, fragte Petra.
»Dann hast du ja glücklicherweise eine Freundin zur Seite, die Ärztin ist«, lächelte Viola. »So viel Praxis habe ich jetzt schon.«
»Und ans Heiraten denkst du wohl gar nicht, Viola?«, fragte Petra.
»Nein«, kam die kurze, aber sehr bestimmte Antwort.
»Hast du die Enttäuschung mit Jim noch immer nicht verwunden?«, fragte Petra vorsichtig.
»Ach was, wir lebten in zwei verschiedenen Welten. Ich bin nur vorsichtig geworden. Jetzt habe ich meinen Beruf, und der füllt mich aus.«
»Willst kranke Kinder gesund pflegen und auf eigene verzichten«, sagte Petra mit leisem Vorwurf. »Gerade du, die so kindernärrisch ist. Na, jedenfalls gibt es diesbezüglich mit deinem Brautführer wenigstens eine Übereinstimmung.«
»Welche?«, fragte Viola geistesabwesend.
»Johannes ist auch kindernärrisch. Übrigens muss ich dich in Bezug auf ihn noch ein wenig aufklären. Er heißt Johannes Wirth und ist Rolfs Freund. Er ist sehr zurückhaltend. Hatte einen schweren Unfall und seither ein steifes Bein. Seine Verlobte hat ihn deswegen im Stich gelassen. Sie war ein rechtes Biest, aber das nur zu dir. Für ihn war sie wohl die große Liebe, und er kann es nicht verwinden. Solche Männer gibt es auch noch, aber dir wird es ja bei deiner Einstellung nicht unlieb sein, wenn du keinen Charmeur an der Seite hast.«
Trotz all ihrer Bedenken wegen ihrer morgigen Hochzeit war Petra fidel und sehr reizend anzuschauen. Sie war wie Viola siebenundzwanzig Jahre und schon lange mit Rolf Gerson verlobt. Sie hatten ihre Heirat nicht überstürzt, sondern sich wirklich geprüft.
Viola neidete der Freundin das Glück nicht. Sie mochte Rolf, obgleich sie ihn nur selten gesehen hatte. Er war ein tüchtiger junger Mann und hatte durch die Vermittlung seines Freundes Johannes die Stellung in den Münster-Werken in Hohenborn bekommen. Petra hatte die letzten Wochen damit verbracht, hier die Wohnung einzurichten, denn schon am nächsten Ersten wollte Rolf seine Stellung antreten. Die obligatorische Hochzeitsreise wollten sie später einmal nachholen. Jetzt hatten sie ihre Ersparnisse für die Wohnungseinrichtung gebraucht, die allerdings ungemein hübsch war, wie Viola schon festgestellt hatte.
»Erst ein richtiges Heim, dann alles andere«, sagte Petra. »Ich habe lange genug bei meinen Eltern gewohnt. Ich möchte endlich mal so leben, wie ich es mir vorstelle.«
Viola lebte noch mit ihren Eltern in einem Haus und ganz, wie sie wollte, konnte sie sich ihr Leben nicht gestalten, aber jetzt war sie ohnehin die meiste Zeit in der Klinik. Ja, ein eigenes Heim hätte sie auch gern, und später auch mal eine eigene Praxis, aber beides musste sie sich erst verdienen. Oft genug wurde ihr von ihren Eltern zu verstehen gegeben, welche Opfer sie für das Studium gebracht hätten.
»Jetzt kommt ja Rolf«, rief Petra aus, die einen Blick zum Fenster hinausgeworfen hatte, als sie einen Wagen gehört hatte.
»Dann werde ich mich verabschieden«, sagte Viola.
*
Das spielte sich in Hohenborn ab, als Mario, so schnell ihn seine Füße tragen konnten, immer weiter in den Wald hineinlief. Er lauschte, ob man ihn rufen würde, aber er hörte nichts. Er hätte sich auch nicht gemeldet, obgleich es ihm hier ein wenig unheimlich war.
Er lief und lief, bis er eine Straße er· reichte. Er bekam kaum noch Luft, so schnell war er gerannt, und er war müde und hätte gar zu gern geschlafen, aber der Boden war so kalt. Ihn fror es, und Hunger hatte er auch.
Hunger und Angst, dass man ihn finden könnte. Er trabte weiter, immer hinter den dichten Büschen entlang, die die Straße säumten. Autos fuhren vorbei und einige Zeit später kam er auch an eine Kreuzung, an der Wegweiser standen. Wenn er doch schon lesen könnte, aber das hatte er noch nicht gelernt.
Er steckte die Hände, die ganz kalt geworden waren, in die Hosentaschen. Noch schien die Sonne, aber sie hatte nicht viel Kraft und wurde immer blasser. Es musste schon dem Abend entgegengehen, und vor der dunklen Nacht fürchtete er sich doch.
Wieder hörte er Motorengeräusch.
Ein Wagen kam aus südlicher, einer aus östlicher Richtung.
Mario setzte sich auf einen Stein und gab sich Mühe, ein unbefangenes Gesicht zu machen, als der Lastwagen hielt, während der Personenwagen weiterfuhr.
Der Mann, der ausstieg, beachtete den Jungen nicht. Er betrachtete den Wegweiser.
»Geradeaus geht es nach Hohenborn«, rief er dem Fahrer zu. »Also weiter, Max.«
Mario rührte sich nicht, als der Mann ihn nun ansah. »Na, Kleiner, was machst du denn hier so allein?«, fragte er.
»Ausruhen«, erwiderte Mario.
»Wohnst wohl in der Nähe?«, fragte der Mann.
Mario nickte.
Der Mann stieg wieder ein, und der Wagen fuhr los. Mario blickte ihm nach. Nun wusste er, in welcher Richtung Hohenborn lag, und so müde er auch war, marschierte er doch weiter.
Einige Zeit später erreichte er ein Gehöft. Hühner gackerten, und ein Hund bellte. Mario schlich sich am Zaun vorbei. Auf einer Wiese sah er eine Scheune stehen. Scheunen kannte er. In Scheunen war Heu, und Heu war weich und warm.
Mario schlief schnell ein und erwachte erst, als der Hahn krähte. Er rieb sich die Augen und blickte sich um. Er glaubte zu träumen und erinnerte sich erst langsam, was er getan hatte.
Bestimmt würden sie ihn schon suchen. Er musste ganz schnell von hier weg, bevor man ihn entdeckte. Und wieder lief er weiter.
*
Schwester Lore hatte sich die bittersten Vorwürfe anhören müssen, aber davon kam Mario auch nicht zurück. Nun wurde nach ihm gesucht, und da er auch bis zum nächsten Morgen nicht gefunden worden war, herrschte große Aufregung. Man befürchtete bereits das Schlimmste.
Niemand hätte es Mario zugetraut, dass er einfach weglief.
Mario war zu der Zeit viel zu erschöpft, als dass er darüber nachdenken konnte, welche Folgen sein Verschwinden hatte.
Er sah die Türme der Stadt, aber sie waren noch viel, viel weiter entfernt, als er geglaubt hatte.
Zuerst kamen noch verstreute Häuser am Straßenrand, und vor einem stand ein Kastenwagen, der mit Säcken beladen war. Da niemand zu sehen war, kletterte er hinauf und versteckte sich zwischen den Säcken, die sich weich anfühlten.
Er dachte jetzt auch nicht mehr daran, ob er nach Hohenborn kommen würde. Er konnte nur nicht mehr laufen, und ihm war ganz übel vor Hunger.
Er hörte, wie Menschen sprachen, aber er konnte nichts verstehen, so tief hatte er sich zwischen die Säcke gehockt. Dann begann der Motor zu brummen, und der Wagen ratterte davon.
Mario wurde tüchtig durchgeschüttelt. Alle Knochen taten ihm weh, als der Wagen hielt, und noch wagte er nicht, sich umzuschauen.
Dann hörte er, wie ein Mann sagte: »Kann mir einer beim Abladen helfen?« Nun würde man ihn bestimmt entdecken, meinte Mario und kroch hervor. Doch augenblicklich war weit und breit niemand zu sehen.
Mario überlegte nicht lange, sondern kletterte herunter, rutschte ab und fiel aufs Knie. Es tat höllisch weh und begann auch gleich zu bluten, aber die Angst vor Entdeckung war schlimmer. Er flitzte über die Straße und versteckte sich in einem Hausgang. Dort lehnte er bebend an der Wand. Eine Frau kam später eine knarrende Treppe herunter. Sie sah ihn und fragte unfreundlich: »Was willst du denn hier?«
»Zu Christel will ich«, erwiderte Mario, unter dem drohenden Blick erbebend.
»Hier gibt es keine Christel«, sagte die Frau. »Bist wohl auch einer von denen, die in fremden Häusern Blödsinn machen. Scher dich weg!«
So unfreundlich und böse konnten also die Menschen sein. Mario fühlte sich sehr unglücklich, dass es dies in der Welt gab, von der er träumte. Er schlich auf die Straße, an den Häusern entlang. Diese waren grau und alt, aber bald kamen hellere, schöne mit Vorgärten. Er hörte Kinderlachen und sah ein kleines Mädchen, das blond war wie Christel.
Aber sie war es nicht, und als er an ihr vorüberging, sah sie ihn an und sagte: »Du bist aber dreckig.«
Nun schämte sich Mario auch noch.
Auf Sauberkeit wurde im Waisenhaus großen Wert gelegt, und wenn er so dreckig zu Christel kam, würde sie ihn auch nicht mehr mögen. Aber wo sollte er Christel denn überhaupt finden? Wen sollte er fragen, wo er hier war? Er wagte es nicht. Er war jetzt nur noch ein verängstigtes Kind.
*
Pfarrer Freriks fuhr gegen zehn Uhr nach Hohenborn. Für elf Uhr war die kirchliche Trauung angesetzt.
Fritzi begleitete ihn. Sie konnte gleich einige Besorgungen machen und später dann wieder mit ihrem Mann zurückfahren.
Wenngleich Holger Frericks nur vertretungsweise in dieser Kirche predigte und das Brautpaar ihm nicht bekannt war, wollte er doch sehen, ob für Blumenschmuck gesorgt war. Das gehörte nun einmal zu einer Trauung.
Es war dafür gesorgt, wenn auch nicht so liebevoll und sorgsam, wie er es von der Kirche in Erlenried gewohnt war. Er rückte die Vasen zurecht und wollte wieder in die Sakristei gehen, als er einen Laut vernahm. Es klang wie das Scharren von Füßen. Sehen konnte er nichts, aber dann vernahm er ein leises Weinen und ging dem Ton nach.
Auf einer Bank lag ein schmutziger kleiner Junge, den Kopf in den Armen vergraben. Holger Frericks hielt den Atem an.
Sanft legte er seine Hand auf die zuckenden Schultern des Kindes.
»Wer bist du denn?«, fragte er leise. Der Kopf ruckte empor. Schreckensvolle Augen blickten ihn an. Fest pressten sich die Lippen des Kindes aufeinander.
»Willst du mir nicht sagen, wer du bist?«, fragte Holger Frericks.
Der Junge schüttelte den Kopf.
»Du kannst nicht hierbleiben«, sagte Holger Frericks. »Hier findet gleich eine Hochzeit statt.«