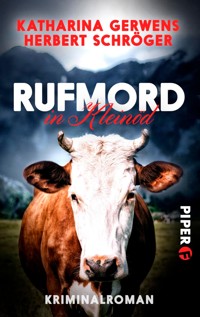1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ist es möglich, zwei Leben miteinander zu tauschen? Von einem Moment auf den anderen versucht eine der Zwillinge Marie und Luise, in das Leben ihrer Schwester einzudringen und überlässt der anderen dafür ihre eigene gescheiterte und prekäre Existenz. Eine Parabel über Identität und Sinnsuche.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 66
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Im Spiegel
Im SpiegelImpressumIm Spiegel
Obwohl Luise schon seit mehr als zehn Jahren in Lüneburg lebte, kannte sie die Ostsee nur aus dem Fernsehen und von Fotos. In ihrer Vorstellung gehörte die Ostsee zu Marie – schließlich war die damals nach Bad Doberan gezogen, quasi abgewandert in ihr eigenes kleines Reich, um ihrer Schwester den Rest der Welt zu überlassen, als seien sie Königinnen, die sich ihre Ländereien aufgeteilt und unsichtbare Grenzen gezogen hatten. Aber vielleicht bildete Luise sich das alles auch nur ein; denn sie hatten nie darüber gesprochen. Sie hatten überhaupt nie wieder miteinander gesprochen. Seit dieser Geschichte. Damals. Erst ganz nah beisammen – dann unendlich weit voneinander entfernt. Irgendjemand hatte mal behauptet, das sei das Gesetz des Lebens. Wenn man einen Ball weit wegwerfen wolle, müsse man ihn auch erst nah an sich heranziehen. Je stärker die Annäherung, umso mehr Kraft für den Wurf.
Der einen, also Marie, gehörte nun das Ostseeufer, der anderen standen alle übrigen Gestade sowie die restlichen Kontinente zu. Fair war die Aufteilung nicht, aber es war Marie, die diese Entscheidung getroffen hatte. Das dachte Luise oft, wenn sie an Hartmuts Seite am Nordseestrand wanderte oder barfüßig durch das Wattenmeer von einer Insel zur anderen marschierte; sobald sie einen Strand vor sich sah, dachte sie an ihre Schwester. Mit dem Gefühl des Mangels und einem Anflug von Schuld. Und immer hatte sie dabei das Bild von Scherben vor Augen. Zwei auseinandergebrochene Leben, die neu gekittet werden mussten. Natürlich wären die Bruchstellen weiterhin sichtbar und spürbar. Narben nannte man das wohl.
Bis vorhin hatten sie gerade mal zweihundert Kilometer voneinander entfernt gewohnt ‒ jedoch in unterschiedlichen Welten, wie auf Planeten, die sich fremd, wenn nicht gar feindlich gesinnt waren. Kompromisslos hatte Marie vor mehr als zehn Jahren die einst unzertrennliche Einheit durch ein höchstmögliches Maß an Distanz ersetzt, als sei das der Weg, um eine Art Gleichgewicht herzustellen, und nun, ebenso gründlich, die von ihr geforderte Distanz wieder aufgehoben.
Ausgerechnet jetzt, da Luise endlich bei sich angekommen war und sich ein eigenes Leben erobert hatte, war Marie gnadenlos in das Reich ihrer Schwester einmarschiert und hatte Luise daraus vertrieben.
„Nimm mein Leben“, hatte sie ihr als Alternative angeboten. „Und mach verdammt noch mal das Beste daraus. Mach es besser als ich.“
Jetzt stand Luise mit dem Gefühl, etwas streng Verbotenes zu tun, auf der gepflasterten Strandpromenade von Kühlungsborn, der längsten Strandpromenade Deutschlands. Allein zwischen Händchen haltenden Liebespaaren und älteren Damen und Herren, die wohlgenährte Hunde Gassi führten. Die Hunde sahen zwar so aus, als würden sie lieber zehn Meter weiter über den Ostseestrand tollen, aber das hochpreisige Schuhwerk ihrer Besitzer ließ derart verwegenen Eskapaden nicht zu und die Liebespaare hatten wie immer nur einander im Blick. Luise dagegen sah auf den Horizont und fragte sich, ob es hinterm Horizont tatsächlich weiterging, wie Udo Lindenberg mal gesungen hatte.
Zitternd, als würde ihr das Unbegreifliche erst jetzt bewusst, ließ sie sich auf eine der weiß lackierten Holzbänke am Rand der Uferpromenade fallen, holte ganz tief Luft und blickte dabei ängstlich um sich.
Alles, was schiefgehen konnte, war in den vergangenen sechs Stunden schiefgegangen. Sie hatte nicht eine Sekunde lang die Chance oder gar die Idee eines Auswegs gehabt, und das erfüllte sie mit einer unerträglichen Bitternis. Warum musste ausgerechnet ihr so etwas passieren?
Die Ostsee leuchtete silbrig-grau und schob geruhsam und rhythmisch ihre Wellen an den Strand. Luise zählte: sechs kleine und dann die größere siebte Welle, die intensiver und vorwitziger als ihre Vorgängerinnen den spätnachmittäglichen Strand eroberte und ihn mit Muschelfragmenten bestückte.
Luise merkte, wie das Meeresrauschen sie beruhigte. Zum ersten Mal seit Lüneburg gelang es ihr, einen klaren Gedanken zu fassen und erst jetzt fragte sie sich, vor was Marie geflohen sein mochte.
Das Meer gab sich gelassen, aber sie, Luise, steckte weiterhin in diesem Alptraum fest, der vor wenigen Stunden begonnen hatte, und der sie seitdem voll im Griff hatte.
Nirgends, dachte sie, waren Sonnenuntergänge so dramatisch, wie am Strand eines Meeres, und sie war froh, dass sie den heutigen nicht bewusst wahrgenommen hatte.
Luise lehnte sich an einen mit einem Vorhängeschloss verriegelten Strandkorb, beobachtete, wie die mit weißen Schaumkrönchen verzierten Wellen das Ufer leckten, schlang sich ihren langen Zopf um den Hals und hielt sich daran fest. Sonst war da ja nun auch nichts mehr, das ihr Halt gab. Nur der eigene alte Zopf. Wäre nicht alles ein so unglaubliches Desaster, könnte man es fast komisch finden. Eine Geschichte, die typischerweise nur ihr passieren konnte, und die dann auch ihr passieren musste!
Diese hübschen und zierlichen Wellen, fast spielerisch rollten sie an den Strand und Luise ertappte sich bei dem Gedanken, wie schön es doch wäre, wenn sie sich als Vorboten eines Tsunamis entpuppten, der dann eine einzige mörderische Flutwelle an den gepflegten Ostseestrand schickte, um allein Luise zu erfassen und mit sich in die Tiefe zu ziehen. Dann wären all ihre Probleme gelöst.
Sie biss sich auf die Lippen und schüttelte über sich selbst den Kopf. Sie sollte die Dinge nicht so dramatisieren! Warum gelang es ihr nicht, die Situation wie ein Spiel zu sehen ‒ eine Art absurden Zeitvertreib? Marie schien es ja auch so zu betrachten.
Hartmut, Luises Mann, hatte ihr den Trick beigebracht, Probleme in Spiele zu verwandeln: das nahm den Dingen ihre Bedeutung und ihr Gewicht und kippte vermeintlich Elementares ins Absurde oder ins Lächerliche ‒ keinesfalls aber in den Abgrund, in den Luise nun vorwarnungslos gestoßen worden war. Und zwar von Marie. Für absurde Aufgaben boten sich naturgemäß ebenso absurde Lösungen an. Aktuell jedoch griff dieses Gedankenspiel nicht, und selbst in seinen wildesten Spekulationen wäre Hartmut niemals auf den gerade stattfindenden Supergau gekommen, auf die Größte Anzunehmende Ungeheuerlichkeit!
Dazu fehlte es ihm an Fantasie.
Als Kinder waren Luise und ihre Schwester unzertrennlich gewesen, und wenn man nach ihnen rief, so rief man Marie-Luise, was für Uneingeweihte so klang, als sei es tatsächlich nur ein einziger Name, mit dem nach nur einem Mädchen gerufen wurde, weshalb Marie auch darauf bestand, dass sie „eins“ waren. Stellte Luise sich mit ihrem Namen vor, so krähte die gleichaltrige Schwester dazwischen: „Das ist nicht wahr, ich bin Luise“, und schon zweifelte Luise an ihrer Existenz, die unausweichlich dann ausgelöscht würde, wenn sie nun auch noch behauptete, sie sei nicht Luise, sondern Marie. Denn dann gäb es nur noch Marie.
Dabei waren und sind sie immer noch Zwei. Zwillingsschwestern, die sich äußerlich bis aufs Haar gleichen und die darin geübt sind, sich in all ihren Gesten zu spiegeln.
Innerlich dagegen hatten sie von Anfang an nur wenig miteinander zu tun.
Luise hatte sich oft damit getröstet, dass sie die Stärkere sei, oder es sein könnte, aber es war Marie, die über das größere Durchsetzungsvermögen, gekoppelt an einen eisernen Willen, verfügte. Das hatte man ja auch jetzt wieder mal gesehen!
Schon als Kind war es immer Marie gewesen, die für sie beide gekämpft hatte. Marie setzte durch, dass es zum Abendbrot keinen Grießpudding, sondern Nudeln mit Tomatensauce gab, Marie diktierte den Eltern, wie der Sonntag zu gestalten war und welche Filme im Fernsehen gesehen wurden. Marie war auch diejenige, die die gemeinsamen Urlaubsziele vorgab ‒ und die Luise in der Schule bei sich abschreiben ließ.
Sobald etwas nicht nach Maries Vorstellung lief, begann sie zu toben und zu schreien, und diese Wutausbrüche waren so legendär, dass alle bereitwillig und in einer Art vorauseilendem Gehorsam ihre Wünsche erfüllten. Gelegentliche Versuche des Widerspruchs oder gar Verbots führten zu Riesenaufständen und Sirenengeheule bei Marie, wobei jeder wusste, dass nach derart nervtötenden Intermezzi ja doch immer genau das gemacht wurde, was Marie wollte. Marie bekam immer ihren Willen, denn nicht eine Sekunde früher beendete sie ihr Geschrei.
Marie gestaltete ihrer beider Leben.
Was Luises Schwester sich in den Kopf setzte, war Programm, und zwar das einzige, das galt
Irgendwann jedoch hatte die Welt fatalerweise damit begonnen, nicht mehr im Sinne Maries mitzumachen. Und Luise gestand sich nun ein, dass sie selbst daran nicht ganz unschuldig gewesen war. Wenn sie sich eines vorzuwerfen hatte, dann das.
Marie-Luise ‒ ständig diese Reihenfolge, immer zuerst der Name der anderen, nicht ein einziges Mal hatten die Eltern und all die anderen eine Luise-Marie herbeigerufen. Immer hatte Luise in der zweiten Reihe gestanden, im Schlagschatten ihrer Schwester, nur weil diese eine Minute vor ihr zur Welt gekommen war.
Selbst nun, da sie sich trotzig und aufmüpfig die Namen umgekehrt dachte, erst Luise und danach Marie, klang es unpassend und ungewohnt. Vergleichbar mit Händen, die man sein Leben lang auf die gleiche Art gefaltet hat ‒ und plötzlich legt man zum allerersten Mal den kleinen Finger der rechten Hand zwischen Ring- und kleinen Finger der Linken ‒ und das fühlte sich dann falsch an, selbst wenn es auf Außenstehende normal wirkte.