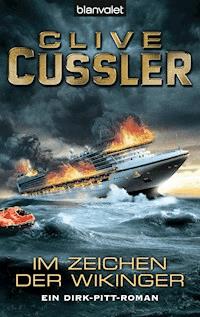
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Dirk-Pitt-Abenteuer
- Sprache: Deutsch
2500 Passagiere genießen die Jungfernfahrt auf der "Emerald Dolphin" im Pazifik, bis das Kreuzfahrtschiff in einem Flammeninferno untergeht. Während Dirk Pitt und seine NUMA Überlebende retten, ist die Ursachenforschung bereits in vollem Gang. Der Verdacht fällt auf das neu entwickelte Antriebssystem. Doch schon bedrohen weitere Katastrophen die Welt. Der Untergang der "Emerald Dolphin" erweist sich als Vorbote einer unfassbaren Verschwörung ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 823
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Clive Cussler
Im Zeichender Wikinger
Roman
Aus dem Amerikanischen von Oswald Olms
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »Valhalla Rising« bei G. P. Putnam’s Sons,Penguin Putnam, Inc., New York.
1. Auflage
Taschenbuchausgabe 4/2004
Copyright © der Originalausgabe 2001 by Clive Cussler, RLLLP
By arrangement with Peter Lampack Agency, Inc.,
551 Fifth Avenue, Suite 1613, New York, NY 10176-0187, U.S.A.
All rights reserved.
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2002
by Blanvalet Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
Titelnummer: 36014
Redaktion: Ilse Wagner
V.B. · Herstellung: Heidrun Nawrot
ISBN 978-3-641-15222-2
www.blanvalet.de
Mein herzlichster Dank giltPenn Stohr, Gloria Farley, Richard DeRosset,Tim Firme, der Firma U.S. Submarines und meinereinheimischen Feuerwehrfür ihre Unterstützung und fachliche Beratung.
Vergangen und vergessen
Juni 1035Irgendwo in Nordamerika
Sie glitten durch den Morgennebel wie Gespenster, lautlos und in schaurig anzuschauenden Geisterschiffen. Hoch und anmutig geschwungen wie ein Schlangenleib, ragten Vor- und Hintersteven auf, gekrönt von kunstvoll geschnitzten Drachenhäuptern mit drohend gefletschten Zähnen, als spähten sie auf der Suche nach Opfern selbst durch den dichtesten Dunst. Angst sollten sie sämtlichen Feinden einjagen, aber die Besatzung glaubte auch, dass die Drachen Schutz vor den bösen Geistern boten, die im Meer hausten.
Über eine grimmige See war die kleine Schar mit ihren langen, schnittigen schwarzen Schiffen gekommen, die elegant wie Bachforellen über die Wellen glitten. Lange Ruder ragten aus den Pforten zu beiden Seiten des Rumpfs, tauchten ins dunkle Wasser und trieben die Schiffe durch die Dünung. Schlaff hingen die rechteckigen, rotweiß gestreiften Segel in der Flaute am Mast. Kleine Klinkerboote, rund fünf Meter lang, in denen zusätzliche Fracht befördert wurde, waren am Heck vertäut.
Sie waren die ersten Einwanderer in diesem Landstrich, Vorläufer all jener, die viel später noch kommen sollten – Männer, Frauen und Kinder mitsamt ihrem Vieh und all ihrer kärglichen Habe. Die gefährlichste aller Routen, auf der die Nordmänner die Meere durchkreuzten, die große Fahrt über den Nordatlantik, hatten sie gemeistert. Ungeachtet aller Schrecken, die sie auf dem weiten, unbekannten Ozean erwarteten, waren sie losgesegelt, hatten Treibeisfelder überwunden und orkanartigen Winden getrotzt, gegen mächtige Wogen gekämpft und heftige Stürme aus Südwest durchgestanden. Die meisten hatten überlebt, doch die See hatte auch ihren Tribut gefordert. Zwei der acht Schiffe, mit denen sie in Norwegen aufgebrochen waren, waren auf Nimmerwiedersehen verschollen.
Nach langer, beschwerlicher Fahrt erreichten die Kolonisten schließlich die Küste von Neufundland. Doch statt bei L’Anse aux Meadows zu landen, dort, wo einst Leif Eriksson eine Siedlung gegründet hatte, wollten sie weiter nach Süden, in wärmere Gefilde vordringen und sich dort niederlassen. Nachdem sie eine riesige Insel umsegelt hatten, steuerten sie in Richtung Südwest und stießen auf eine lange Landzunge, die sich vom Festland aus gen Norden zog. Sie umrundeten zwei flache Inseln und fuhren dann geschlagene zwei Tage an einem weiten Sandstrand vorbei – ein wundersamer Anblick für diese Menschen, die ihr Lebtag lang nur schroffe Felsenküsten gekannt hatten.
Eine weite Bucht tat sich vor ihnen auf, als sie um die äußerste Spitze des endlos langen Sandstreifens segelten. Unverzüglich nutzte die kleine Flotte die einlaufende Flut und fuhr in Richtung Westen, in ruhigere Gewässer. Doch kurz darauf geriet sie in eine Nebelwand, die sich wie eine dumpfe Decke über das Gewässer breitete. Fahl und verschwommen stand die orangefarbene Sonnenscheibe über dem unsichtbaren Horizont. Mit lauten Zurufen beratschlagten die Bootsführer miteinander und verständigten sich schließlich darauf, hier vor Anker zu gehen, bis zum nächsten Morgen abzuwarten und darauf zu hoffen, dass sich der Nebel bis dahin verzogen hatte.
Als der neue Tag anbrach, hing nur mehr ein leichter Dunst über der Bucht, die gen Westen hin zusehends schmäler wurde und in einen Fjord überging, aus dem ein Fluss ins Meer mündete. Die Männer legten die Ruder aus und pullten in die Strömung, während ihre Frauen und Kinder schweigend auf die düsteren Felswände starrten, die am Westufer hoch über den Masten aus dem dünner werdenden Nebel ragten. Unglaublich riesig kamen ihnen die Bäume in dem bewaldeten Hügelland hinter dem Kamm vor. Zwar hatten sie bislang noch keine Menschenseele zu Gesicht bekommen, doch sie nahmen an, dass zwischen den Bäumen Späher verborgen waren. Jedes Mal, wenn sie an Land gegangen waren, um Wasser zu fassen, waren sie von Skrälingarn behelligt worden, wie sie die Eingeborenen dieses fremden Landes nannten, das sie besiedeln wollten. Allzu freundlich waren ihnen diese Skrälingar offenbar nicht gesonnen, denn mehr als einmal schon hatten sie ihre Schiffe mit einem Pfeilhagel eingedeckt.
Bislang hatten sie ihre übliche Kampfeslust bezähmen müssen, hatte ihnen doch Bjarne Sigvatson, der Führer ihrer fahrenden Schar, keinerlei Gegenwehr erlaubt. Er wusste wohl, dass auch andere Kolonisten aus Vinland und Grönland von den Skrälingar angegriffen worden waren, woran die Wikinger schuld waren, die aus purer Mordgier zahlreiche unschuldige Bewohner dieses Landes umgebracht hatten. Auf dieser Fahrt, so hatte Sigvatson gefordert, sollten die Eingeborenen freundlich behandelt werden. Denn seiner Meinung nach hing das Gedeihen der ganzen Kolonie davon ab, dass sie ohne Blutvergießen Handel mit den Einheimischen treiben, von ihnen Pelze und Nahrungsmittel im Tausch gegen billige Waren erwerben konnten. Trotzdem hatte er, im Gegensatz zu Thorfinn Karlsefni und Leif Eriksson, die bei früheren Fahrten von den Skrälingarn vertrieben worden waren, eine Reihe unerschrockener, bis an die Zähne bewaffneter Männer um sich geschart, lauter kampferprobte Norweger, die sich in zahlreichen Schlachten mit ihren Erzfeinden, den Sachsen, bewährt hatten. Krieger, die mit der einen Hand den Speer führten, mit der anderen die Streitaxt, dazu ein Langschwert um die Schulter geschlungen hatten, und die als die besten Kämpfer ihres Zeitalters galten.
Die Flut stieg bis weit in den Fluss hinauf und erleichterte den Ruderern das Vorankommen in der Strömung, die allerdings aufgrund des geringen Gefälles ohnehin nicht allzu stark war. An der Mündung war der Strom nur etwa eine dreiviertel Meile breit gewesen, doch jetzt waren es gut und gerne zwei Meilen von der Felswand im Westen bis zu dem sanft ansteigenden, von üppig grünen Pflanzen überwucherten Ostufer.
Sigvatson, der den Arm um den mit einem großen Drachenkopf verzierten Vorsteven des führenden Schiffes geschlungen hatte und durch den schwindenden Dunst in die Ferne spähte, deutete auf einen schattigen Fleck in den steilen Felsklippen, die hinter der nächsten Biegung aufragten. »Pullt zum linken Ufer«, befahl er den Ruderern. »Dort scheint mir eine Höhle zu sein, in der wir über Nacht Schutz finden können.«
Als sie näher kamen, sahen sie den dunkel drohenden Eingang einer überfluteten Grotte vor sich, der so breit war, dass ein Schiff hindurchpasste. Sigvatson spähte in das Zwielicht und stellte fest, dass sich hinter dem Höhlenschlund eine Fahrrinne befand, die tief in die Felswand hineinführte. Er gebot den anderen Bootsführern Einhalt und ließ den Mast seines Schiffes umlegen, damit es unter dem niedrigen Bogen aus blankem Gestein hindurchgleiten konnte. Die Einfahrt war voller Strudel und Gegenströmungen, doch die erfahrenen Ruderer meisterten sie mühelos, obwohl sie die Riemen ein Stück einziehen mussten, damit sie nicht links und rechts an die Felsen schlugen.
Die Frauen und Kinder beugten sich unterdessen über die Bordwand und starrten in das kristallklare Wasser, auf den blanken Felsengrund gut fünfzehn Ellen tiefer und die Fischschwärme, die sich darüber tummelten. Beklommen musterten sie die hohe Decke der Höhle, in die gut und gern dreimal so viele Wikingerschiffe passten, als ihre kleine Flotte zählte. Zwar waren bereits ihre Vorfahren zum Christentum bekehrt worden, doch noch immer hielten sie an alten heidnischen Bräuchen fest, wonach Grotten und Höhlen Heimstätten der Götter waren.
Die Wände im Innern der Grotte, die rund zweihundert Millionen Jahre zuvor beim Abkühlen von geschmolzenem Vulkangestein aus den umliegenden Bergen entstanden war, waren von den Wellen eines uralten Meeres ausgefräst und glatt geschliffen worden. Weder Moose noch Flechten hingen von der blanken, wie eine Kuppel gewölbten Decke. Erstaunt stellten sie fest, dass es auch keine Fledermäuse gab und dass ein Großteil dieser unterirdischen Kammer trocken war. Das Wasser endete an einem Felssims, der etwa drei Ellen hoch anstieg und sich nahezu zweihundert Schritte weit ins Innere der Grotte erstreckte.
Sigvatson rief den anderen Bootsführern vom Höhleneingang aus zu, dass sie ihm folgen sollten. Dann hoben seine Ruderer die Riemen aus dem Wasser und ließen das Schiff treiben, bis es mit dem Vorsteven gegen die Felskante der inneren Kammer stieß. Während sich die anderen Schiffe dem Landeplatz näherten, wurden lange Laufplanken ausgelegt, woraufhin sich alle eilends auf trockenen Boden begaben, froh darüber, dass sie sich zum ersten Mal seit Tagen die Beine vertreten konnten. Vor allem aber wollten sie endlich wieder eine warme Mahlzeit zu sich nehmen, die Erste, seit sie hunderte von Meilen weiter nördlich an Land gegangen waren. Die Kinder schwärmten in die zahllosen Grotten und Stollen aus, rannten über die Felsbänke, die das Wasser in Äonen von Jahren aus dem Fels geschliffen hatte, und sammelten Treibholz. Bald darauf hatten die Frauen Feuer entzündet, buken Brot, rührten in großen Eisentöpfen Hafergrütze an oder kochten in ihren Kesseln dicke Fischsuppen. Unterdessen besserten die Männer das verschlissene Tauwerk der Schiffe aus, das auf der beschwerlichen Reise zu Schaden gekommen war, während andere im Fjord die Netze auslegten und ganze Schwärme von Fischen fingen. Mittlerweile waren die Frauen heilfroh darüber, dass sie so einen angenehmen Unterschlupf gefunden hatten, in dem sie vor Wind und Wetter geschützt waren. Die Männer indessen, wilde Gesellen mit zerzaustem Haupthaar und struppigen Bärten, waren Seefahrer, die an das Leben unter freiem Himmel gewöhnt waren und sich in diesem engen Felsenloch ganz und gar nicht wohl fühlten.
Als sie gegessen hatten und sich gerade anschickten, über Nacht in ihre ledernen Schlafsäcke zu kriechen, kamen zwei von Sigvatsons Kindern, ein elfjähriger Junge und ein zehnjähriges Mädchen, aufgeregt rufend angerannt. Sie fassten ihn an den Händen und zerrten ihn zur tiefsten Stelle der Grotte. Nachdem sie Fackeln entzündet hatten, führten sie ihn durch einen langen, röhrenartigen Gang, einen runden Höhlenschacht, der einst vom Wasser ausgespült worden war.
Zunächst mussten sie etliche herabgestürzte Felsbrocken überwinden und umgehen, doch dann führte der Weg gut zweihundert Schritte weit steil nach oben. Die Kinder blieben stehen und deuteten auf eine schmale Felsspalte. »Schau, Vater, schau!«, rief das Mädchen. »Dort ist ein Loch, das nach draußen führt. Du kannst die Sterne sehen.«
Sigvatson sah das Loch, doch es war so schmal, dass nicht einmal die Kinder hindurchkriechen konnten; den Sternenhimmel indes konnte aber auch er erkennen. Am nächsten Tag trug er einigen Männern auf, das Geröll und die Felsbrocken aus dem Höhlenschacht zu räumen und den Spalt zu verbreitern, der in die Außenwelt führte. Als dies geschehen und der Durchgang so weit freigehauen war, dass ein Mann aufrecht hindurchgehen konnte, traten sie hinaus auf fruchtbares Wiesenland, das von stattlichen Bäumen gesäumt war. Hier war es nicht öde und kahl wie in Grönland. Hier gab es Holz im Überfluss, aus dem sie sich Häuser bauen konnten. Hier gab es fruchtbaren Boden voller wilder Blumen und fetter Gräser, auf dem sie ihr Vieh weiden konnten. Auf diesem prachtvollen Land hoch über dem blauen Fjord, in dem es Fische im Überfluss gab, wollte Sigvatson seine Siedlung errichten.
Die Götter hatten den Kindern den Weg gewiesen, und diese hatten die Erwachsenen zu ihrem ersehnten Garten Eden geführt.
Die Nordmänner waren ein lebenslustiges Volk. Auch wenn ihr Dasein hart war, voller Mühe, Arbeit und Todesgefahr. Die See war ihr Element, und ein Mann ohne Boot war für sie kein freier Mann. Zwar waren sie das ganze Mittelalter über wegen ihrer Barbarei gefürchtet, zugleich aber veränderten sie das Antlitz Europas. Ihre verwegenen Scharen drangen nach Russland vor, kämpften am Schwarzen Meer und vor den Toren von Konstantinopel, sie siedelten in Spanien und Frankreich, wo sie Handel trieben oder sich als Söldner verdingten, die berühmt waren für ihre Fertigkeiten mit Schwert und Streitaxt. Rollo der Lange, auch der Gånge-Rolf genannt, wurde Herr über die Normandie, die nach den Nordmännern benannt ist. Sein Nachfahre Wilhelm der Eroberer machte sich England untertan.
Bjarne Sigvatson war das Ebenbild des glorreichen Wikingers, blond das Haupthaar, golden der Bart. Er war nicht groß gewachsen, aber breitschultrig und stark wie ein Ochse. Bjarne war im Jahr 980 auf dem Hof seines Vaters in Norwegen zur Welt gekommen, und wie fast alle jungen Wikinger hatte er sich schon von klein auf danach gesehnt, loszusegeln und festzustellen, was hinter dem Horizont lag. Wissbegierig und kühn, wie er war, zugleich aber auch besonnen, nahm er schon mit fünfzehn an Raubzügen in Irland teil. Mit zwanzig Jahren war er ein in zahlreichen Kämpfen erprobter Seeräuber, der so viele Reichtümer erbeutet hatte, dass er sich ein stattliches Schiff bauen und eine eigene Kriegerschar ausrüsten konnte. Er vermählte sich mit Freydis, einer strammen, selbstbewussten Schönheit mit langem goldenem Haar und blauen Augen. Es war eine glückliche Verbindung, passten die beiden doch zusammen wie Sonne und Himmel.
Nachdem er bei seinen Überfällen auf Städte und Dörfer entlang der Küste Britanniens zahlreiche Narben davongetragen, aber auch ein riesiges Vermögen zusammengerafft hatte, gab er die Seeräuberei auf, wurde Kaufmann und handelte mit Bernstein, dem Diamant der damaligen Zeit. Doch nach ein paar Jahren packte ihn wieder die Unruhe, vor allem, als er die Geschichten von den sagenhaften Erkundungsfahrten eines Erik des Roten und dessen Sohn Leif Eriksson hörte. Die fernen Lande weit im Westen lockten, woraufhin er den Entschluss fasste, sich selbst auf große Fahrt ins Unbekannte zu begeben und eine Kolonie zu gründen. Bald darauf stellte er eine zehn Schiffe umfassende Flotte zusammen, die dreihundertfünfzig Mann mitsamt ihren Angehörigen, dem Vieh und landwirtschaftlichem Gerät befördern konnte. Ein Schiff wurde nur mit Bjarnes Reichtümern beladen, dem Bernstein und den erbeuteten Schätzen, die er fortan im Tausch gegen wichtige Waren und Handelsgüter aus Norwegen und Island zu verwenden gedachte.
Die Grotte eignete sich bestens als Bootshaus und Lager, wie auch als feste Burg, falls es zu Angriffen der Skrälingar kommen sollte. Auf Rollen aus zersägten Baumstämmen wurden die schlanken Schiffe aus dem Wasser gezogen und auf Böcken gelagert, die man auf dem Felssims zurechtgehauen hatte. Die Wikinger bauten herrliche Boote, die zu ihrer Zeit als wahre Wunderwerke galten – Schiffe, die nicht nur über hervorragende Segeleigenschaften verfügten, sondern auch die reinsten Kunstwerke waren, großartig geschnitten und an Bug und Heck mit prachtvollen Schnitzereien verziert. Elegante Schiffe, wie es sie zuvor nie gegeben hatte und seither nur selten.
In ganz Europa begaben sie sich auf ihre Raub- und Kriegszüge mit dem Langschiff, das ungemein schnell, vielseitig verwendbar und mit bis zu fünfzig Rudern bestückt war. Das Arbeitspferd der Wikinger hingegen war der Knorr, ein fünfzehn bis zwanzig Meter langer und rund fünf Meter breiter Hochseesegler mit bis zu zehn Rudern für die Fahrt in seichten Küstengewässern, der rund vierzig Tonnen Fracht (die Tonne als Gewichtseinheit geht auf eben jene Holzbehältnisse zurück, in denen die Wikinger ihre Waren wasserdicht verstauten) auch über weite Strecken hinweg befördern konnte.
Vor- und Achterschiff waren mit Planken gedeckt, aber mittschiffs, wo Vieh und Fracht verstaut wurden, war der Knorr offen. Die Besatzung und ihre Begleiter mussten unter freiem Himmel ausharren, nur von einem Zelt aus Ochsenhäuten geschützt. Nicht einmal ein Schiffsführer wie Sigvatson hatte eine eigene Unterkunft, denn auf See waren alle Wikinger gleich, und nur bei wichtigen Entscheidungen hatte der Anführer die Befehlsgewalt. Der Knorr war für die raue See geschaffen und vermochte selbst bei Sturmwind, hohem Wellengang und allen Unbilden, die ihm die Götter sandten, fünf bis sieben Knoten Fahrt zu machen und somit rund hundertfünfzig Meilen am Tag zurückzulegen.
Der Kiel, eine Erfindung der Wikinger, wurde von den großartigen Werftmeistern mittels Augenmaß und von Hand mit Äxten aus einem langen, starken Eichenstamm gefertigt, auf den man Stützbalken und Querträger setzte, die einzigen geraden Bauteile des Schiffs, die dem Rumpf auch bei schwerer See Stabilität verliehen. Danach fügte man die ebenfalls aus Eichenholz zurechtgehauenen Spanten ein, die entlang der Maserung gespalten und anmutig geschwungen waren. Auf diese wurden in so genannter Klinkerbauweise die Planken gesetzt, die sich vom Vor- bis zum Hintersteven zogen und einander von oben nach unten überlappten. Zum Schluss wurde das gesamte Schiff mit einer Mischung aus Holzpech und Tierhaaren kalfatert. Die ganze Konstruktion wirkte allzu zerbrechlich angesichts der Stürme, die über den Nordatlantik fegten, und dennoch handelte es sich um den zuverlässigsten Schiffstyp des Mittelalters. Der Kiel war biegsam, und der Rumpf konnte sich verwinden, sodass der Bootskörper mühelos und mit nur geringem Wasserwiderstand dahinglitt. Und aufgrund seines geringen Tiefgangs vermochte es selbst riesige Wogen abzureiten.
Auch die Ruderanlage war ein Meisterwerk der Schiffsbaukunst. Sie bestand aus einem starken Steuerruder, Stjornbordi genannt, das stets vertikal an der rechten Seite des Achterschiffs angebracht war – woraus sich der Begriff Steuerbord ableitete –, und mittels einer waagerechten Pinne gedreht wurde. Der Rudergänger achtete mit einem Auge auf die See und mit dem anderen auf eine kunstvoll verzierte, bronzene Wetterfahne, die entweder am Vorsteven oder auf dem Mast befestigt war und ihm die Windrichtung anzeigte, sodass er immer den günstigsten Kurs steuern konnte.
Ein wuchtiger Eichenblock diente als Kielschwein, in dem der Mastfuß steckte. Der Mast maß alles in allem fast zehn Meter und trug ein rund hundert Quadratmeter großes, rechteckiges Segel, das etwas breiter als hoch war. Die Segel waren aus grober Wolle gewebt und der Festigkeit halber in zwei Schichten zusammengenäht. Anschließend wurden sie rotweiß eingefärbt, normalerweise mit einem schlichten Streifen- oder Rautenmuster.
Doch die Wikinger waren nicht nur meisterliche Schiffsbauer, sondern auch ausgezeichnete Seefahrer und Navigatoren, die von Geburt an einen sechsten Sinn für die See hatten. Ein Wikinger vermochte sich anhand der Strömungen, der Wolken, der Wassertemperatur, des Windes und der Wellen zu orientieren. Er achtete auf die Fischzüge und den Vogelflug. Bei Nacht steuerte er anhand der Sterne. Tagsüber benutzte er ein Schattenbord, eine Art Sonnenuhr, die aus einer flachen Holzscheibe mit eingekerbten Markierungen und einem Stab in der Mitte bestand, der auf und ab geschoben wurde, sodass sich anhand des Schattens, den er auf die Linien warf, der Stand der Sonne und ihre Abweichung vom Himmelsäquator bestimmen ließ. Die Breitengradschätzungen der Wikinger waren erstaunlich genau. Nur selten kam es vor, dass sich ein Schiff hoffnungslos verirrte. Zu ihrer Zeit waren die Wikinger die uneingeschränkten Herrscher der Meere.
In den darauf folgenden Monaten bauten die Wikinger aus dicken Baumstämmen ihre Langhäuser, deren mit Grassoden gedeckte Dächer von wuchtigen Balken gestützt wurde. Sie errichteten eine große Gemeinschaftshalle mit einer riesigen Herdstatt, in der sie sich zum Kochen und geselligen Beisammensein trafen, die ihnen aber auch als Lagerhaus und Stallung für ihr Vieh diente. Mit Ackerbau verschwendeten die Nordmänner, die sich nach üppigen Ländereien sehnten, keine Zeit. Sie sammelten Beeren und legten im Fjord ihre Netze aus, wo sie Fische im Überfluss fingen. Die Skrälingar waren zwar neugierig, verhielten sich aber einigermaßen friedlich. Sie tauschten mit ihnen Trinkbecher, Kleidungsstücke und Kuhmilch gegen kostbare Pelze und Wildbret. Vorsichtshalber befahl Sigvatson seinen Männern, dass sie ihre eisernen Schwerter, die Äxte und Speere nicht vorzeigen sollten, damit die Skrälingar nicht habgierig wurden, sie stahlen oder im Tauschgeschäft einforderten. Denn die Skrälingar besaßen lediglich Pfeil und Bogen, ihre übrigen Waffen indes waren noch immer aus Stein gefertigt.
Als der Herbst anbrach, stellten sie sich wie immer auf einen harten Winter ein. Doch die Witterung war für die Jahreszeit ungewöhnlich mild; es gab kaum Schnee und nur leichten Frost. Die Siedler genossen die sonnigen Tage, die zudem länger waren, als sie es aus Norwegen und Island gewöhnt waren, wo sie eine Zeit lang überwintert hatten. Sobald der Frühling anbrach, wollte Sigvatson einen großen Spähtrupp aussenden, der das fremde Land erkunden sollte. Er selbst beschloss zurückzubleiben, sich den Pflichten und Aufgaben zu widmen, die ihm die mittlerweile aufblühende Gemeinschaft abverlangte. Sein jüngerer Bruder Magnus sollte an seiner statt den Spähtrupp führen.
Sigvatson wählte hundert Männer für die Fahrt aus, die seiner Meinung nach lang und beschwerlich werden würde. Nach wochenlanger Vorbereitung setzten die sechs leichtesten Boote die Segel, und die zurückbleibenden Männer, Frauen und Kinder winkten der kleinen Flotte ein letztes Mal zu, als sie stromaufwärts auf der Suche nach den Quellen des Flusses davonfuhr. Aus der vermeintlich zwei Monate langen Erkundungsfahrt indessen wurde eine über ein Jahr währende Odyssee. Sie ruderten auf breiten Strömen dahin und segelten über riesige Seen, die ihnen so groß wie das heimische Nordmeer vorkamen, und gelegentlich zogen sie ihre Schiffe auf Baumstämmen über Land, um zur nächsten Wasserstraße zu gelangen. Sie befuhren einen Fluss, der weit mächtiger war als jeder, den sie aus Europa oder dem Mittelmeerraum kannten. Nachdem sie rund dreihundert Meilen auf dieser gewaltigen Wasserstraße flussabwärts gereist waren, gingen sie an Land und lagerten im dichten Wald. Hier deckten sie ihre Boote schließlich mit Zweigen ab und verbargen sie im Unterholz. Dann brachen sie zu einem zwölf Monate währenden Marsch durch sanftes Hügelland und endlose Wiesengründe auf.
Die Nordmänner begegneten seltsamen Tieren, wie sie sie noch nie gesehen hatten. Kleinen, hundeartigen Wesen, die des Nachts heulten, großen Katzen mit kurzen Stummelschwänzen und mächtigen, gehörnten Bestien mit massigem Kopf und dichtem Pelz. Letztere erlegten sie mit ihren Speeren und stellten fest, dass ihr Fleisch so köstlich mundete wie bestes Rind.
Da sie nicht lange an einem Ort verweilten, wurden sie von den Skrälingarn nicht als Gefahr betrachtet und blieben unbehelligt. Erstaunt und belustigt zugleich stellten die Männer des Spähtrupps fest, dass es eine Vielzahl höchst unterschiedlicher Stämme gab. Manche wirkten stolz und edel, andere hingegen kamen ihnen vor wie wilde Tiere.
Viele Monate später brachen sie ihren Marsch ab, als sie in der Ferne die Gipfel eines mächtigen Gebirges aufragen sahen. Tief beeindruckt und voller Ehrfurcht vor dem schier endlos weiten Land, beschlossen sie, dass es an der Zeit sei, den Rückweg anzutreten, wenn sie die Kolonie vor dem ersten Schneefall erreichen wollten. Doch als die erschöpften Fahrensmänner im Mittsommer endlich in der Siedlung eintrafen, erwartete sie statt eines fröhlichen Empfangs nur Tod und Verwüstung. Die ganze Kolonie war niedergebrannt, und von ihren Gefährten, ihren Weibern und Kindern waren nur mehr verstreute Knochen übrig geblieben. Welch schreckliche Misshelligkeiten hatten zu diesem Blutbad geführt? Was hatte die Skrälingar dazu bewogen, den Frieden zu brechen, über die Nordmänner herzufallen und sie abzuschlachten? Die Toten konnten ihnen keine Antwort darauf geben.
Magnus und seine erzürnten und trauernden Gefährten stellten fest, dass der Zugang zur Grotte, in der die Schiffe lagerten, von den toten Siedlern mit Felsen und Zweigen abgedeckt worden war, damit ihn die Skrälingar nicht fanden. Irgendwie war es ihnen anscheinend gelungen, ihre kostbarste Habe sowie die Schätze und liturgischen Geräte, die Sigvatson in jungen Jahren auf seinen Raubzügen erbeutet hatte, während des Angriffs auf den Schiffen zu verstauen und vor den Skrälingar zu verbergen.
Die leidgeprüften Krieger hätten dieser Stätte einfach den Rücken zukehren und lossegeln können, doch das war nicht ihre Art. Sie gierten nach Rache, obwohl sie wussten, dass sie dabei höchstwahrscheinlich sterben würden. Doch im Kampf mit dem Feind zu fallen war für einen Wikinger ein ruhmreicher und den Göttern wohlgefälliger Tod. Zudem schreckte sie der Gedanke, dass ihre Weiber und Töchter von den Skrälingarn womöglich als Sklavinnen davongeführt worden waren.
Außer sich vor Kummer und Wut sammelten sie die sterblichen Überreste ihrer Freunde und Verwandten ein, trugen sie durch den Stollen in die Grotte und legten sie in die Schiffe, wie es bei ihnen Brauch war, auf dass die Toten ins Jenseits, ins gepriesene Walhall, fahren konnten. Sie fanden auch den verstümmelten Leichnam von Bjarne Sigvatson, hüllten ihn in einen Mantel, betteten ihn mitsamt den Gebeinen seiner beiden Kinder auf sein Schiff und gaben ihm seine Schätze sowie etliche Körbe mit Nahrungsmitteln für die große Reise mit. Gern hätten sie ihm seine Gemahlin Freydis zur Seite gelegt, doch ihren Leichnam suchten sie vergebens. Und auch ein Tieropfer konnten sie ihm nicht darbringen, denn die Skrälingar hatten alles Vieh davongetrieben.
In ihrer Heimat war es üblich, dass man die Schiffe mitsamt der Toten der Erde übergab, doch das war hier nicht möglich, denn sie befürchteten, dass die Skrälingar die Verblichenen ausgraben und plündern könnten. Deshalb schlugen sie mit Hämmern und Meißeln auf den mächtigen Fels über dem Eingang zur Grotte ein, bis er zersprang und in einer Lawine aus lauter kleinen Blöcken in den Fluss stürzte, sodass die Höhle von Tonnen schweren Gesteinsbrocken verschüttet wurde. Nur unter Wasser blieb ein weiter Spalt offen.
Nachdem die Bestattungsfeierlichkeiten abgeschlossen waren, rüsteten sich die Nordmänner zum Gefecht.
Mut und Mannesehre galten bei ihnen als Tugenden, die den Göttern wohlgefällig waren, und das Wissen darum, dass sie bald in die Schlacht ziehen würden, erfüllte sie mit freudiger Erregung. Denn tief im Herzen hatten sie sich nach dem Kampf gesehnt, dem Klirren der Waffen und dem Geruch nach frisch vergossenem Blut. Auch dies gehörte zu ihrem Brauchtum, waren sie doch von ihren Vätern von klein auf zu Kriegern erzogen worden, zu Meistern in der Kunst des Tötens. Sie schärften ihre langen Schwerter und Streitäxte, die von deutschen Handwerkern aus bestem Stahl geschmiedet worden waren – kostbare und hoch geschätzte Waffen, die sie in Ehren hielten und denen sie Namen gaben, als wären es Wesen aus Fleisch und Blut.
Sie legten ihre prachtvollen Kettenhemden an, die den Oberkörper schützten, und setzten ihre schlichten Rundhelme auf, die manchmal ein Nasenteil besaßen, nie aber mit Hörnern verziert waren. Dann ergriffen sie ihre aus Holz gefertigten und in leuchtenden Farben bemalten Schilde, die vorn mit einem wuchtigen Eisenbuckel bestückt waren und mit den auf der Rückseite angebrachten Armriemen gehalten wurden. Alle Männer führten Speere mit langen, scharfen Spitzen mit. Dazu trugen manche breite, zweischneidige Schwerter, die rund einen Meter lang waren, während andere der schweren Streitaxt den Vorzug gaben.
Als sie bereit waren, führte Magnus Sigvatson die hundert Mann starke Wikingerschar zum Dorf der Skrälingar, das etwa drei Meilen vom Schauplatz des schrecklichen Massakers entfernt lag. Eigentlich war es eher eine primitive Stadt als eine Ortschaft, bestand sie doch aus hunderten von Hütten, in denen nahezu zweitausend Skrälingar hausten. Die Wikinger machten keinerlei Anstalten, sich heimlich anzuschleichen und den Feind zu überlisten. Unter wahnwitzigem Kriegsgeschrei stürmten sie aus dem Wald und brachen durch den niedrigen Palisadenzaun, der eher zum Schutz vor wilden Tieren diente als vor feindlichen Angriffen.
Voller Ingrimm fielen die Nordmänner über die verdutzten Skrälingar her, mähten sie nieder wie Strohgarben und richteten ein verheerendes Blutbad an. Fast zweihundert wurden beim ersten Ansturm abgeschlachtet, ehe sie begriffen, wie ihnen geschah. Rasch aber rotteten sie sich zu kleinen Trupps zusammen, fünf bis zehn Mann stark, und leisteten ersten Widerstand. Zwar kannten auch sie den Speer und wussten die steinerne Streitaxt zu führen, doch ihre Lieblingswaffen waren Pfeil und Bogen, und damit nahmen sie die Wikinger unter Beschuss. Dann warfen sich die Weiber in die Schlacht und ließen einen Steinhagel auf die Nordmänner niederprasseln, der aber gegen deren Brünnen, Helme und Schilde wenig auszurichten vermochte.
Magnus, der an der Spitze seiner Krieger kämpfte, führte mit der einen Hand den Speer und mit der anderen die schwere Streitaxt, beide triefend rot vor Blut. Er benahm sich wie ein Beserkr – ein Ausdruck, der sich über die Jahrhunderte hinweg in unserem »Berserker« erhalten hat –, wie die Wikinger einen Mann nannten, der dem Kampfesrausch verfallen war und Furcht und Schrecken unter seinen Feinden verbreitete. Mit aberwitzigem Geschrei warf er sich auf die Skrälingar und streckte sie mit mächtigen Axthieben nieder.
Diese wiederum waren von dem wilden Ansturm entsetzt. Zumal sie mitansehen mussten, wie diejenigen, die zum Nahkampf gegen die Nordmänner antraten, unter schrecklichen Verlusten zurückgeschlagen wurden. Doch obwohl sie zu Dutzenden fielen, ließ ihre Gegenwehr nicht nach. Läufer wurden in die umliegenden Dörfer ausgeschickt und kehrten mit Verstärkung zurück, woraufhin die Skrälingar zurückwichen, ihre Reihen wieder schlossen und sich ihrerseits zum Kampf formierten.
Binnen einer Stunde hatte sich die Schar der Rächer eine blutige Bahn durch das Dorf gehauen, doch die Suche nach den vermissten Frauen blieb vergebens. Nur ein paar Kleiderfetzen fanden sie, mit denen sich die eine oder andere Skrälingarfrau geschmückt hatte. Die Wikinger wussten nicht, dass den fünf Frauen, die das Massaker in der Siedlung überlebt hatten, keinerlei Leid geschehen war, dass man sie nur den Häuptlingen der umliegenden Dörfer zum Geschenk dargebracht hatte. Sie waren außer sich vor Wut und hellem Zorn, weil sie meinten, ihre Weiber wären verzehrt worden, und fielen über die Skrälingar her, bis das ganze Dorf regelrecht in Blut getränkt war. Doch die Skrälingar wurden immer mehr, und allmählich wendete sich das Blatt.
Die Wikinger, mittlerweile hoffnungslos unterlegen, vom Kampf erschöpft und durch zahlreiche Wunden geschwächt, wurden einer nach dem andern niedergestreckt, bis sich nur mehr zehn Mann um Magnus Sigvatson scharten. Die Skrälingar warfen sich jetzt nicht mehr den tödlichen Schwertern und Äxten entgegen. Und auch die gefürchteten Speere der Nordmänner konnten sie nicht mehr schrecken, denn die waren längst zersplittert oder geworfen. Sie sammelten ihre Heerscharen, die immer stärker wurden, bis auf einen Wikinger fünfzig der ihren kamen, blieben außer Reichweite und schossen einen Pfeilhagel nach dem anderen auf das kleine Häufchen Überlebender ab, das sich unter seine Schilde duckte, die bald dicht an dicht mit Geschossen gespickt waren. Dennoch setzten sich die Wikinger weiter zur Wehr und griffen ein ums andere Mal an.
Dann warfen sich die Skrälingar mit vereinten Kräften auf die Nordmänner, rannten wider ihre Schilde an, umzingelten sie und drangen von allen Seiten auf sie ein. Nur wenige waren es noch, die, Rücken an Rücken stehend, bis zum bitteren Ende ausharrten, zahllose Schläge mit Steinäxten einsteckten, bis auch der letzte Widerstand erlosch.
Mannhaft gingen sie zugrunde, Schwert und Axt in der Hand, in Gedanken bei ihren Liebsten, die sie verloren hatten und mit denen sie nach einem ruhmreichen Tod ein Wiedersehen erwartete. Magnus Sigvatson fiel als Letzter, und sein Tod war am folgenschwersten, denn mit ihm starb für die nächsten fünfhundert Jahre auch jegliche Hoffnung auf eine Besiedelung Nordamerikas. Zugleich hinterließ er ein Vermächtnis, das jene, die ihm schließlich nachfolgten, teuer zu stehen kommen sollte. Ehe die Sonne unterging, waren sämtliche Nordmänner niedergestreckt, doch sie hatten auch über tausend Männer, Frauen und Kinder der Skrälingar hingemetzelt, die so auf grausame Art erfahren mussten, dass die weißhäutigen Fremdlinge, die über das Meer kamen, eine tödliche Gefahr darstellten, der man mit aller Gewalt begegnen musste.
Helles Entsetzen machte sich unter den Skrälingarvölkern ringsum breit. Bei keiner Stammesfehde hatten sie je einen derart grauenhaften Blutzoll zahlen müssen, so viele fürchterliche Wunden und Verstümmelungen erlitten. Doch die große Schlacht, als die sie in ihre Legenden einging, war nur ein erster Vorgeschmack auf all die grausamen Kriege, die noch folgen sollten.
Den Wikingern, die auf Grönland, Island und in Norwegen lebten, blieb das Schicksal ihrer Gefährten ein ewiges Rätsel. Niemand hatte überlebt, um ihre Geschichte zu erzählen, und nach ihnen brach keine weitere Schar mehr zur großen Fahrt über die tückische See auf. Die Kolonisten wurden nur beiläufig in den Sagas erwähnt, die aus alter Zeit überliefert wurden, und gerieten schließlich gänzlich in Vergessenheit.
Ein Monsteraus der Tiefe
2. Februar 1894Karibisches Meer
Niemand an Bord der Kearsarge konnte die Katastrophe vorhersehen, die das alte Kriegsschiff mit seinem noch aus Holz gebauten Rumpf ereilen sollte. Es war in der Karibik eingesetzt, wo es Flagge zeigen und die politischen und wirtschaftlichen Interessen der Vereinigten Staaten sichern sollte, und befand sich gerade auf der Fahrt von Haiti nach Nicaragua, als der Ausguck etwa eine Meile steuerbord voraus einen absonderlichen Schatten entdeckte. Bei klarem Himmel und ruhiger See mit allenfalls einem halben Meter hohen Wellen herrschte rundum freie Sicht bis zum Horizont. Der schwarze Buckelleib, der wie der Höcker eines unbekannten Meeresungeheuers aus dem Wasser ragte, war mit bloßem Auge zu erkennen.
»Was halten Sie davon?«, fragte Captain Leigh Hunt seinen ersten Offizier, Lieutenant James Ellis, während er durch seinen Messingfeldstecher starrte.
Ellis spähte durch das Teleskop, das er auf die Reling gestützt hatte. »Ich habe es erst für einen Wal gehalten, aber ich habe noch nie einen gesehen, der so stetig seine Bahn durchs Wasser zieht, ohne die Fluke zu zeigen oder abzutauchen. Außerdem ragt kurz vor der Mitte ein sonderbarer Höcker auf.«
»Es muss irgendeine seltene Seeschlange sein«, sagte Hunt.
»Meiner Meinung nach ist das kein Tier«, murmelte Ellis versonnen.
»Aber das kann doch kein Werk von Menschenhand sein.«
Hunt war ein schlanker Mann mit ergrauendem Haar, wettergegerbtem Gesicht und tief liegenden Augen, dem man ansah, dass er viele lange Stunden in Wind und praller Sonne zugebracht hatte. Wie üblich hatte er eine Pfeife im Mund stecken, die er nur selten anzündete. Er war ein erfahrener Marineoffizier, der seit gut einem Vierteljahrhundert zur See fuhr und seine Tüchtigkeit ein ums andere Mal unter Beweis gestellt hatte. Am Bürgerkrieg hatte er nicht teilgenommen, weil er seinerzeit noch zu jung war und erst 1869 die Marineakademie abgeschlossen hatte, aber seither hatte er auf insgesamt achtzehn Kriegsschiffen gedient und war zu immer höherem Rang aufgestiegen, bis man ihn kurz vor der Pensionierung mit dem Kommando über die Kearsarge betraut hatte, dem ruhmreichsten Schiff der US-Navy.
Das altehrwürdige Schiff war dreißig Jahre zuvor, mitten im amerikanischen Bürgerkrieg, durch eine große Seeschlacht berühmt geworden, als es vor der französischen Hafenstadt Cherbourg die Alabama versenkt hatte, den berüchtigsten Kaperfahrer der Konföderation. Obwohl beide Schiffe einander ebenbürtig waren, hatte die Kearsarge die Alabama seinerzeit in einem knapp einstündigen Gefecht regelrecht zusammengeschossen. Bei der Rückkehr in den Heimathafen waren ihr Kapitän und die Besatzung in den Nordstaaten wie Helden gefeiert worden, denen die Union ihr ganzes Heil verdankte.
In den Jahren danach war sie rund um die Welt gefahren. Sie war sechzig Meter lang, zehn Meter breit, hatte rund viereinhalb Meter Tiefgang und konnte, von zwei Dampfmaschinen und einer Schraube getrieben, mit elf Knoten durch das Wasser pflügen. Ihre Kanonen waren zehn Jahre nach dem Bürgerkrieg ausgetauscht worden und bestanden jetzt aus einer Batterie von zwei schweren Geschützen mit elf Zoll starkem, glattem Lauf, vier ebenfalls glatten Neunzöllern und zwei Zwanzigpfündern mit gezogenem Lauf. Ihre Besatzung war hundertsechzig Mann stark. Trotz ihres Alters konnte das Schiff noch gewaltig austeilen.
Ellis setzte das Teleskop ab und wandte sich an Hunt. »Wollen wir uns das mal näher ansehen, Sir?«
Hunt nickte. »Lassen Sie den Rudergänger zehn Grad nach Steuerbord beidrehen. Sorgen Sie dafür, dass Chefmaschinist Gribble volle Fahrt voraus macht, sehen Sie zu, dass sich alle Mann auf Gefechtsstation begeben, und schicken Sie einen weiteren Ausguck hoch. Ich möchte nicht, dass wir dieses Monstrum aus den Augen verlieren.«
»Aye, Sir.« Ellis, ein hoch aufgeschossener Mann mit schütter werdendem Haar und einem mächtigen, aber tadellos gestutzten Bart gab seine Befehle weiter, und bald darauf spritzte weiße Gischt vom Bug auf, als die Kearsarge gegen den Wind drehte und mit schneller Fahrt durch die Wogen schnitt. Dicker, mit feurigen Funken durchsetzter, schwarzer Qualm stieg aus ihrem Schornstein auf. Die Decksplanken bebten, als fieberte das alte Kriegsschiff förmlich vor Vorfreude, als es die Jagd aufnahm.
Kurz darauf näherte sich die Kearsarge dem Fremdling, der seine Geschwindigkeit unverändert beibehielt. Die Bedienungsmannschaft eines Zwanzigpfünders versammelte sich um die Kanone, rammte die Treibladung und das Geschoss in den gezogenen Lauf und trat zurück. Der Artillerieoffizier blickte zu Hunt, der neben dem Rudergänger stand.
»Kanone Nummer zwo geladen und feuerbereit, Sir.«
»Setzen Sie den Schuss fünfzig Meter vor die Nase des Monstrums, Mister Merryman!«, rief Hunt durch sein Megafon.
Merryman winkte zur Bestätigung mit einer Hand, nickte erst dem Kanonier zu, der mit der Abzugsleine in der Hand bereitstand, und dann dem Richtschützen, der die Rohrerhöhungsschraube am Verschlussstück einstellte. »Ihr habt den Käpt’n gehört. Setzt einen Schuss fünfzig Meter vor das Biest.«
Das Rohr wurde ausgerichtet, die Abzugsleine gezogen, woraufhin das schwere Geschütz losbrüllte und zurückschnellte, bis es von dem dicken Anhaltetau, das durch eine Öse an der Rückseite der Lafette gezogen war, gebremst wurde. Es war ein fast zielgenauer Schuss. Direkt vor dem mächtigen Buckel, der scheinbar mühelos durch die Fluten glitt, schoss eine Fontäne hoch, als die Granate aufs Wasser schlug. Doch der Fremdling, sei es ein Tier oder Menschenwerk, behielt unbeirrt seine Geschwindigkeit bei und änderte seinen Kurs nicht im Geringsten.
»Unsere Schießkunst scheint es nicht weiter zu beeindrucken«, sagte Ellis mit einem knappen Grinsen.
Hunt blickte durch sein Fernglas. »Meiner Schätzung nach läuft es mit etwa zehn Knoten, während wir zwölf machen.«
»In zehn Minuten sollten wir längsseits sein.«
»Geben Sie einen weiteren Schuss ab, wenn wir bis auf dreihundert Meter aufgeschlossen haben. Setzen Sie ihn diesmal dreißig Meter vor das Ziel.«
Bis auf die Mannschaft des Maschinenraums standen sämtliche Besatzungsmitglieder an der Reling und starrten auf das Monster vor ihnen, das mit jeder Minute näher kam. Das Wasser rundum war nur leicht gekräuselt, doch es zog eine weiße, wie von einer Schraube aufgewirbelte Schaumspur hinter sich her. Und plötzlich blinkte und glitzerte der aufragende Höcker.
»Wenn ich’s nicht besser wüsste«, sagte Hunt, »würde ich meinen, die Sonne spiegelt sich auf einer Art Fenster oder Bullauge.«
»Meeresungeheuer mit verglasten Fenstern gibt’s bestimmt nicht«, murmelte Ellis.
Die Bedienungsmannschaft lud die Kanone nach und feuerte ein weiteres Geschoss ab, das etwa fünfzehn bis zwanzig Meter vor dem Monster in einer hohen Fontäne im Wasser aufschlug. Nichts tat sich. Es folgte weiter seinem Kurs, als wäre die Kearsarge nur ein lästiger Plagegeist, den es jederzeit wieder loswerden konnte. Mittlerweile war es so nah, dass Captain Hunt und seine Besatzung den sechseckigen Aufbau mit den großen, runden Quarzbullaugen erkennen konnten, der auf dem Monster saß.
»Es ist ein Werk von Menschenhand«, stieß Hunt fassungslos aus.
»Das kann doch nicht sein«, erwiderte Ellis versonnen. »Wer sollte denn so einen Apparat bauen können?«
»Wenn es die Vereinigten Staaten nicht waren, dann vielleicht die Briten oder die Deutschen.«
»Wer weiß? Es führt keine Flagge.«
Plötzlich glitt das sonderbare Wasserfahrzeug vor ihren Augen unter die Wogen, tauchte ab und war verschwunden. Die Kearsarge fuhr genau über die Stelle, an der es versunken war, doch es war nirgendwo zu sehen, so sehr die Besatzung auch in die Tiefe starrte.
»Es ist weg, Käpt’n!«, rief einer der Seeleute Hunt zu.
»Haltet gut Ausschau!«, schrie Hunt zurück. »Ein paar Männer in die Takelage. Von dort oben sieht man mehr.«
»Was machen wir, wenn es wieder auftaucht?«, fragte Ellis.
»Wenn es nicht beidreht und sich zu erkennen gibt, verpassen wir ihm eine Breitseite.«
Stunde um Stunde kreuzte die Kearsarge in immer weiteren Kreisen um das Suchgebiet, bis bei Sonnenuntergang auch die letzte Hoffnung schwand, dass man das sonderbare Monstrum finden würde. Captain Hunt wollte die Jagd bereits abblasen, als sich ein Ausguck oben in der Takelage meldete.
»Monstrum rund tausend Meter backbord voraus. Hält auf uns zu.«
Die Offiziere und Mannschaften stürzten zur Backbordreling und spähten über das Wasser. Noch war es so hell, dass klare Sicht herrschte. Allem Anschein nach kam das sonderbare Ding mit hoher Geschwindigkeit genau auf die Kearsarge zu.
Während der Suche hatten die Bedienungsmannschaften geduldig neben ihren feuerbereiten Vorderladern ausgeharrt. Nun fuhren die Kanoniere an Backbord flugs die Geschütze aus und richteten sie auf den nahenden Gegner. »Zielt auf den Buckel hinter dem Bug, aber bedenkt dabei ihre Fahrt«, wies Merryman sie an.
Die Kanonen wurden ausgerichtet, die Mündungen tiefer gestellt, bis das Monster im Visier auftauchte. »Feuer!«, rief Hunt.
Sechs der insgesamt acht Kanonen der Kearsarge brüllten auf, spien Funken und dichten Qualm aus ihren Mündungen. Hunt verfolgte durch sein Fernglas, wie die Geschosse der schweren, elfzölligen Drehbassen zu beiden Seiten des rätselhaften Bootes im Wasser einschlugen, und wie die Neunzöller mit glattem Lauf hohe Fontänen rund um das Ziel aufwarfen. Dann sah er, wie die Granate des Zwölfpfünders mit gezogenem Lauf den Rücken des Monsters traf, abprallte und wie ein Kieselstein über das Wasser tanzte.
»Es ist gepanzert«, sagte er verdutzt. »Unser Schuss ist vom Rumpf abgeprallt, ohne ihm eine Delle zuzufügen.«
Unbeirrt hielt ihr Widersacher weiter auf sie zu, hatte den Bug mitschiffs auf den Rumpf der Kearsarge gerichtet und wurde zusehends schneller, als wollte er Schwung holen, bevor er zum Rammstoß ansetzte.
Die Bedienungsmannschaften luden fieberhaft nach, doch als sie bereit zur nächsten Breitseite waren, war das Ding bereits so nahe, dass sie die Läufe ihrer Kanonen nicht tief genug absenken konnten, um es zu treffen. Die Marinesoldaten an Bord eröffneten mit ihren Gewehren das Feuer auf den Angreifer. Etliche Offiziere stiegen auf die Reling, hielten sich mit einer Hand an den Wanten fest und schossen mit der anderen ihre Revolver ab. Doch der Kugelhagel prallte wirkungslos vom gepanzerten Rumpf ab.
Ungläubig starrten Hunt und seine Besatzung auf das zigarrenförmige Boot, das sich anschickte, das Schiff zu rammen. Wie von einem Albtraum gelähmt, umklammerten sie die Reling und wappneten sich für den unvermeidlichen Zusammenprall.
Doch der erwartete Stoß kam nicht. Nur ein leichtes Beben ging durch das Schiff, so als schlage es an einen Kai, begleitet vom dumpfen Knirschen berstenden Holzes, als sich das unheimliche Ding so glatt wie das Messer eines Mörders zwischen den mächtigen Eichenspanten hindurch in die Kearsarge bohrte und unmittelbar hinter dem Maschinenraum ein tiefes Loch in den Rumpf riss.
Hunt keuchte erschrocken auf. Durch die großen Bullaugen des sechseckigen Aufbaus konnte er das Gesicht eines bärtigen Mannes erkennen, dessen Miene bekümmert, geradezu bedrückt wirkte, so als bedaure er das Unglück, das sein absonderliches Rammboot herbeiführte.
Dann setzte das geheimnisvolle Wasserfahrzeug rasch zurück und verschwand in der Tiefe.
Hunt wusste, dass die Kearsarge dem Untergang geweiht war. Rund zwei Meter unter der Wasserlinie klaffte ein fast kreisrundes Loch im Rumpf, durch das immer mehr Wasser in den hinteren Laderaum und die Kombüse eindrang, infolgedessen das Schiff deutlich nach Backbord krängte. Nur die Schotten, die Hunt den Vorschriften der Marineführung entsprechend hatte schließen lassen, als ob das Schiff in die Schlacht zöge, verhinderten, dass es auf der Stelle kenterte. Noch hielt sich der Wassereinbruch in Grenzen, aber nur so lange, bis die Schotten unter dem gewaltigen Druck nachgaben.
Hunt fuhr herum und musterte die flache Koralleninsel, die keine zwei Meilen weit entfernt war. Er wandte sich an den Rudergänger und rief: »Halten Sie Kurs auf das Riff steuerbord voraus!« Dann befahl er den Maschinisten, volle Kraft zu geben. Er sorgte sich vor allem darum, wie lange die Schotten dem Wasser standhielten, ehe die Fluten in den Maschinenraum einbrachen. Denn so lange die Kessel noch unter Druck standen, konnte er das Schiff vielleicht auf Grund setzen, bevor es sank.
Allmählich schwang der Bug herum, und das Schiff nahm Fahrt auf und steuerte seichtes Gewässer an. Lieutenant Ellis ließ unterdessen die Boote und die Gig des Kapitäns zum Aussetzen bereitmachen, ohne dass Hunt es ihm eigens befehlen musste. Bis auf die Mannschaft des Maschinenraums war die gesamte Besatzung an Bord angetreten und starrte auf das flache, öde Korallenriff, das quälend langsam näher kam, während die Heizer fieber-haft Kohlen in die Feuertüren der Kessel schaufelten, ein Auge auf die offene Gräting gerichtet, das andere auf das knarrende Schott, das Einzige, das sie noch vor einem schrecklichen Tod bewahrte.
Die Schraube wirbelte das Wasser auf und trieb das Schiff auf das Eiland zu, von dem sich alle Rettung erhofften. Der Rudergänger rief nach einem Helfer, denn durch das eindringende Wasser neigte sich das Schiff mittlerweile bereits sechs Grad nach Backbord und ließ sich immer schwerer steuern.
Die Besatzung stand bei den Booten, bereit, sie auf Hunts Befehl hin zu besteigen und das sinkende Schiff zu verlassen. Unruhig traten sie von einem Bein aufs andere, als sich das Deck bedrohlich unter ihren Füßen neigte. Ein Lotgast wurde zum Bug geschickt, wo er das Senkblei auswarf und die Wassertiefe erkundete.
»Zwanzig Faden und steigend«, sang er mit kaum verhohlener Zuversicht.
Doch der Boden musste noch gut dreißig Meter seichter ansteigen, ehe der Kiel der Kearsarge auf Grund stieß. Und Hunt kam es vor, als ob sich das Schiff im Schneckentempo auf das kleine Koralleneiland zubewegte.
Von Minute zu Minute sank die Kearsarge tiefer ins Wasser. Sie hatte jetzt nahezu zehn Grad Schlagseite und ließ sich kaum noch auf geradem Kurs halten. Doch das Riff kam näher. Sie konnten bereits die Wellen sehen, die an die Korallen brandeten und gleißend in der Sonne versprühten.
»Fünf Faden«, sang der Lotgast, »und rasch steigend.«
Hunt dachte nicht daran, das Leben seiner Männer aufs Spiel zu setzen. Er wollte gerade den Befehl zum Verlassen des Schiffes geben, als die Kearsarge auf die Korallen auflief, mit ihrem Kiel und Rumpf durch das Riff pflügte, bis sie jäh zum Stillstand kam, sich zur Seite neigte und mit fünfzehn Grad Schlagseite liegen blieb.
»Gelobt sei der Herr, wir sind gerettet«, murmelte der Rudergänger, der noch immer die Speichen des Rades umklammerte, obwohl seine Arme vor Erschöpfung wie taub waren und sein Gesicht vor Anstrengung rot angelaufen war.
»Sie sitzt fest«, sagte Ellis zu Hunt. »Außerdem ist Ebbe, sodass sich das alte Mädchen nicht von der Stelle bewegen wird.«
»Stimmt«, bestätigte Hunt bitter. »Wäre ein Jammer, wenn man sie nicht retten könnte.«
»Mit Bergungsschleppern kann man sie vielleicht vom Riff freibekommen, vorausgesetzt, der Boden ist nicht aufgerissen.«
»Das verdammte Monstrum ist daran schuld. Wenn es einen Gott gibt, wird er es dafür büßen lassen.«
»Vielleicht hat es das bereits«, erwiderte Ellis leise. »Nach dem Zusammenstoß ist es ziemlich rasch gesunken. Es muss sich den Bug beschädigt und Wasser genommen haben.«
»Ich frage mich nur, weshalb der Kapitän nicht einfach beigedreht und erklärt hat, was er hier treibt.«
Ellis blickte nachdenklich über das türkisfarbene Wasser der Karibik. »Ich meine mich zu erinnern, dass ich einmal etwas über eine rund dreißig Jahre zurückliegende Begegnung eines unserer Kriegsschiffe, der Abraham Lincoln, mit einem rätselhaften Metallmonster gelesen habe. Es hat ihr das Ruder abgerissen.«
»Wo war das?«, fragte Hunt.
»Ich glaube, es war im Japanischen Meer. Außerdem sind in den letzten zwanzig Jahren mindestens vier britische Kriegsschiffe unter rätselhaften Umständen verschollen.«
»Die Marineführung wird uns nie und nimmer glauben, was hier vorgefallen ist«, sagte Hunt, während er sich zusehends wütender auf seinem gestrandeten Schiff umblickte. »Ich werde mich glücklich schätzen dürfen, wenn ich nicht vor ein Kriegsgericht gestellt und unehrenhaft aus dem Dienst entlassen werde.«
»Es gibt hundertsechzig Zeugen, die Ihre Aussage bestätigen können«, versicherte ihm Ellis.
»Kein Kapitän möchte sein Schiff verlieren, und schon gar nicht durch ein unbekanntes mechanisches Monstrum.« Er hielt inne, blickte hinab in die See und widmete sich dann den anstehenden Pflichten. »Lassen Sie die Vorräte in die Boote laden. Wir gehen an Land und warten dort ab, bis wir gerettet werden.«
»Ich habe die Karten studiert, Sir. Wir befinden uns vor dem Roncador-Riff.«
»Ein erbärmlicher Ort. Und ein erbärmliches Ende für so ein ruhmreiches Schiff«, erwiderte Hunt wehmütig.
Ellis salutierte kurz und formlos und wies dann die Besatzung an, Lebensmittel, Segeltuch für Zelte und persönliche Habseligkeiten auf das flache Koralleneiland zu schaffen. Im Schein des Halbmondes arbeiteten die Männer die ganze Nacht hindurch bis in die Morgenstunden, schlugen ein Lager auf und kochten schließlich die erste Mahlzeit an Land.
Hunt verließ die Kearsarge als Letzter. Kurz bevor er die Leiter in das wartende Boot hinabstieg, hielt er inne und starrte in das rastlose Wasser. Der Anblick des bärtigen Mannes, der ihn aus dem schwarzen Monster angeschaut hatte, würde ihn bis in den Tod begleiten. »Wer bist du?«, murmelte er vor sich hin. »Hast du überlebt? Und wenn ja, wer wird dann dein nächstes Opfer sein?«
Jedes Mal, wenn ihm in den nächsten Jahren eine Meldung zu Ohren kam, dass ein Kriegsschiff mit Mann und Maus verschwunden war, fragte sich Hunt unwillkürlich, ob der Mann in dem Monster dafür verantwortlich war.
Die Offiziere und Mannschaften der Kearsarge harrten zwei Wochen auf dem Eiland aus, ohne Not leiden zu müssen, bis sie eines Tages eine Rauchfahne am Horizont entdeckten. Hunt schickte seinen Ersten Offizier mit einem Boot los, und Ellis hielt einen vorbeifahrenden Dampfer an, der Hunt und seine Männer aufnahm und nach Panama brachte.
Eigenartigerweise mussten sich Hunt und seine Besatzung bei ihrer Rückkehr in die Vereinigten Staaten nicht vor einem Untersuchungsausschuss verantworten – ein äußerst ungewöhnlicher Umstand. Es war, als wollten das Marineministerium und die Admiralität den Vorfall stillschweigend unter den Teppich kehren. Zu seinem Erstaunen wurde Hunt sogar in den Rang eines Vollkapitäns erhoben, bevor man ihn ehrenvoll in den Ruhestand verabschiedete. Lieutenant Ellis wurde ebenfalls befördert, mit dem Kommando über die Helena betraut, dem neuesten Kanonenboot der US-Navy, und diente während des spanisch-amerikanischen Krieges in kubanischen Gewässern.
Der Kongress bewilligte 45000 Dollar, um die vor dem Roncador-Riff liegende Kearsarge zu bergen und zu einer heimischen Werft zu schleppen. Doch man stellte fest, dass die Bewohner der nahe gelegenen Inseln sie in Brand gesteckt und sämtliche Messing-, Kupfer- und Eisenteile abmontiert hatten. Der Bergungstrupp baute die Kanonen aus, kehrte in den Hafen zurück und überließ das Wrack dem Verfall.
ERSTER TEIL Inferno
15. Juli 2001Südlicher Pazifischer Ozean
1
Selbst wenn das Unglück Monate voraus sorgfältig geplant und fachmännisch vorbereitet worden wäre, hätte es verheerender nicht sein können. Als es darauf ankam, ging so viel schief, dass es jede Vorstellung überstieg. Das luxuriöse Kreuzfahrtschiff Emerald Dolphin brannte, und niemand an Bord hatte auch nur den leisesten Verdacht oder ahnte etwas von der drohenden Gefahr. Doch langsam verzehrten die Flammen das Innere der Hochzeitskapelle, die mittschiffs lag, unmittelbar vor dem noblen Shopping-Bereich.
Die Offiziere, die auf der Brücke Wache hatten, bemerkten nichts von der sich anbahnenden Katastrophe. Keine der doppelt und dreifach ausgelegten Warnanlagen, weder Hitze- noch Rauchmelder zeigten an, dass etwas nicht stimmte. Ein Meer aus grünen Lichtern flimmerte auf der Konsole, auf der das ganze Schiff im Längs- und Querschnitt samt sämtlicher Feuermelder abgebildet war. Nicht ein einziges rotes Lämpchen blinkte auf, das auf einen Brand in der Kapelle hingedeutet hätte.
Es war vier Uhr morgens, und die Passagiere waren längst in ihren Kabinen und schliefen. Die Bars und Salons, das prachtvolle Casino, der Nachtclub und der Tanzsaal waren leer und verlassen, während das Schiff, das auf Kreuzfahrt von Sydney, Australien, nach Tahiti unterwegs war, unverdrossen durch die Südsee pflügte. Die Emerald Dolphin, die erst vor einem Jahr vom Stapel gelaufen und anschließend ausgerüstet worden war, befand sich auf ihrer Jungfernfahrt. Sie hatte nicht die fließend eleganten Linien anderer Kreuzfahrtschiffe, sondern wirkte wie ein riesiges Versorgungsboot, auf das man eine überdimensionale Diskusscheibe montiert hatte. Die gesamten Aufbauten mit ihren sechs Decks waren kreisrund, ragten in weitem Bogen zu beiden Seiten fünfundvierzig Meter über den Rumpf hinaus, an Bug und Heck immerhin noch gut fünfzehn Meter, und ähnelten eher dem Raumschiff Enterprise. Zumal sie keinen Schornstein trug.
Das neue Schiff, der ganze Stolz der Blue Seas Cruise Line, würde zweifellos sechs Sterne erhalten und sich großen Zuspruchs erfreuen, vor allem aufgrund seiner Ausstattung, die an ein prunkvolles Hotel in Las Vegas erinnerte. Bereits auf ihrer Jungfernfahrt waren sämtliche Kabinen ausgebucht. Mit fünfzigtausend Bruttoregistertonnen bei einer Länge von zweihundertdreißig Metern beförderte sie tausendsechshundert Passagiere, für deren Wohlergehen neunhundert Besatzungsmitglieder sorgten.
Die Schiffsbauingenieure hatten sich bei der Gestaltung der ultramodernen und hypereleganten Speisesäle, der drei Bar- und Salonbereiche, des Casinos, des Ballsaals, des Theaters und der Kabinen selbst übertroffen. Überall war buntes Glas in den unterschiedlichsten Farbtönen verwendet worden, Chrom, Messing und Kupfer zierte Wände und Decken. Sämtliches Mobiliar war von zeitgenössischen Künstlern und prominenten Innenarchitekten entworfen worden. Eine einzigartige Beleuchtung sorgte für eine geradezu himmlische Atmosphäre – jedenfalls nach Ansicht der Ausstatter, die sich bei ihren Himmelsvorstellungen an die Schilderungen Sterbender, die man wieder zum Leben erweckt hatte, gehalten hatten. Niemand musste weite Fußwege zurücklegen, es sei denn, er wollte draußen auf dem Promenadendeck umherspazieren. Ansonsten standen den Passagieren überall Rolltreppen, rollende Rampen und Laufbänder zur Verfügung, und mit ein paar Schritten waren sie bei einem der zahlreichen Aufzüge mit den gläsernen Kabinen, die zwischen den Decks verkehrten.
Auf dem Sportdeck war ein kleiner Golfplatz mit vier Löchern angelegt, dazu ein Schwimmbecken, das jeder Olympianorm entsprach, ein Basketballplatz und ein großes Fitnessstudio. Die Einkaufsstraße, die sich daran anschloss, ragte drei Etagen hoch auf und sah aus, als wäre sie dem Smaragdschloss des Zauberers von Oz nachempfunden.
Darüber hinaus war das Schiff ein schwimmendes Museum, auf dem allerlei abstrakte und moderne Kunst ausgestellt war, von Paul Klee über Willem de Kooning bis zu Jackson Pollock und anderen berühmten Malern. Bronzeplastiken von Henry Moore standen auf Platinsockeln in den Nischen des Speisesaals. Achtundsiebzig Millionen Dollar hatte die Reederei allein für diese Sammlung ausgegeben.
Die Kabinen waren ebenfalls rund, ohne Ecken und Kanten. Sie waren geräumig und boten allesamt den gleichen Komfort – auf der Emerald Dolphin gab es weder kleine Zwischendeckskabinen noch Luxussuiten, denn die Konstrukteure hielten nichts von einer Zweiklassengesellschaft an Bord. Die Einrichtung sah aus, als stammte sie aus einem Science-Fiction-Film. Die Betten mit den extra weichen Matratzen ruhten auf einem hohen Piedestal und wurden vom sanften Lichtschein der Deckenleuchten angestrahlt. Dezent in der Decke angebrachte Spiegel standen all jenen zur Verfügung, die hier die ersten oder zweiten Flitterwochen genießen wollten. Die Badezimmer besaßen eigens eingebaute Kammern, in denen man sich inmitten eines Dschungels blühender Tropenpflanzen, die aussahen, als wären sie auf einem fremden Planeten gewachsen, mit Dunst, Sprühnebel, Regen oder Dampf berieseln lassen konnte. All dies sorgte dafür, dass eine Kreuzfahrt auf der Emerald Dolphin ein einzigartiges Erlebnis war.
Zumal sich die Konstrukteure von vornherein darüber im Klaren gewesen waren, aus welchen Kreisen die künftigen Passagiere stammen würden, und das Schiff entsprechend den Vorstellungen wohlhabender jüngerer Menschen gestaltet hatten. Viele von ihnen waren gut betuchte Ärzte, Anwälte und Unternehmer. Die meisten brachten ihre Familien mit, sodass die allein stehenden Passagiere in der Minderheit waren. Aber es gab auch eine ganze Reihe Senioren an Bord, die aussahen, als ob sie sich von ihrem Geld das Beste vom Besten leisten könnten.
Nach dem Abendessen besuchten die Familien mit Kindern das Theater und sahen sich Sonofagun from Arizona an, das vom Ensemble des Schiffes dargebotene, neueste Erfolgsmusical vom Broadway, während die jungen Pärchen im Ballsaal zu den Evergreens und aktuellen Hits tanzten, die die Bordkapelle spielte, das Showprogramm im Nachtclub genossen oder im Casino beim Spiel saßen. Um drei Uhr morgens indes waren die Salons und Promenadendecks leer und verlassen, und keiner der Passagiere, die mittlerweile alle im Bett lagen, hätte sich träumen lassen, dass der grimme Schnitter mit seiner Sense zum tödlichen Streich gegen die Emerald Dolphin ausholte.
Kapitän Jack Waitkus unternahm einen kurzen Kontrollgang über die oberen Decks, bevor er sich in seine Kabine zurückzog. Mit seinen fast fünfundsechzig Jahren war Waitkus, der in fünf Tagen Geburtstag hatte, nach den auf Kreuzfahrtschiffen geltenden Maßstäben vergleichsweise alt. Daher gab er sich auch keinerlei Illusionen hin, was seinen weiteren Werdegang auf See anging. Die Direktoren der Reederei hatten ihm bereits mitgeteilt, dass er an Land bleiben müsse, sobald das Schiff von seiner Jungfernfahrt nach Sydney wieder in seinen Heimathafen Fort Lauderdale zurückkehrte. Genau genommen freute sich Waitkus auf den Ruhestand. Er und seine Frau wohnten auf einer herrlichen, zwölf Meter langen Segeljacht, mit der sie schon seit Jahren eine beschauliche Reise rund um die Welt unternehmen wollten. In Gedanken steckte Waitkus bereits einen Kurs ab, der sie quer über den Atlantik zum Mittelmeer führen sollte.
In Anerkennung seiner hervorragenden Verdienste um die Reederei hatte man ihm auf dieser Jungfernfahrt das Kommando über die Emerald Dolphin anvertraut. Er war ein stämmiger Mann mit schelmischen blauen Augen und einem freundlichen Lächeln, der stets vergnügt und leutselig wirkte, wie ein Falstaff ohne Bart. Im Gegensatz zu vielen anderen Kapitänen, die sich auf einer Kreuzfahrt nur ungern unter die Passagiere mischten, genoss Waitkus den Kontakt zu ihnen. An seinem Tisch im Speisesaal unterhielt er seine Gäste mit allerhand Geschichten darüber, wie er als Junge in Liverpool von zu Hause durchgebrannt war, um Seemann zu werden, auf Trampdampfern im Orient gefahren war und sich allmählich hochgedient hatte. Er hatte eifrig gelernt und sämtliche Offiziersprüfungen abgelegt, bis er schließlich das Kapitänspatent erhalten hatte. Danach hatte er zehn Jahre lang als Erster und Zweiter Offizier in Diensten der Blue Seas Cruise Line gestanden, bis er zum Kapitän der Emerald Dolphin ernannt worden war. Er war sehr beliebt, daher ließen ihn die Direktoren der Reederei nur ungern gehen, aber andererseits hatte er die in der Firma übliche Altersgrenze erreicht, und man wollte seinetwegen keine Ausnahme machen.
Er war müde, aber vor dem Schlafengehen las er grundsätzlich noch ein paar Seiten in einem seiner Bücher über Schätze, die im Meer lagen. Das Wrack eines Schiffes, das mit einer Ladung Gold vor der marokkanischen Küste untergegangen war, hatte es ihm dabei besonders angetan, und auf der Fahrt, die er antreten wollte, sobald er im Ruhestand war, gedachte er vor allem danach zu suchen. Vor dem Einschlafen meldete er sich ein letztes Mal auf der Brücke und erfuhr, dass es keinerlei besondere Vorkommnisse gab.
Um 4 Uhr 10 glaubte Charles McFerrin, der Zweite Offizier, bei einem Routinerundgang durch das Schiff leichten Rauchgeruch wahrzunehmen. Schnüffelnd ging er die Einkaufszeile entlang und stellte fest, dass der Geruch immer stärker und beißender wurde, je näher er dem anderen Ende kam, wo sich die Boutiquen und Geschenkartikelläden befanden. Verwundert, weil kein Feueralarm ertönte, blieb er vor der Tür zur Hochzeitskapelle stehen, spürte dann die Hitze dahinter und zog sie auf.
Der gesamte Innenraum war ein einziges Flammenmeer. Erschrocken torkelte McFerrin vor der durchdringenden Hitze zurück, geriet ins Stolpern und fiel zu Boden. Rasch rappelte er sich wieder auf, meldete sich über sein tragbares Funkgerät auf der Brücke und erteilte eine Reihe von Befehlen. »Wecken Sie Käpt’n Waitkus. Die Kapelle steht in Brand. Geben Sie Alarm, lösen Sie die per Computer gesteuerte Löschanlage aus.«
Vince Sheffield, der Erste Offizier, drehte sich unwillkürlich zu der Konsole mit dem Feuermeldesystem um. Sämtliche Lichter waren grün. »Sind Sie sich sicher, McFerrin? Hier liegen keinerlei Hinweise vor.«
»Glauben Sie mir«, schrie McFerrin in die Sprechmuschel. »Hier unten herrscht das reinste Inferno!«
»Haben sich die Sprinkler eingeschaltet?«, fragte Sheffield.
»Nein, irgendwas ist hier oberfaul. Die Löschanlage funktioniert nicht, und außerdem gab es keinen Feueralarm.«
Sheffield wusste nicht weiter. Die Emerald Dolphin besaß das modernste Feueralarm- und Löschsystem, mit dem je ein Schiff ausgestattet worden war. Aber wehe, wenn das nicht funktionierte. Unschlüssig und wie erstarrt stand er vor der Konsole, auf der kein einziges Warnlicht blinkte, musterte sie ungläubig, während kostbare Sekunden verrannen. Er wandte sich an Carl Harding, dem ihm unterstellten Offizier auf der Brücke. »McFerrin meldet einen Brand in der Kapelle. Auf der Feuermeldekonsole ist aber nichts zu sehen. Gehen Sie runter, und sehen Sie mal nach.«
Unterdessen ging weitere Zeit verloren, während McFerrin mit einem Handfeuerlöscher verzweifelt gegen die sich ausbreitende Feuersbrunst kämpfte. Doch es war, als versuchte er mit einem alten Futtersack einen Waldbrand zu ersticken. Machtlos stand er den Flammen gegenüber, die aus der Kapelle schlugen, konnte immer noch nicht glauben, dass die automatische Sprinkleranlage nicht funktionierte. Solange der Löschtrupp nicht anrückte, die Schläuche anschloss und dem Feuer zu Leibe rückte, ließ sich dieser Brand nicht bändigen. Stattdessen tauchte lediglich Harding auf, der gemächlich die Einkaufszeile entlangkam.
Harding war fassungslos, als er das flammende Inferno sah, gegen das McFerrin allein und auf verlorenem Posten ankämpfte. Er meldete sich auf der Brücke. »Herrgott noch mal, Sheffield! Hier unten tobt eine Feuersbrunst, und wir haben bloß ein paar Handfeuerlöscher zur Verfügung. Alarmieren Sie die Bordfeuerwehr, und schalten Sie die Löschanlage ein!«
Sheffield, der immer noch von Zweifeln geplagt wurde, überging die Computerschaltung und löste die Löschanlage in der Kapelle von Hand aus.
»Hier tut sich gar nichts!«, schrie McFerrin. »Beeilung, Mann. Allein können wir das nicht aufhalten.«
Wie benommen griff Sheffield zum Bordtelefon und verständigte den für den Löschtrupp zuständigen Offizier von dem Brand. Dann weckte er Kapitän Waitkus.
»Sir, mir wurde ein Brand in der Kapelle gemeldet.«
Waitkus war auf der Stelle hellwach. »Wird die Löschanlage damit fertig.«
»McFerrin und Harding, die vor Ort sind, haben mir gemeldet, dass die Anlage nicht funktioniert. Sie versuchen den Brand mit Feuerlöschern einzudämmen.«
»Lassen Sie den Löschtrupp ausrücken.«
»Das habe ich bereits veranlasst, Sir.«
»Sorgen Sie dafür, dass die Mannschaften für die Rettungsboote auf Station gehen.«
»Ja, Sir. Wird gemacht.«
Waitkus zog sich in aller Eile an. Er wollte alle erforderlichen Vorkehrungen treffen, auch wenn er sich nicht vorstellen konnte, dass sich das Schiff tatsächlich in Seenot befand und er die zweitausendfünfhundert Passagiere und Besatzungsmitglieder in die Boote befehlen musste. Er stürmte auf die Brücke und musterte die Konsole mit den Feuermeldern. Dort glühten nach wie vor nur grüne Lämpchen. Wenn tatsächlich ein Brand an Bord ausgebrochen war, dann zeigte ihn keiner dieser hypermodernen Detektoren an, und infolgedessen schaltete sich auch die automatische Löschanlage nicht ein.
»Sind Sie sich hundertprozentig sicher«, herrschte er Sheffield an.
»McFerrin und Harding haben bestätigt, dass die Kapelle in hellen Flammen steht.«
»Das darf doch nicht wahr sein.« Waitkus griff zum Bordtelefon und rief im Maschinenraum an.
Joseph Barnum, der Chefmaschinist vom Dienst, meldete sich. »Maschinenraum. Barnum am Apparat.«





























