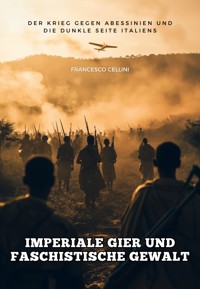
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
1935 marschierte das faschistische Italien unter Benito Mussolini in Abessinien – das heutige Äthiopien – ein. Was als imperialer Eroberungskrieg begann, wurde zu einem der brutalsten und zugleich verdrängtesten Kapitel der europäischen Kolonialgeschichte. Mit rücksichtsloser Gewalt, systematischen Kriegsverbrechen und dem Einsatz verbotener Chemiewaffen suchte das Regime, seinen Traum eines neuen Römischen Reiches zu verwirklichen – auf Kosten hunderttausender unschuldiger Menschen. Dieses Buch beleuchtet die ideologischen, wirtschaftlichen und geopolitischen Motive hinter Mussolinis Expansionsdrang und zeigt die erschütternde Realität eines Krieges, der bis heute in der italienischen Geschichtsschreibung weitgehend verschwiegen wird. Mit akribischer Recherche und eindrucksvollen Quellenanalysen rekonstruiert Francesco Cellini die Ereignisse, gibt den Opfern eine Stimme und wirft einen kritischen Blick auf das internationale Versagen, das diesen Völkermord geschehen ließ. Ein aufrüttelndes Werk über Krieg, Propaganda und das ungesühnte koloniale Erbe Europas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 223
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Imperiale Gier und faschistische Gewalt
Der Krieg gegen Abessinien und die dunkle Seite Italiens
Francesco Cellini
Einleitung: Abessinien und Italien im frühen 20. Jahrhundert
Historischer Hintergrund: Abessinien vor der italienischen Invasion
Abessinien, im heutigen Sprachgebrauch besser bekannt als Äthiopien, blickt auf eine lange und beeindruckende Geschichte zurück, die bis in die Antike reicht. Das Königreich von Aksum, das zwischen dem ersten und siebten Jahrhundert nach Christus blühte, gilt als eines der mächtigsten Reiche seiner Zeit im östlichen Afrika. Durch seine strategisch günstige Lage entlang der Handelsrouten zwischen dem römischen Reich und Indien spielte Aksum eine bedeutende Rolle im internationalen Handel. Zudem war Aksum eines der ersten Länder der Welt, das das Christentum als offizielle Religion annahm. Diese frühchristlichen Traditionen haben das soziale und kulturelle Gefüge Äthiopiens maßgeblich geprägt.
Im Laufe der Jahrhunderte erlebte Abessinien verschiedene interne Machtkämpfe und äußere Einflüsse, doch es blieb weitestgehend unabhängig, selbst in Zeiten großer kolonialer Expansionen im 19. Jahrhundert. Die wohl markanteste Episode der Verteidigung ihrer Unabhängigkeit war die Schlacht von Adua im Jahr 1896, in der abessinische Truppen eine italienische Invasionstruppen verheerend schlugen. Dieser Triumph hatte eine immense symbolische Bedeutung und stärkte das nationale Selbstbewusstsein enorm.
Die politische Ordnung in Abessinien zur Zeit der italienischen Invasion im Jahr 1935 war geprägt von einem feudalähnlichen System, an dessen Spitze Kaiser Haile Selassie I. stand. Haile Selassie, ein charismatischer und progressiver Herrscher, bemühte sich, das Land zu modernisieren und die zentrale Regierungsführung zu stärken. Seine Regierungszeit war geprägt von Reformen, die unter anderem die Bürokratie, das Bildungswesen und die Armee umfassten. Trotz dieser Fortschritte blieb das Land in vielerlei Hinsicht traditionell: Der Großteil der Bevölkerung lebte in ländlichen Gebieten und war im landwirtschaftlichen Sektor tätig.
Der Einfluss des Christentums war und ist tief in der abessinischen Gesellschaft verwurzelt. Das äthiopisch-orthodoxe Christentum, das tief mit der Identität und der kulturellen Struktur des Landes verankert ist, spielte eine zentrale Rolle im Alltag und in der Politik. Doch auch der Islam und verschiedene traditionelle Religionen hatten ihre Anhänger und prägten die religiöse Vielfalt des Landes. Die Herrscher Abessiniens pflegten trotz einiger Spannungen eine Politik der religiösen Toleranz.
Vor der italienischen Invasion war Abessinien nur begrenzt industrialisiert. Der Großteil der Wirtschaft basierte auf der Landwirtschaft, insbesondere dem Anbau von Getreide, Kaffee und der Viehzucht. Technologische Innovationen und moderne Infrastruktur waren auf wenige urbane Zentren begrenzt. Dies bedeutete auch, dass die Mobilisierung und Ausstattung der Armee im Vergleich zu europäischen Mächten erheblich eingeschränkt war.
Die Geopolitik des frühen 20. Jahrhunderts in Afrika wurde stark durch koloniale Ambitionen europäischer Mächte geprägt. Während die meisten afrikanischen Länder durch die Berliner Konferenz von 1884/85 aufgeteilt und unter europäische Kontrolle gebracht wurden, gelang es Abessinien – auch dank seiner militärischen Erfolge – weitgehend, eine Kolonisation zu verhindern. Italien jedoch hatte nach der Niederlage in der Schlacht von Adua seine kolonialen Ambitionen nie aufgegeben und richtete im Verlauf der Eskalation des Faschismus seine Augen erneut auf Abessinien.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Abessinien vor der italienischen Invasion eine eigenständige, kulturell reiche Nation mit einer tief verwurzelten Geschichte und Identität war. Trotz wirtschaftlicher und technologischer Rückständigkeit in einigen Bereichen war das Land stolz auf seine Unabhängigkeit und seine historischen Triumphe gegen Kolonialmächte. Diese Aspekte sind essenziell, um das komplexe Geflecht aus politischen, sozialen und kulturellen Faktoren zu verstehen, welches das Land zum Zeitpunkt der italienischen Invasion im Jahr 1935 prägte.
Die kolonialen Ambitionen Italiens
Die kolonialen Ambitionen Italiens im frühen 20. Jahrhundert lassen sich nur im größeren Kontext der europäischen Kolonialpolitik und der nationalen Entwicklungen Italiens verstehen. Nach der Vereinigung Italiens 1861 strebte die junge Nation, ähnlich wie andere europäische Mächte, nach Kolonien, um sich wirtschaftlichen und politischen Einfluss über ihre Grenzen hinaus zu sichern.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts galt ein großes Kolonialreich als Symbol nationaler Stärke und Prestiges. Italien, trotz seiner relativen späten Vereinigung im Vergleich zu anderen europäischen Mächten, sah sich im Wettlauf um Kolonien gegenüber Ländern wie Großbritannien, Frankreich und Deutschland im Nachteil. Diese Gewissheit trieb die italienischen Führer dazu, aggressive Kolonialstrategien zu verfolgen.
Die Italiener hatten bereits im ausgehenden 19. Jahrhundert erste Kolonisierungsversuche in Afrika unternommen und sich Gebiete im heutigen Eritrea und Somalia gesichert. 1896 erlitt Italien jedoch eine schwere Niederlage in der Schlacht von Adua gegen die Truppen des Kaisers Menelik II. von Abessinien. Diese Niederlage war ein demütigender Rückschlag für die italienischen Kolonialbestrebungen und führte zu einem Frauorgefühl, demadel mit militärischem Eifer entgegengetreten wurde.
Unter der Führung des faschistischen Diktators Benito Mussolini intensivierten sich die imperialistischen Ambitionen Italiens nochmals erheblich. Mussolini träumte von der Wiederherstellung eines neuen Römischen Reiches, was als „Mare Nostrum“-Politik bekannt wurde. Die Übernahme von Territorien in Afrika sollte diese Vision verwirklichen und Italien als Großmacht etablieren. Diese Großmachtambitionen wurden auch als Mittel der sozialen und wirtschaftlichen Stabilisierung innerhalb Italiens betrachtet, indem Land und Ressourcen kolonisiert und besiedelt wurden.
Wirtschaftliche Überlegungen spielten ebenfalls eine zentrale Rolle. Italien, das unter hoher Arbeitslosigkeit und einer labilen Wirtschaft litt, suchte in Übersee nach neuen Märkten, Rohstoffen und Siedlungsgebieten. Die Ressourcen Abessiniens, insbesondere seine Bodenschätze und landwirtschaftlichen Potenziale, weckten das Interesse der Italiener. Diese Hoffnung auf wirtschaftlichen Aufschwung durch Kolonialismus spiegelte sich in der nationalen Propaganda wider, die Abessinien als unumstrittene und reiche Beute darstellte.
Politisch wurde der Krieg gegen Abessinien von Mussolini propagandistisch ausgeschlachtet. Er nutzte das Versprechen eines schnellen und glorreichen Sieges, um die öffentliche Meinung zu seinen Gunsten zu manipulieren und seine Herrschaft zu festigen. Die italienische Bevölkerung wurde von einer massiven Propagandakampagne beeinflusst, die die Kolonialkriege als notwendiges und heroisches Unterfangen darstellte. Diese Propaganda vermittelte ein Bild von militärischer Größe und nationaler Überlegenheit, das die Zustimmung zu den kolonialen Bestrebungen stärkte.
Auch hatten die Bestrebungen eine geopolitische Dimension. Italien befand sich im Wettbewerb mit den anderen Großmächten, insbesondere in Hinblick auf den Einfluss und die Kontrolle in Ostafrika. Die Konkurrenz um Territorien und strategische Knotenpunkte war typisches Merkmal der europäisch-imperialen Politik jener Zeit. Der Krieg gegen Abessinien stellte somit auch einen Versuch dar, das Machtgleichgewicht in der Region zu Gunsten Italiens zu verschieben. Die italienische Führung wollte die Kontrolle über das Horn von Afrika erlangen, um die regionalen Handelsrouten und strategischen Positionen zu dominieren.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die kolonialen Ambitionen Italiens durch eine Kombination aus nationalem Prestige, wirtschaftlichem Bedarf, politischem Kalkül und geopolitischer Strategie geprägt waren. Die Verlockung eines Kolonialreiches, das Italien in die Reihe der großen Mächte katapultieren könnte, war eine treibende Kraft hinter der Expansion in Abessinien. Diese komplexen Motivationen und deren Konsequenzen bilden ein wesentliches Kapitel in der tragischen Geschichte des Abessinienkrieges und Italiens Verbrechen im Zuge dieser imperialistischen Bestrebungen.
Politische und wirtschaftliche Verhältnisse in Italien und Abessinien
In den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts befanden sich sowohl Italien als auch Abessinien – das heutige Äthiopien – in tiefgreifenden politischen und wirtschaftlichen Veränderungen, die jedoch in vielen Hinsichten konträr verliefen. Während Italien als junger Nationalstaat mit seinen kolonialen Ambitionen rang, stand Abessinien vor der Herausforderung, seine Unabhängigkeit und traditionellen Strukturen gegenüber externen Bedrohungen zu verteidigen.
Italien erlebte nach seiner Vereinigung 1861 eine Phase des wirtschaftlichen Wachstums und der Industrialisierung, jedoch auch erhebliche soziale und politische Spannungen. Die italienische Wirtschaft war stark agrarisch geprägt, und die Industrialisierung konzentrierte sich hauptsächlich auf den Norden des Landes. Der Süden blieb weitestgehend verarmt und rückständig, was zu erheblichen regionalen Disparitäten führte. Die Regierung sah sich außerdem mit einem hohen Maß an Korruption und Ineffizienz konfrontiert.
Die Mittelmeerregion war zu dieser Zeit ein Schauplatz intensiver wirtschaftlicher und geopolitischer Rivalitäten zwischen den Großmächten Europas. Italien, das im Vergleich zu seinen Nachbarn – insbesondere Großbritannien, Frankreich und Deutschland – relativ spät in das Wettrennen um koloniale Besitztümer eingetreten war, suchte verzweifelt nach Möglichkeiten, sein eigenes Kolonialreich zu erweitern. Die Schaffung eines “Neuen Römischen Reiches” war ein zentraler Bestandteil dieser Bestrebungen, die sowohl aus wirtschaftlicher Notwendigkeit als auch aus nationalistischen Motiven gespeist wurden. Die Überseeexpansionen wurden von der Vorstellung begleitet, dass Kolonien als Ventil für die Überbevölkerung und die sozialen Spannungen in Italien dienen könnten.
Ein weiterer wichtiger Faktor war die politische Instabilität im frühen 20. Jahrhundert, die zur Etablierung des faschistischen Regimes unter Benito Mussolini führte. Mussolinis Aufstieg zur Macht 1922 bedeutete eine radikale Umgestaltung der italienischen Innen- und Außenpolitik. Er sah in der Expansionspolitik ein Mittel zur nationalen Konsolidierung und zur Stärkung seines Regimes. Die wirtschaftlichen Reformen der faschistischen Regierung zielten darauf ab, Italien unabhängig von ausländischen Märkten und Rohstoffen zu machen. Kolonialbesitzungen wurden als essentielle Ressource für die Sicherung dieser Autarkie betrachtet.
In Abessinien hingegen war die politische Landschaft von einer jahrhundertealten Monarchie und einer stark dezentralisierten Machtstruktur geprägt. Kaiser Haile Selassie, der 1930 den Thron bestieg, widmete sich der Modernisierung und Zentralisierung des Staates. Er stellte eine Reihe von Reformen in Gang, die das Bildungswesen, die Infrastruktur und die Militärorganisation betrafen. Trotz dieser Bemühungen blieb Abessinien wirtschaftlich überwiegend agrarisch und die Industrialisierung war kaum fortgeschritten. Der Einfluss traditioneller und religiöser Eliten war weiterhin stark.
Die internationale Position Abessiniens war ebenfalls eine Herausforderung. Als eines der wenigen afrikanischen Länder, das seine Unabhängigkeit von europäischen Kolonialmächten bewahrt hatte, stand Abessinien unter ständigem Druck. Die Bedrohung durch koloniale Expansion wurde durch die geostrategische Lage des Landes verstärkt, da es an wichtigen Handelsrouten lag und über wertvolle Bodenschätze verfügte. Die politische Isolation und die unzureichenden Verteidigungsfähigkeiten machten das Land anfällig für äußere Bedrohungen.
Der wirtschaftliche und politische Kontext beider Länder formte die Voraussetzungen und die Motivation für den bevorstehenden Konflikt. Während Italien seine kolonialen Ambitionen mit wirtschaftlichen Bedürfnissen und ideologischen Zielsetzungen verknüpfte, kämpfte Abessinien um das Überleben und die Bewahrung seiner Souveränität. Diese kontrastierenden Perspektiven führten letztlich zu einem unvermeidlichen Aufeinandertreffen.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse in Italien und Abessinien im frühen 20. Jahrhundert von grundlegenden Unterschieden, aber auch von internen und externen Herausforderungen geprägt waren. Italiens Bestreben, durch koloniale Expansion wirtschaftliche und nationale Stabilität zu erreichen, stand in scharfem Gegensatz zu Abessiniens Kampf um Unabhängigkeit und Souveränität. Diese divergierenden Zielsetzungen und der jeweilige historische Kontext bildeten den Nährboden für die Spannungen und Konflikte, die schließlich in den Abessinienkrieg mündeten.
„Die Wirklichkeit verlangte schon vor Mussolini Raum unter der Sonne für Italien” (Carocci, Giampiero, 1959). Diese Worte fassen treffend den unvermeidlichen Anstoß Italiens zur Expansion zusammen, welche letztlich das Schicksal Abessiniens besiegelte.
Die Rolle des Faschismus in Italiens Außenpolitik
Die Rolle des Faschismus in Italiens Außenpolitik lässt sich nicht isoliert betrachten, sondern muss im Kontext der radikalen Ideologie verstanden werden, die Benito Mussolini und seine Faschistische Partei seit ihrer Machtübernahme 1922 verfolgten. Der Faschismus, eine repressive und extrem nationalistische Bewegung, zielte darauf ab, Italien nicht nur im Inland politisch und wirtschaftlich zu transformieren, sondern auch außenpolitisch als dominierende Großmacht zu etablieren.
In den frühen 1930er Jahren, als Italien unter dem Druck der Weltwirtschaftskrise litt, betrachtete Mussolini die Expansion als eine Möglichkeit, innenpolitische Spannungen abzulenken und wirtschaftliche Ressourcen zu gewinnen. Der Faschismus betonte die Überlegenheit der „italischen Rasse“ und sah in der Schaffung eines neuen römischen Imperiums einen zentralen Bestandteil seiner Ideologie. Italien hatte bereits in den 1880er Jahren begonnen, Kolonien in Eritrea und Somalia zu errichten, aber der demütigende Verlust in der Schlacht von Adua 1896 gegen abessinische Kräfte hinterließ tiefe Spuren im nationalen Bewusstsein. Mussolini strebte danach, diese Schmach zu tilgen und die Vision eines glorifizierten römischen Imperiums zu verwirklichen.
Italiens Außenpolitik unter Mussolini war von einem aggressiven Expansionismus geprägt, der sich in mehreren internationalen Ereignissen manifestierte. Ein frühes Zeichen dieser Haltung war die Besetzung Fiumes 1923 und der Vertrag von Rapallo, der Italien breite Zugeständnisse seitens Jugoslawien verschaffte. Diese Bestrebungen gipfelten in einer umfassenden Militarisierung und propagandistischen Vorbereitung der Bevölkerung auf eine unvermeidliche Konfrontation. Der Faschismus glorifizierte den Krieg als Instrument nationaler Erneuerung und propagierte eine Militarisierung der Gesellschaft. „Ein Jahr des Krieges“, so erklärte Mussolini 1934, „bedeutet mehr für die nationale Erhebung als ein Jahrzehnt des Friedens.“
Die ideologischen Grundlagen des Faschismus betonten nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht Italiens zur Expansion. Das regimetreue Manifesto della razza von 1938 propagierte offen rassistische Doktrinen, die die Italiener als Erben der römischen Antike und somit als Vorfahren einer überlegenen Zivilisation darstellten. Diese ideologische Basis rechtfertigte nicht nur die aggressive Außenpolitik, sondern auch die brutalen Methoden, die Italien zur Durchsetzung seiner Ziele anwandte, einschließlich der Anwendung chemischer Waffen und systematischer Massaker an Zivilisten.
Mussolini und sein Regime erkannten auch die Wichtigkeit internationaler Allianzen, um ihre außenpolitischen Ziele zu erreichen. Die Annäherung an Nazi-Deutschland und der Abschluss des Stahlpakts 1939 waren strategische Schritte, um die Position Italiens in Europa zu stärken und Unterstützung für ihre kolonialen Ambitionen zu sichern. Diese Allianzen spiegelten die gemeinsame ideologische Basis und die Bereitschaft wider, brutale Mittel einzusetzen, um geopolitische Dominanz zu erlangen.
Im Kontext des Abessinienkrieges (1935-1936) zeigte sich die Rolle des Faschismus in Italiens Außenpolitik besonders deutlich. Der Krieg war nicht nur ein Versuch, koloniale Gebiete zu erweitern, sondern auch ein Testgelände für die faschistische Ideologie. Die brutale Niederschlagung der abessinischen Widerstandsbewegung wurde durch eine rücksichtslos propagierte Überlegenheit des faschistischen Systems gerechtfertigt. In seinem berüchtigten Proklama von Addis Abeba erklärte Mussolini: „Das faschistische Italien hat der Welt und der Geschichte seine Entschlossenheit und seine Stärke demonstriert. Wir werden nie wieder die Stellung eines italienischen Mannes oder auch nur eines Tropfens italienischen Blutes in Gefahr bringen.“
Letztlich führte diese aggressive Außenpolitik nicht nur zu Gräueltaten und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Abessinien, sondern hatte auch weitreichende Auswirkungen auf die internationale Ordnung. Der Völkerbund versagte bei der effektiven Durchsetzung von Sanktionen gegen das faschistische Italien, was die internationalen Spannungen verschärfte und den Weg für zukünftige Konflikte ebnete. Mussolinis visionäre aber destruktive Ziele setzten Italien auf einen Kollisionskurs mit den etablierten Mächten und führten letztlich in die Katastrophe des Zweiten Weltkrieges.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Faschismus eine zentrale Rolle in der Außenpolitik Italiens spielte, indem er Expansionismus und militärische Aggression als legale und notwendige Mittel zur Verwirklichung seiner ideologischen und territorialen Ziele betrachtete. Diese Politik führte nicht nur zu den unbeschreiblichen Gräueltaten im Abessinienkrieg, sondern trug auch wesentlich zur Destabilisierung der internationalen Beziehungen in der Vorkriegszeit bei.
Diplomatische Spannungen: Die Vorgeschichte des Konflikts
Im frühen 20. Jahrhundert war die politische Lage zwischen Italien und Abessinien (dem heutigen Äthiopien) durch zahlreiche diplomatische Spannungen geprägt, die letztlich zum verheerenden Abessinienkrieg führten. Der Ursprung dieser Konflikte lässt sich bis in die späten Jahre des 19. Jahrhunderts zurückverfolgen, als Italien erstmals versuchte, seinen kolonialen Einfluss in Afrika auszudehnen. Nachdem Italien in der Schlacht von Adua 1896 eine schwere Niederlage gegen die abessinischen Streitkräfte erlitten hatte, waren die Beziehungen zwischen den beiden Nationen extrem angespannt. Trotz dieser historischen Schmach verfolgte Italien weiterhin ambitionierte Pläne zur Expansion seines Reiches in Ostafrika.
Italienische Sozialdemokraten und Faschisten hegten unterschiedliche Ansichten über die Frage des Kolonialismus. Während die sozialistischen Kräfte in Italien in der Kolonialpolitik eine Form der imperialistischen Unterdrückung sahen, nutzte der aufkommende Faschismus unter Benito Mussolini den Kolonialismus als Mittel zur Demonstration seiner Macht und Stärke. Mussolini selbst formulierte es mit den Worten: "Das faschistische Italien hat die Pflicht und das Recht, die führende Nation am Mittelmeer und darüber hinaus zu sein." ([Mussolini, 1932](#)).
Die Veränderungen in der italienischen Außenpolitik wurden durch Mussolinis Machtübernahme 1922 beschleunigt. Der Faschismus sah die Wiederherstellung des römischen Imperiums als eine zentrale Ideologie und Abessinien als ein symbolisches und strategisches Ziel. Die Diplomatie der 1920er und frühen 1930er Jahre war geprägt von Italien's beständigen Versuchen, die internationale Gemeinschaft zu überzeugen, dass ihre kolonialen Bestrebungen in Afrika gerechtfertigt seien.
Ein entscheidender Moment in dieser diplomatischen Vorgeschichte war der Vertragsbruch mit dem Völkerbund. Italien war Mitglied des Völkerbundes und hatte somit ursprünglich die Verpflichtung übernommen, internationale Konflikte durch friedliche Mittel zu lösen und territoriale Integritäten zu respektieren. Doch diese Verpflichtungen wurden durch die Allianzpolitik Italiens auf doppelte Weise untergraben: einerseits durch geheime Absprachen mit Großbritannien und Frankreich und andererseits durch die systematische Destabilisierung Abessiniens, etwa durch die Unterstützung interner Rebellengruppen.
Die diplomatischen Spannungen verschärften sich weiter, als Italien 1934 einen direkten Vorwand zur Invasion suchte. Der Zwischenfall von Ual-Ual, einer Oase an der Grenze zwischen Italienisch-Somaliland und Abessinien, wurde von Italien als Beweis für abessinische Aggression dargestellt, obwohl die tatsächlichen Umstände des Zwischenfalls vielfach umstritten waren. Historiker wie Angelo Del Boca halten jedoch fest, dass "die Vorbereitungen Italiens zur Invasion längst begonnen hatten, und der Ual-Ual-Zwischenfall nur ein willkommener Vorwand war" ([Del Boca, 1996](#)).
Neben diesen direkten diplomatischen Vorstößen unternahm Italien auch intensive Propaganda-Anstrengungen, um die Invasion zu rechtfertigen. Die faschistische Rhetorik betonte wiederholt die angebliche Unterentwickeltheit Abessiniens und stellte den Krieg als eine Zivilisierungsmission dar. Zeitgenössische Medien-Berichte aus Italien malten ein Bild von Abessinien als einem rückständigen Land, das von einem autoritären und grausamen Monarchen, Kaiser Haile Selassie, regiert wurde. Diese Propaganda sollte sowohl die italienische Öffentlichkeit als auch die internationale Meinung für die bevorstehende militärische Aktion gewinnen.
Trotz dieser Versuche blieb die internationale Gemeinschaft gespalten. Einige Nationen, insbesondere Großbritannien und Frankreich, zögerten, strenge Maßnahmen gegen Italien zu ergreifen, da sie angesichts der wachsenden Bedrohung durch das nationalsozialistische Deutschland auf Mussolini als potenziellen Verbündeten setzten. Diese geopolitische Lage verschärfte die Problematik zusätzlich und führte letztlich dazu, dass der Völkerbund und andere internationale Organisationen nicht in der Lage waren, effektiv auf die italienischen Aggressionen zu reagieren.
Die diplomatischen Spannungen und das Versagen der internationalen Gemeinschaft, stark gegen Italiens aggressive Außenpolitik vorzugehen, ebneten somit den Weg für eine der düstersten Episoden der kolonialen Geschichte des 20. Jahrhunderts. Diese Entwicklungen machen deutlich, dass der Abessinienkrieg nicht nur ein isoliertes militärisches Ereignis war, sondern tief in die politischen und diplomatischen Dynamiken seiner Zeit verwurzelt ist.
Abessinien und der Völkerbund: Internationale Reaktionen und Ambiguitäten
Die von Italien 1935 ausgehende Invasion Abessiniens - dem heutigen Äthiopien - und die darauffolgende Gewaltherrschaft zeichnen sich durch eine kaum zu überbietende Grausamkeit aus. Die internationale Gemeinschaft, verkörpert durch den Völkerbund, trat in dieser schweren Krise jedoch nicht als chancenreiche Friedensmacht hervor, sondern offenbarte ihre strukturellen Schwächen und politischen Ambiguitäten.
Der Völkerbund war, in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg, als Idealbeispiel für die internationalstaatliche Kooperation gegründet worden. Die Organisation sollte die Friedenssicherung garantieren und aggressive Handlungen ächten. Die gegenwärtige Krise bot jedoch einen entscheidenden Test für die Durchsetzungskraft und Effizienz des noch jungen Völkerbundes. Um die internationalen Reaktionen auf die italienische Aggression gegen Abessinien zu verstehen, ist es notwendig, die geopolitischen, wirtschaftlichen und sozialen Aspekte jener damaligen Zeit zu beleuchten.
Italien unter dem faschistischen Diktator Benito Mussolini strebte danach, das römische Imperium wiederzubeleben und suchte gleichzeitig nach Ablenkung von innenpolitischen Problemen - die allgegenwärtige Arbeitslosigkeit und soziale Unruhen. Die Außenpolitik war stark von aggressivem Expansionismus, dem sogenannten "Spazio Vitale", geprägt. Bereits vor der Invasion hatte Italien Gebietsansprüche auf Abessinien erhoben. Trotz einer Niederlage in der Schlacht von Adua im Jahr 1896, die einen herben Rückschlag für Italiens koloniale Ambitionen bedeutete, ließ Rom nicht von seinen Plänen ab.
Die Invasion Abessiniens begann im Oktober 1935 und stieß international auf unterschiedliche Reaktionen. Eine der ersten Maßnahmen des Völkerbundes, dem Kaiser Haile Selassie I. sein Vertrauen geschenkt hatte, bestand darin, Italien als Aggressor zu klassifizieren. Eine wirtschaftliche Sanktionierung Italiens wurde beschlossen, welche jedoch durch Unzulänglichkeiten und mangelnde Einheitlichkeit einiger Mitgliedsstaaten stark abgeschwächt wurde. Im Gegensatz dazu waren führende europäische Mächte, insbesondere Großbritannien und Frankreich, stark darauf bedacht, Mussolini nicht zu stark zu verärgern, um ein mögliches Bündnis mit Nazi-Deutschland zu verhindern. Diese pragmatisch realpolitische Herangehensweise spiegelte eine Ambiguität wider, die den Völkerbund letztlich daran hinderte, effektive Maßnahmen gegen den Aggressor zu ergreifen.
Die Sanktionen erwiesen sich als ineffektiv: sie schlossen kein Öl und andere zentrale Ressourcen ein, welche Mussolini benötigte. Ein weiterer prekären Punkt war der Hoare-Laval-Pakt, ein geheimes Abkommen zwischen dem britischen Außenminister Samuel Hoare und dem französischen Premierminister Pierre Laval, das die Teilung Abessiniens vorsah, um den Konflikt zu beenden und Italien zu besänftigen. Dies Abkommen war ein Skandal, nachdem es öffentlich wurde und untergrub das Vertrauen in den Völkerbund erheblich.
Kaiser Haile Selassie I. wandte sich am 30. Juni 1936 persönlich an den Völkerbund, seine berühmte Rede endete mit dem verzweifelten Ruf: "Es ist uns, heute. Morgen wird es euch sein." Doch selbst diese eloquente und emotionale Ansprache verpuffte wirkungslos in einem internationalen Klima des politischen Kalküls und der nationalen Interessen. Wenngleich Haile Selassie später symbolisch für den unerschütterlichen Kampf gegen Kolonialismus und Unterdrückung stehen sollte, änderte diese Rede wenig an der sofortigen politischen Realität.
Die internationale Gemeinschaft - insbesondere die westlichen Demokratien - zeigten ein zögerliches und oft inkohärentes Verhalten, das größtenteils durch den Wunsch getrieben war, die Machtbalance in Europa zu sichern und eine weitere Eskalation zu verhindern. Zudem gab es Staaten, die koloniale Implikationen der Krise im südlichen Afrika fürchteten: die Südafrikanische Union und Portugal waren besorgt darüber, dass ein militärisches Vorgehen gegen Italien eine Signalwirkung auf ihre eigenen Kolonialbestände in Afrika haben und nationale Unabhängigkeitsbewegungen anstacheln könnte.
Der Völkerbund, geschaffen um Aggressionen einzudämmen und den Frieden zu bewahren, fand sich unfähig, die entscheidenden Hürden zu überwinden - fehlende militärische Macht zur Durchsetzung seiner Entscheidungen, nationale Eigeninteressen der Mitgliedsländer und Schwächen in der koordinierenden Struktur der Organisation. Die Handlungsunfähigkeit des Völkerbundes in der Abessinienkrise symbolisierte nicht nur das Versagen einer internationalstaatlichen Organisation, sondern foreshadowed auch weitere Schwächen auf dem Weg zum Zweiten Weltkrieg.
Zusammenfassend zeigen die Reaktionen des Völkerbundes und der internationalen Gemeinschaft sehr prägnant, wie nationale Interessen und geopolitische Realpolitik humanitäres Eingreifen und kollektive Sicherheitsmaßnahmen im Keim erstickten. Der Fall von Abessinien sollte als ernüchterndes Lehrbeispiel dienen, das die Widersprüche und Herausforderungen internationaler Kooperation zur Gewährleistung des Friedens offensichtlich macht.
Militärische Vorbereitungen beider Seiten
Italien und Abessinien, das heutige Äthiopien, standen sich im frühen 20. Jahrhundert in verschiedenen Aspekten diametral gegenüber. Ihre militärischen Vorbereitungen auf den kommenden Konflikt, der als Abessinienkrieg (1935-1936) in die Geschichte eingehen sollte, offenbaren die unterschiedlichen Strategien, technologischen Fähigkeiten und Ressourcen beider Seiten und verdeutlichen das ungleiche Kräfteverhältnis.
Italien, unter der faschistischen Führung von Benito Mussolini, hatte seit dem Ende des Ersten Weltkriegs seine militärischen Kapazitäten massiv ausgebaut. Die italienische Armee, bekannt als Regio Esercito, wurde modernisiert und mit neuen militärischen Doktrinen vertraut gemacht. Ein besonderer Fokus lag hierbei auf der Mobilisierung und Mechanisierung der Streitkräfte. Italien verfügte über etwa 685.000 Soldaten, die durch eine gut entwickelte Infrastruktur unterstützt wurden. Zudem standen der Armee moderne Artillerie, Panzer und Luftwaffenverbände zur Verfügung. Einer der wesentlichen Vorteile der italienischen Armee war die Effizienz der Luftwaffe, die Regia Aeronautica. Die Italiener setzten auf eine Luftüberlegenheit, die durch den Einsatz von etwa 2000 Flugzeugen gewährleistet wurde. Diese Flugzeuge, darunter Bombenflugzeuge und Jagdflugzeuge, waren entscheidend für die Durchführung von Luftschlägen, Aufklärung und Nachschubversorgung.
Abessinien dagegen war in vielerlei Hinsicht ein Agrarstaat mit rudimentären militärischen Strukturen. Der Kaiser von Abessinien, Haile Selassie I., versuchte ebenfalls, die Modernisierung seines Militärs voranzutreiben, jedoch mit ungleich geringeren Ressourcen. Die Armee Abessiniens war zahlenmäßig groß, mit etwa 500.000 Soldaten, jedoch überwiegend schlecht ausgerüstet. Die Waffen stammten oft aus dem 19. Jahrhundert, und die Soldaten waren zum Großteil Bauern, die nur sporadisch militärisch geschult wurden. Die abessinische Armee besaß nur eine begrenzte Anzahl an schweren Waffen. Die Artillerie war veraltet und kaum mit der italienischen vergleichbar. Die Kavallerie war noch ein prägender Bestandteil der Streitkräfte und spiegelte die traditionellen Militärdoktrinen wider.
Trotz dieser Disparitäten setzte Kaiser Haile Selassie auf eine Verteidigungsstrategie, die den Guerillakrieg und die Mobilität der lokalen Kriegsherren und ihrer Truppen betonte. Diese Art der Kriegsführung beruhte auf der Nutzung des schwierigen Terrains und der geographischen Gegebenheiten, die sie gegenüber einer mechanisierten Armee im Vorteil wähnte. Die Topographie Abessiniens, geprägt von Gebirgen und Hochebenen, bot natürliche Verteidigungsmöglichkeiten, welche die abessinischen Soldaten kannten und nutzen konnten.
Die Finanzen beider Länder stellten ebenfalls einen essenziellen Aspekt der Kriegsvorbereitungen dar. Während Italien auf industrieller Basis große Mengen an Kriegsmaterial produzieren konnte und auch Zugriff auf internationale Kredite und Ressourcen hatte, war Abessinien finanziell eingeschränkt. Die ökonomische Basis des Landes bot kaum Spielraum für umfangreiche militärische Investitionen. Trotz diplomatischer Bemühungen konnte Abessinien wenig externe Hilfe zur Verbesserung seiner militärischen Ausrüstung sichern. Internationale Isolation und fehlende Unterstützung seitens anderer Nationen erschwerten die Lage zusätzlich.
Die Kommunikations- und Logistiksysteme waren ein weiteres Schlüsselelement in den militärischen Vorbereitungen. Italien setzte auf eine stark zentralisierte und technisierte Organisationsstruktur, die durch moderne Kommunikationsmittel wie Funk und Telegrafie unterstützt wurde. Die italienische Infrastruktur, sowohl in Bezug auf Transport- als auch auf Versorgungslinien, war gut entwickelt. Dies ermöglichte es, Truppen schnell zu mobilisieren und zu verlegen, sowie sicherzustellen, dass Nachschub und Verstärkungen effektiv organisiert wurden.
Im Gegensatz dazu waren die Kommunikationswege in Abessinien archaisch, oft auf Boten und traditionelle Signale angewiesen. Auch die Logistikkette war stark von den geografischen und infrastrukturellen Einschränkungen des Landes geprägt. Dies bedeutete, dass die Mobilisierung von Truppen und die Versorgung oft langsamer und weniger effizient war. Die Fragmentierung der Machtstrukturen innerhalb des Landes, mit lokalen Kriegsherren, die oft semi-autonom agierten, machte eine koordinierte Verteidigung zusätzlich schwierig.
Ein weiterer bemerkenswerter Unterschied lag in der Kriegsmoral beider Seiten. Während Italien ein expansives, faschistisches Regime vertrat, das auf nationalistische Begeisterung und Propaganda setzte, bestand Abessiniens Antrieb in der Verteidigung der eigenen Souveränität und Unabhängigkeit. Die Moral der abessinischen Soldaten war oft gestärkt durch das verzweifelte Bestreben, ihr Land gegen eine koloniale Besatzung zu verteidigen.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die militärischen Vorbereitungen beider Seiten durch ein eklatantes Ungleichgewicht der Kräfte gekennzeichnet waren. Während Italien auf eine hochmoderne und mobilisierte Kriegsmaschinerie zurückgreifen konnte, waren Abessiniens Ressourcen begrenzt und stark auf traditionelle Wehrmethoden ausgerichtet. Dieses Kräftegefälle sollte sich schlussendlich auch entscheidend auf den Verlauf und Ausgang des Krieges auswirken.
Die Propaganda des Krieges: Italienische und abessinische Perspektiven
Die Propaganda spielte eine zentrale Rolle in der Mobilisierung der Massen und der Legitimation des Krieges sowohl auf italienischer als auch auf abessinischer Seite. Propaganda, als wirkungsvolles Werkzeug der politischen und militärischen Führung, half dabei, nationale und internationale Unterstützung zu sichern, Feindbilder zu schaffen und die Moral der eigenen Bevölkerung zu beeinflussen. Dieses Unterkapitel beleuchtet die Mechanismen und Strategien, die in beiden Ländern eingesetzt wurden, um die jeweilige Sichtweise des Konflikts zu propagieren.
Auf italienischer Seite war die Propaganda stark geprägt durch die faschistische Ideologie. Benito Mussolini, der italienische Diktator und Führer der Nationalen Faschistischen Partei, nutzte alle verfügbaren medialen Kanäle, um das Bild eines noblen, zivilisierenden Krieges zu verbreiten. Die Medien wurden strengt kontrolliert, und es gab eine enge Verknüpfung zwischen Staat und Presse. Zeitungen, Radiosendungen und Filmproduktionen dienten dazu, die nationalistische Rhetorik zu verstärken und das Bild eines heldenhaften Italiens zu zeichnen, das in Abessinien (dem heutigen Äthiopien) eine vermeintlich rückständige Gesellschaft befreie. Ein zentraler Aspekt dieser Propaganda war die Darstellung des italienischen Soldaten als edler Befreier, der im Namen der Zivilisation und des Fortschritts handelte.
Besondere Bedeutung kam dem „Istituto Luce“, dem staatlichen Film- und Nachrichteninstitut Italiens, zu. Dort wurden Propagandafilme produziert, die den Feldzug in Abessinien glorifizierten und die moralische Überlegenheit des faschistischen Italiens betonten. Einer der bekanntesten dieser Filme war „L'Assedio dell'Alcazar“, der die Belagerung einer Festung in Abessinien inszenierte und die heroischen Taten der italienischen Soldaten in den Vordergrund stellte. Der Film verbreitete das Narrativ der italienischen Opferbereitschaft und des heldenhaften Kampfes für die nationale Sache. Solche filmischen Darstellungen waren essenziell, um die italienische Öffentlichkeit für den Krieg zu mobilisieren und die Zustimmung für die militärischen Ambitionen Mussolinis zu gewährleisten.
Neben der filmischen Propaganda spielte auch die Printmedien eine wichtige Rolle. Zeitungen wie „Il Popolo d'Italia“, das Sprachrohr der faschistischen Partei, verbreiteten regelmäßig Berichte über angebliche Greueltaten und Barbareien der Abessinier, um die moralische Legitimation des Krieges zu stärken. Die abessinische Bevölkerung wurde dabei oft als unterentwickelt und barbarisch dargestellt, um den europäischen Kolonialismus als notwendigen Zivilisationsprozess zu rechtfertigen. Diese Darstellungen verfehlten ihre Wirkung nicht und halfen, die Kriegsbegeisterung in der italienischen Bevölkerung zu schüren.
In Abessinien selbst war die Propaganda angesichts der beschränkten medialen Möglichkeiten weniger ausgeprägt, aber nicht minder einflussreich. Der äthiopische Kaiser Haile Selassie nutzte insbesondere traditionelle Kommunikationswege wie religiöse Netzwerke und mündliche Überlieferungen, um die Bevölkerung gegen die italienische Invasion zu mobilisieren. Die kaiserlichen Dekrete und Predigten in den Kirchen spielten eine wesentliche Rolle dabei, den Abessiniern den Ernst der Lage bewusst zu machen und zum Widerstand aufzurufen.
Haile Selassie appellierte an den patriotischen und religiösen Eifer seiner Untertanen, indem er den Krieg als einen heiligen Kampf gegen die Invasoren darstellte. Er betonte die Unabhängigkeit und die historische Größe Abessiniens und rief dazu auf, die angestammten Gebiete um jeden Preis zu verteidigen. Ein entscheidender Teil dieser Propaganda war der Verweis auf die Schlacht von Adua von 1896, in der die abessinische Armee die italienischen Invasionstruppen geschlagen hatte. Diese historische Erinnerung sollte den Glauben an die Möglichkeit einer erneuten Abwehr der Italiener stärken und den nationalen Widerstandsgeist befeuern.
Im Zuge der Invasion wurde auch das internationale Ansehen des Völkerbundes zum Thema der Propaganda. Haile Selassie versuchte, die Weltöffentlichkeit auf seine Seite zu ziehen, indem er den Angriff Italiens als Verstoß gegen internationales Recht darstellte und an die früheren Zusagen des Völkerbundes erinnerte, die territoriale Integrität Abessiniens zu wahren. Seine berühmte Rede vor dem Völkerbund im Juni 1936, in der er die Untätigkeit der internationalen Gemeinschaft anprangerte und die Grausamkeiten des italienischen Kriegs beschrieb, wurde zu einem symbolischen Akt der globalen Anklage gegen den faschistischen Imperialismus.
Zusammengefasst stellt sich die Propagandakampagne im Abessinienkrieg als ein komplexes Zusammenspiel der Darstellung von Feindbildern und der Mobilisierung patriotischer sowie nationalistischer Gefühle dar. Während auf italienischer Seite die modernen Medien genutzt wurden, um ein Bild der zivilisatorischen Mission Italiens zu verbreiten, stützte sich Abessinien stärker auf traditionelle Kommunikationswege und historische Narrative, um seine Bevölkerung für den Widerstand zu gewinnen. Beide Ansätze hatten tiefgreifende Auswirkungen auf die Kriegsführung und die Wahrnehmung des Konflikts sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene.
Vorherige Konflikte: Die Schlacht von Adua und ihre Nachwirkungen
Im Kontext der italienisch-abessinischen Beziehungen des frühen 20. Jahrhunderts ist die Schlacht von Adua (1896) ein zentrales Ereignis, dessen Nachwirkungen tiefgreifende und bleibende Auswirkungen hatte. Diese in der Region als Adwa bekannte Schlacht markierte nicht nur einen bedeutenden militärischen Sieg für Abessinien (das heutige Äthiopien), sondern auch eine demütigende Niederlage für das kolonialistisch ambitionierte Italien. Die Dynamik, die aus dieser Schlacht resultierte, prägte die politische und diplomatische Landschaft beider Nationen nachhaltig.





























