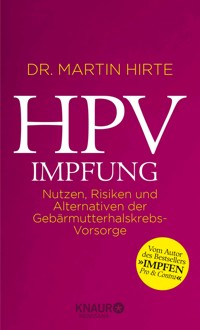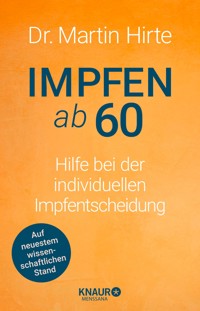
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur MensSana eBook
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Impfnavigator für Senior*innen – vom renommierten Impfexperten Da das Immunsystems mit dem Älterwerden schwächer wird, empfehlen Expert*innen zusätzliche Impfungen für Menschen ab 60. Doch welche Impfungen sind wirklich sinnvoll, welche können ruhigen Gewissens ausgelassen werden? Was sind die Risiken und Nebenwirkungen? Impfentscheidungen sind letztlich individuell, und Krankheitsrisiken abhängig vom Lebensstil und eventuellen Grunderkrankungen. Mit Pro & Contra zur individuellen Impfentscheidung Der Impfexperte Dr. Martin Hirte gibt einen Einblick in das Immunsystem von älteren Menschen, beleuchtet die Hintergründe von Impfempfehlungen und wägt Nutzen und Risiken der empfohlenen Impfungen ab: Keuchhusten, Gürtelrose, Pneumokokken, Grippe, Corona etc. Für wen sind sie sinnvoll, welche Nebenwirkungen sind möglich und wann kann auf eine Impfung verzichtet werden. Das Standardwerk mit allen Infos zu Impfungen für die Generation 60 Plus Dr. Martin Hirte bietet mit diesem aufschlussreichen Ratgeber eine fundierte und praktische Orientierungshilfe. Unter Einbeziehung der neuesten Forschungsergebnisse setzt er sich mit der Notwendigkeit und den Risiken von Impfungen auseinander. Anhand des umfassenden Überblicks über alle Impfmöglichkeiten kann man schnell und pragmatisch entscheiden, welche Impfung man für sich selbst als sinnvoll erachtet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 297
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Dr. Martin Hirte
Impfen ab 60
Hilfe bei der individuellen Impfentscheidung
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Impfnavigator für Senior*innen – vom renommierten Impfexperten
Da das Immunsystems mit dem Älterwerden schwächer wird, empfehlen Expert*innen zusätzliche Impfungen für Menschen ab 60. Doch welche Impfungen sind wirklich sinnvoll, welche können ruhigen Gewissens ausgelassen werden? Was sind die Risiken und Nebenwirkungen? Impfentscheidungen sind letztlich individuell, und Krankheitsrisiken abhängig vom Lebensstil und eventuellen Grunderkrankungen.
Mit Pro & Contra zur individuellen Impfentscheidung
Der Impfexperte Dr. Martin Hirte gibt einen Einblick in das Immunsystem von älteren Menschen, beleuchtet die Hintergründe von Impfempfehlungen und wägt Nutzen und Risiken der empfohlenen Impfungen ab: Keuchhusten, Gürtelrose, Pneumokokken, Grippe, Corona etc. Für wen sind sie sinnvoll, welche Nebenwirkungen sind möglich und wann kann auf eine Impfung verzichtet werden.
Das Standardwerk mit allen Infos zu Impfungen für die Generation 60 Plus
Dr. Martin Hirte bietet mit diesem aufschlussreichen Ratgeber eine fundierte und praktische Orientierungshilfe. Unter Einbeziehung der neuesten Forschungsergebnisse setzt er sich mit der Notwendigkeit und den Risiken von Impfungen auseinander.
Anhand des umfassenden Überblicks über alle Impfmöglichkeiten kann man schnell und pragmatisch entscheiden, welche Impfung man für sich selbst als sinnvoll erachtet.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de
Inhaltsübersicht
Einleitung: Glück und Gesundheit im Alter
Was Sie über Impfungen wissen müssen
Das Immunsystem im Alter
Medikation im Alter
Der Nutzen von Impfungen
Die Geschichte des Impfens
Die Herstellung und Zusammensetzung von Impfstoffen
Totimpfstoffe
mRNA-Impfstoffe
Die Zulassung von Impfstoffen
Die deutsche Impfkommission STIKO
Interessenkonflikte im Impfwesen
Die Impfempfehlungen im Alter
Impfen: moralische Verpflichtung?
Impfpflicht?
Die Pharmaindustrie
Der Konzentrationsprozess auf dem Impfmarkt
Interessengelenkte Impfforschung
Korruption in der Wissenschaft
Manipulierte und unterschlagene Studien
Pharmaindustrie und Medizinbetrieb
Impfnebenwirkungen
Welche Risiken haben Impfungen?
Kontraindikationen zu Impfungen
Aufklärung vor Impfungen
Die Erforschung von Nebenwirkungen vor der Zulassung eines Impfstoffs
Die Erfassung von Nebenwirkungen nach der Zulassung
Die Meldepflicht von Verdachtsfällen einer Impfnebenwirkung
Die Meldestatistik von Impfnebenwirkungen
Impfschäden
Was tun bei Impfschadensverdacht?
Zusammenfassung
Referenzen
Die empfohlenen Impfungen ab 60 Jahren
Tetanus
Die Tetanuserkrankung
Die Tetanusimpfung
Die Wirksamkeit der Tetanusimpfung
Nebenwirkungen der Tetanusimpfung
Zusammenfassung
Referenzen
Diphtherie
Die Diphtherieerkrankung
Die Diphtherieimpfung und ihre Wirksamkeit
Diphtherieantikörper und ihre Interpretation
Nebenwirkungen der Diphtherieimpfung
Zusammenfassung
Referenzen
Keuchhusten
Die Keuchhustenerkrankung
Komplikationen des Keuchhustens
Die Diagnose des Keuchhustens
Die Keuchhustenimpfstoffe
Die Impfempfehlung
Die Wirksamkeit der Keuchhustenimpfung
Erfolglose Eskalation der Impfempfehlungen
Nebenwirkungen des Keuchhustenimpfstoffs
Zusammenfassung
Referenzen
Pneumokokken (Lungenentzündung)
Pneumokokkenerkrankungen
Risikogruppen
Die Pneumokokkenimpfstoffe
Die Impfempfehlung gegen Pneumokokken
Die Wirksamkeit der Pneumokokkenimpfung
Nebenwirkungen der Pneumokokkenimpfstoffe
Zusammenfassung
Referenzen
Herpes Zoster (Gürtelrose)
Das Varicella-Zoster-Virus
Gürtelrose
Die Impfung gegen Gürtelrose
Nebenwirkungen der Gürtelroseimpfung
Zusammenfassung
Referenzen
Influenza (Grippe)
Das Influenzavirus
Die Influenzaerkrankung
Komplikationen der Influenza
Die Influenzaimpfstoffe
Impfempfehlungen gegen Influenza
Wirkung und Wirkungsdauer der Impfung
Nebenwirkungen der Influenzaimpfstoffe
Zusammenfassung
Referenzen
COVID-19
Die Krankheit COVID-19
Die Impfstoffe gegen COVID-19
Die Zulassung der COVID-19-Impfstoffe
Die Wirksamkeit der COVID-19-Impfstoffe
Die Impfempfehlungen
Nebenwirkungen der COVID-19-Impfstoffe
Zusammenfassung
Referenzen
Respiratorisches Synzytial-Virus (RSV)
Die RSV-Krankheit
Die RSV-Impfung
Die Wirksamkeit der RSV-Impfstoffe
Die Nebenwirkungen der RSV-Impfung
Zusammenfassung
Referenzen
Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME)
Die FSME-Erkrankung
Das Vorkommen der FSME
Die FSME ist nicht identisch mit der Borreliose
Die Vorbeugung und Behandlung von Zeckenstichen
Die FSME-Impfstoffe
Die Impfempfehlungen
Die Nebenwirkungen der FSME-Impfung
Zusammenfassung
Referenzen
Reiseimpfungen
Hepatitis A
Tollwut
Gelbfieber
Japanische Enzephalitis
Cholera
Typhus
Denguefieber
Chikungunya
Referenzen
Tabellen
Einleitung: Glück und Gesundheit im Alter
Wenn Sie dieses Buch lesen, so gehören Sie wohl zu den Menschen, die sich fragen, welchen Empfehlungen der präventiven Medizin man Vertrauen schenken kann. Viele der im Alter empfohlenen oder angepriesenen Maßnahmen – von Krebsfrüherkennung über regelmäßige »Check-ups« und die Einnahme von Cholesterinsenkern bis hin zu Impfungen – mögen zwar einen gewissen Nutzen haben, aber etwaige Nachteile und Risiken werden selten kommuniziert. Letztlich entscheidend ist die Frage: Verbessert sich dadurch meine Lebensqualität, lebe ich dadurch länger? Die Antwort fällt, wie ich am Beispiel der Impfempfehlungen zeigen werde, nicht immer eindeutig aus.
Insgesamt hat sich die körperliche Gesundheit der älteren Generation in den letzten Jahrzehnten deutlich verbessert. Die Menschen arbeiten weniger hart als früher, leben gesünder, sind fitter und fühlen sich jünger. Das Gefühl, alt zu werden, verschiebt sich alle vier bis fünf Jahre um ein Jahr nach hinten, und heutige 64-Jährige haben das subjektive Empfinden, dass das Altsein im Schnitt erst mit 75 Jahren beginnt (Wettstein 2024).
Die Lebenserwartung stieg seit den 1950er-Jahren bei Männern von 65 auf 78 Jahre und bei Frauen von 68 auf 83 Jahre. Selbst 85-Jährige haben heute noch eine Lebenserwartung von fünf bis sechs Jahren. Da demgegenüber die Geburtenrate sinkt, wächst der Anteil der über 65-Jährigen an der Bevölkerung stetig. Lag er 1950 noch bei 10 Prozent, beträgt er seit den 2020er-Jahren deutlich über 20 Prozent.
Entgegen der allgemeinen Vorstellung leben die meisten alten Menschen zu Hause, und viele können sich noch selbst versorgen. Nur 4 Prozent der über 65-Jährigen und 16 Prozent der über 85-Jährigen werden in Alten- oder Pflegeheimen betreut.
Alterung ist aus wissenschaftlicher Sicht kein von der Natur »geplantes« oder programmiertes Phänomen, sondern eine Begleiterscheinung der versiegenden Fortpflanzungsfähigkeit: »Es besteht kein evolutionärer Druck mehr, das weitere Überleben des Organismus zu sichern« (MPI2024). Schäden an Erbsubstanz, Zellen und Geweben häufen sich und werden nicht mehr komplett repariert, die Blutgefäße verkalken, die Entgiftungsfunktion von Nieren und Leber lässt nach. Es stellt sich das eine oder andere »Zipperlein« ein, meist Beschwerden im Bewegungsapparat und manchmal auch eine chronische Krankheit, die nicht mehr heilbar ist.
Alt werden ist also ein allmählicher Prozess. Es wird jedoch im Zusammenhang mit biografischen Ereignissen – Eintritt in den Ruhestand, Geburt von Enkelkindern, Todesfälle im Freundeskreis – oft als plötzlicher Umbruch wahrgenommen. Bei solchen Anlässen fällt vielleicht auf, dass der Gleichgewichtssinn nicht mehr so gut funktioniert oder dass das Kurzzeitgedächtnis nicht mehr so zuverlässig ist wie früher. Hinzu kommt ein allmähliches Nachlassen der Sehkraft, der körperlichen Fitness, der Energie und der Beweglichkeit. Auch wird es mühsamer, mit den immer rascheren technischen und gesellschaftlichen Veränderungen Schritt zu halten.
Im Alter werden die Menschen ängstlicher, vorsichtiger und langsamer. Sie fühlen sich verletzlicher. Dieses Gefühl wird verstärkt durch unsere von ökonomischen Interessen dominierte Gesellschaft, die alten Menschen den Verlust von Leistungsfähigkeit ankreidet und das Rentenniveau niedrig hält, um die Rentenkassen und die Wirtschaft zu schonen. Die Lebensqualität im Alter hängt jedoch nicht zuletzt von der finanziellen Sicherheit und dem Lebensstandard ab. Deutschland nimmt im europäischen Rentenvergleich einen der hintersten Plätze ein. 60 Prozent der Rentner müssen mit weniger als 900 Euro im Monat auskommen und knapp 20 Prozent gelten als armutsgefährdet, mehrheitlich Frauen. Es ist daher kein Wunder, dass zwei Drittel der jüngeren Deutschen befürchten, im Alter arm zu sein (Dlf 2024).
Dies widerspricht eklatant dem Ideal einer humanen Gesellschaft, in der jeder Mensch respektiert wird und seinen Platz hat. Die französische Philosophin Simone de Beauvoir stellt in ihrem Buch Das Alter die Frage: »Wie müsste eine Gesellschaft beschaffen sein, damit ein Mensch auch im Alter ein Mensch bleiben kann? Die Antwort ist einfach: Er muss immer schon als Mensch behandelt worden sein.« (Beauvoir 1970)
Die meisten älteren Menschen sind trotz ihrer bescheidenen Mittel mit ihrem Leben zufrieden. Viele gehen relativ gesund in Rente und haben nun Zeit für Dinge, die sie bisher aufgeschoben haben. Sie kümmern sich um Familienangehörige, meist um ihre Enkelkinder, oder finden Erfüllung in zivilgesellschaftlichem Engagement. So geben sie Erfahrung und Wissen an die nächsten Generationen weiter.
Es ist gut belegt, dass im Alter zwar manche kognitiven Funktionen schwinden, aber andere Qualitäten zunehmen: Selbstreflexion, Selbstbeherrschung, Spiritualität sowie die Fähigkeit, verschiedene Blickwinkel einzunehmen, Kompromisse zuzulassen und Grenzen des Wissens anzuerkennen – alles Eigenschaften, die als »Altersweisheit« bezeichnet werden. Sie sind weitgehend unabhängig von Intelligenz, Bildung oder sozioökonomischem Status und tragen viel zu Glück und Gesundheit im Alter bei (MDR2021).
Von Platon überliefert ist der Ausspruch des Sokrates: »Beginnt doch das Auge des Geistes erst dann scharfblickend zu werden, wenn das des Leibes seine Schärfe zu verlieren anfängt.« (Platon 1885)
Der Weisheitsforscher Igor Grossmann empfiehlt, ältere Menschen mit sozialen Schlüsselrollen zu betrauen, in denen es um juristische Entscheidungen, psychosoziale Beratung und Ausgleich zwischen Gruppen geht (Grossmann 2010). Der Philosoph Wolfgang Thorwart sieht in alten Menschen mögliche Träger gesellschaftlicher Veränderungen, denn sie haben das Privileg, nichts mehr verlieren zu können. »Nur die Radikalität des Alters kann uns retten.« (Thorwart 2017)
Mit fortschreitendem Alter spielt der Gedanke, wie viel Zeit eigentlich noch bleibt, eine immer größere Rolle. Was kann man für ein erfülltes Leben noch verändern, welches Versäumte kann man noch nachholen? Wem muss man verzeihen, bei wem muss man um Verzeihung bitten, wen muss man noch einmal umarmen? Wie soll man »die letzten Dinge« regeln?
Die abschließende Aufgabe im Leben ist die geistige und emotionale Vorbereitung auf das Sterben und den Tod. Wem es gelingt, eine Spiritualität zu entwickeln, die über den Tod hinausweist, der hat Trost gefunden und kann leichter Abschied nehmen. Der Regisseur Christoph Schlingensief schrieb kurz vor seinem Tod: »Eigentlich geht es um das Glück, geliebt zu werden und an einen Ort zu gehen, an dem man sich geborgen fühlt.« (Dlf 2020)
Was Sie über Impfungen wissen müssen
Das Immunsystem im Alter
Die Verletzlichkeit alter Menschen zeigt sich auch in der nachlassenden Leistungsfähigkeit des Immunsystems – im ärztlichen Jargon spricht man von »Immunseneszenz« (Großkopf und Simm 2022). Das Gedächtnis des Immunsystems für Infekte, die sich während des Lebens ereignet haben, bleibt zwar auch im Alter weitgehend erhalten. Betroffen von der Alterung ist aber das unspezifische adaptive Immunsystem, das die Abwehr gegen neue Erreger arrangiert. Die Thymusdrüse, in der die T-Lymphozyten ausreifen, die zuständig für die zelluläre Abwehr sind, stellt nach und nach ihren Dienst ein. Dadurch sinkt die Zahl neu gebildeter T-Lymphozyten. Im Knochenmark wird durch die Ausbreitung von Fettgewebe der Platz knapp für die Reifung der B-Lymphozyten, die für die Produktion von Antikörpern zuständig sind. Auch die Fähigkeit, Fieber zu bilden und damit Abwehrvorgänge zu unterstützen, lässt im Alter nach.
Das Ergebnis ist eine erhöhte Anfälligkeit für Infektionskrankheiten und ein längerer und unter Umständen komplizierterer Verlauf. So erkranken alte Menschen oft schwerer an Grippe oder COVID-19 und ziehen sich eher eine Lungenentzündung, einen Harnwegsinfekt oder eine Blutvergiftung (Sepsis) zu. Das alternde Immunsystem reagiert auch schlechter auf Impfungen, was deren Wirkung unsicherer macht.
Eine weitere Alterungsfolge – möglicherweise der Versuch des Organismus, den Verlust an Abwehrzellen zu kompensieren – ist die vermehrte Ausschüttung von entzündungsfördernden Botenstoffen (Zytokinen). Dadurch kann sich eine chronische niedriggradige Entzündung einstellen, das sogenannte »Inflammaging«. Es begünstigt die Entstehung von Altersdiabetes, kardiovaskulären Erkrankungen, chronisch-obstruktiver Lungenerkrankung (COPD), Rheuma und Krebs und fördert insgesamt die Altersgebrechlichkeit.
Das Immunsystem behält jedoch auch im Alter eine gewisse Lernfähigkeit, und manche Abwehr- und Gedächtniszellen sind sogar effektiver als bei jüngeren Menschen (Zöphel 2022). Wer daher auf seine Gesundheit achtet, kann ein leistungsfähigeres Immunsystem haben als jüngere Menschen, die ein stressiges Leben haben, rauchen oder regelmäßig Alkohol trinken. Ältere Menschen, die in den Jahren vor der Coronapandemie einen gesunden Lebensstil pflegten, hatten ein wesentlich geringeres Risiko für Komplikationen, Krankenhausaufenthalt oder Tod durch COVID-19 (Wang 2024).
Die Fähigkeit des Immunsystems, Krankheitserreger abzuwehren und Gesundheit zu erhalten, hat viel mit dem Lebensstil zu tun.
Auch die meisten chronischen Krankheiten sind durch die Lebensweise mitbedingt. Eine wichtige Aufgabe von uns Ärzten besteht daher darin, die Menschen zu einem gesunden Lebensstil zu befähigen:
gesunde, ausgewogene Ernährung,
tägliche Bewegung wie Spazierengehen, Radfahren oder Schwimmen,
Ruhephasen, Stressvermeidung und ausreichender Schlaf,
Vermeiden von Risikofaktoren wie Über- oder Untergewicht, Rauchen und Alkohol,
Pflege von familiären und freundschaftlichen Beziehungen, in denen man miteinander spricht, sich berührt, in den Arm nimmt.
Medikation im Alter
Mit der Lebenserwartung steigt auch die Zahl der Menschen, die an einer chronischen Krankheit leiden, etwa Bluthochdruck, Arteriosklerose, Herzschwäche, Diabetes, Arthrose, Depressionen, Demenz oder Krebs. Die vielen Millionen alter Menschen bilden einen bedeutenden und immer weiter wachsenden Absatzmarkt für die Pharmaindustrie.
Im Schnitt nehmen 60- bis 70-Jährige heute täglich acht bis neun Medikamente ein – mit unüberschaubaren Wechsel- und Nebenwirkungen. Bei Hochbetagten sind es oft sogar zehn oder mehr Arzneien (ÄZ2018). Experten beklagen die hohe Zahl ärztlicher Fehlverordnungen bei älteren Menschen. Die Mehrzahl der 80-Jährigen leidet an mindestens einem anhaltenden Begleitsymptom: Jede zehnte Krankenhausaufnahme hängt mit Arzneimittelnebenwirkungen zusammen (Dlf 2019a).
Oft werden beispielsweise starke Schmerzmittel, Psychopharmaka oder Anti-Parkinson-Mittel verschrieben, die das Denkvermögen, die Kommunikation, die Orientierung und den Gleichgewichtssinn beeinträchtigen und dadurch Unfälle und Knochenbrüche begünstigen. Psychopharmaka und die häufig verschriebenen Magensäureblocker steigern das Risiko, an einer Pneumonie zu erkranken. Die länger dauernde Einnahme von Schmerzmitteln wie Ibuprofen kann zum Herzinfarkt und zu Magenblutungen führen (Nau 2021).
Verschreibungspflichtige Medikamente gehören heute zu den häufigsten Todesursachen (Gøtzsche 2024). Gerade alte Menschen brauchen daher Ärzte, die vorsichtig und kritisch bei der Verordnung medizinischer Maßnahmen sind. Vielen alten Menschen geht es mit weniger Medikamenten deutlich besser. Für Ärzte gibt es Verzeichnisse mit Medikamenten, die bei älteren Menschen vermieden (PRISCUS-Liste) oder vorrangig verordnet werden sollten (FORTA-Liste).
Für ältere Menschen werden auch immer mehr Impfungen empfohlen, ohne dass Nutzen und Risiken in jedem Fall ausreichend abgewogen oder kommuniziert werden. Deutschland und Österreich sind bei diesen Empfehlungen in Europa international Spitzenreiter.
Mit den neuartigen mRNA-Impfstoffen gegen COVID-19 hat die Entwicklung weiter Fahrt aufgenommen. Die Hersteller arbeiten an mRNA-Impfstoffen gegen zahlreiche weitere Krankheiten und auch gegen Krebs und haben schon mal die personelle Aufstockung der STIKO gefordert (Montag 2024). In absehbarer Zukunft ist mit einer starken Zunahme der Impfempfehlungen für Senioren zu rechnen. Die Impfbereitschaft soll durch Strategien der Gesundheitskommunikation gesteigert werden – auf Neudeutsch »Nudging« (Montag 2024).
Der Nutzen von Impfungen
Das Konzept des Impfens ist bestechend: der Schutz vor schweren Krankheiten durch einen wenig belastenden medizinischen Eingriff. Es werden abgeschwächte oder abgetötete Erreger, manchmal auch nur Teile von Erregern oder ihre entgifteten Giftstoffe in den Muskel gespritzt, was dazu führt, dass das Abwehrsystem mit der Bildung von Antikörpern und teilweise auch Abwehrzellen reagiert. Dadurch entsteht eine mehr oder weniger ausgeprägte Immunität gegen den jeweiligen Krankheitserreger.
Impfkampagnen haben einem Teil der schweren Infektionskrankheiten die Zähne gezogen. Sie haben mit dazu beigetragen, dass die Pocken verschwunden sind und Diphtherie, Polio oder Masern nur noch in wenigen Ländern der Welt eine ernst zu nehmende Rolle spielen. Auch Tetanus ist überall dort, wo dagegen geimpft wird, extrem selten geworden. Als effektiv haben sich weiterhin Impfstoffe gegen Erkrankungen erwiesen, die nur in bestimmten Regionen auftreten, wie FSME (Zeckenenzephalitis), Gelbfieber, Hepatitis A oder die Japanische Enzephalitis.
Impfungen funktionieren allerdings nicht immer so, wie gewünscht:
Manche Impfstoffe haben eine sehr kurze Wirkdauer (zum Beispiel Keuchhusten, COVID-19).
Manche erzeugen zwar Antikörper im Blut, aber kaum auf der Schleimhaut (zum Beispiel Keuchhusten, Influenza, COVID-19, RSV).
Manche wirken nur gegen bestimmte Untergruppen eines Erregers, was ihre Wirksamkeit einschränkt (zum Beispiel Pneumokokken, Influenza, COVID-19).
Manche haben ein besonders hohes Risiko von Nebenwirkungen (zum Beispiel Herpes Zoster, FSME, COVID-19).
Dadurch ist das Verhältnis zwischen Nutzen und Risiko einer Impfung nicht immer eindeutig positiv, und es fehlen Studien zu der Frage, welche Impfungen wirklich zu einer besseren Lebensqualität oder einem längeren Leben führen. Ein wichtiger Aspekt der Impfentscheidung bleibt die individuelle Risikoeinschätzung durch die Betroffenen selbst.
Gegen die verheerenden Infektionskrankheiten Malaria, Tuberkulose und HIV, von denen vor allem Menschen in den ärmeren Ländern betroffen sind, gibt es bisher keine wirksamen Impfstoffe.
Die Geschichte des Impfens
Bereits um das Jahr 1000n.Chr. hatte man in China herausgefunden, dass man nach überstandenen Pocken immun gegen die Erkrankung war. So wurden Kleinkinder künstlich mit Pocken infiziert, um sie im späteren Leben vor erneuter Ansteckung zu schützen. Die mit dieser Methode verbundenen hohen Risiken erschienen bei der damals sehr hohen Kindersterblichkeit erträglich.
Schriften aus dem 18. Jahrhundert belegen, dass diese Art Impfung auch in der arabischen Medizin bekannt war. Die Methode breitete sich nach Europa aus. Man ging dazu über, Pockenimpfstoff von besonders milden Pockenfällen zu isolieren, um möglichst wenig Schaden anzurichten (Variolation). Der Erfolg war jedoch gering, die Nebenwirkungen waren oft schwerwiegend.
Am 14. Mai 1796 führte der englische Wundarzt Dr. Edward Jenner (1749–1823) an einem Jungen die erste Pockenimpfung durch, die aus dem Inhalt einer Kuhpockenpustel hergestellt war. Jenner hatte beobachtet, dass Menschen, die sich bei Kühen infiziert hatten, den Pocken gegenüber resistent waren. Sechs Wochen nach der Impfung des Jungen infizierte er ihn mit echten Pocken – ein Versuch, der heute vor keiner Ethikkommission Bestand hätte – und hatte offensichtlich Immunität erzielt, denn der Junge erkrankte nicht.
Die Pockenimpfung blieb zunächst umstritten, denn der Impfstoff war nicht standardisiert und hatte nur eine geringe Schutzwirkung (erst der im 20. Jahrhundert eingeführte gefriergetrocknete Impfstoff zeigte bessere Impferfolge). Da die Pockenerkrankung jedoch weiterhin grassierte und Zigtausende von Menschenleben forderte, wurde ab Anfang des 19. Jahrhunderts in den westlichen Ländern nach und nach die Pockenimpfung eingeführt.
Am 8. April 1874 erklärte die deutsche Regierung durch das Reichsimpfgesetz die Pockenschutzimpfung zur Pflichtimpfung. Gleichzeitig wurde die Entschädigung für Bürger garantiert, die durch die Impfung gesundheitlich beeinträchtigt wurden. Einer von 16000 erlitt nämlich schwere Nebenwirkungen, vor allem die gefürchtete Impfenzephalitis mit Todesfolge oder schwerer körperlicher und geistiger Behinderung (ÄZ2005).
Ende des 19. Jahrhunderts wurde aufgrund der Arbeiten des französischen Chemikers und Physikers Louis Pasteur (1822–1895), der Mikroben als Ursache von Krankheiten identifiziert hatte, die Entwicklung von Impfstoffen vorangetrieben. Er hatte unter anderem die Erreger der Geflügelcholera untersucht und dabei entdeckt, dass Erreger, die mehrere Wochen im Labor »vergessen« worden waren, abgeschwächt waren und nicht mehr krank machten. Die damit infizierten Hühner waren sogar vor einer späteren Choleraerkrankung geschützt. Pasteur entwickelte immunologische Modelle zur Funktion von Impfungen und erste Verfahren zur Impfstoffherstellung. Er schuf in Anlehnung an die Kuhpocken auch den Begriff »Vakzination« (vom lateinischen Wort vacca [»Kuh«]) für die Impfung mit lebenden oder toten Erregern. Das deutsche Wort »Impfung« stammt aus dem Gartenbau und leitet sich vom lateinischen imputare und griechischen emphyteúein ab, was »einpflanzen, pfropfen« bedeutet.
Die zunächst entwickelten Impfstoffe waren gegen die großen Seuchen gerichtet: Pocken (1798), Tollwut (1885), Pest (1897), Diphtherie (1925), Tuberkulose (1927), Wundstarrkrampf (1927) und Gelbfieber (1937). Bereits 1926 gab es auch erste Versuche mit einer Keuchhustenimpfung.
Die damaligen Impfstoffe waren nach heutigen Kriterien schlecht gereinigt und hatten sehr viele Nebenwirkungen. Bis zum Zweiten Weltkrieg waren Impfungen zudem nur für die bessergestellten Bevölkerungsteile in den westlichen Industrieländern erschwinglich. Die Erkrankungszahlen etwa an Tetanus gingen daher kaum zurück. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg konnten aufgrund der wissenschaftlichen Fortschritte weitere Impfstoffe, nun auch gegen andere Viruserkrankungen, entwickelt werden: Kinderlähmung (Totimpfstoff 1955, Lebendimpfstoff 1962), Masern (1964), Mumps (1967), Röteln (1970) und Hepatitis B (1981).
In den Fünfziger- und Sechzigerjahren wurden die ersten großflächigen Impfkampagnen gestartet: In Europa und den USA wurde die Polio-Schluckimpfung in allen Bevölkerungsschichten propagiert (»Schluckimpfung ist süß – Kinderlähmung ist grausam«), was zu einem dramatischen Rückgang der Erkrankungszahlen führte.
Ab 1967 unternahm die Weltgesundheitsorganisation WHO erstmalig den Versuch, eine Krankheit weltweit auszurotten: die Pocken. Überall wurde die Pockenimpfung verpflichtend, unter ständiger Überwachung von Durchimpfungs- und Erkrankungszahlen. Letztlich brachte jedoch erst die konsequente Isolierung der Erkrankten und ihrer Kontaktpersonen den Durchbruch. Im Jahr 1980 erklärte die WHO die Erde als pockenfrei, 1982 wurde in Deutschland die Impfpflicht gegen Pocken aufgehoben.
Ab dem Jahr 1974 startete die WHO weitere weltweite Impfprogramme, die »Expanded programs on immunization«. Bis dahin waren weniger als 5 Prozent der Kinder in den ärmeren Ländern der Welt geimpft worden. Nun sollten die Kinder in allen Ländern der Welt gegen Tuberkulose, Diphtherie, Tetanus, Keuchhusten, Kinderlähmung und Masern immunisiert werden. Seit den Neunzigerjahren kamen dazu noch die Impfungen gegen Hepatitis A und B, Pneumokokken, Meningokokken, Hib, Mumps, Röteln, Windpocken, Rotaviren und in betroffenen Ländern die Impfung gegen Gelbfieber.
Ein großer Erfolg dieser Impfprogramme war das Verschwinden der Kinderlähmung in der westlichen Hemisphäre in den 1990er-Jahren. Die Krankheit kommt heute nur noch in Afghanistan und Pakistan vor, mit wenigen gemeldeten Fällen. Auch der Rückgang weiterer Erkrankungen wie Diphtherie, Hib, Masern und Röteln ist in erster Linie auf die Impfungen gegen diese Krankheiten zurückzuführen. Beflügelt durch diese Erfolge hat sich die WHO die Ausrottung von Polio, Masern und Hepatitis B zum Ziel gesetzt.
Die Gefährlichkeit der meisten Infektionskrankheiten, ablesbar an den Todesfallstatistiken, war allerdings in vielen Ländern schon vor Beginn der großen Impfprogramme rückläufig. Hierzu trug vor allem der steigende Lebensstandard bei: bessere Wohnverhältnisse, bessere Ernährung, sauberes Trinkwasser.
Todesfälle durch klassische Seuchen wie Diphtherie oder Masern sind in den reichen Ländern heute eine extreme Rarität. Der Großteil der Infektionskrankheiten hat für den Einzelnen kaum noch eine Bedeutung.
Die Herstellung und Zusammensetzung von Impfstoffen
Totimpfstoffe
Um Impfimmunität zu erzielen, wird der Organismus gezielt mit bestimmten Antigenen konfrontiert. Sie bestehen aus abgetöteten Viren (FSME, Grippe, Tollwut), aus Proteinen von Krankheitserregern (Keuchhusten, Pneumokokken, Herpes Zoster, Hepatitis B) oder aus entgifteten Giftstoffen von Bakterien (Tetanus, Diphtherie).
Ein neueres Prinzip sind die genetischen Impfstoffe, die während der Coronapandemie entwickelt wurden. Sie lösen in den Zellen des Empfängers die Produktion des erwünschten Impfantigens aus.
Alle Impfstoffe für Erwachsene außer dem Reiseimpfstoff gegen Gelbfieber sind Totimpfstoffe, enthalten keine vermehrungsfähigen Erreger und werden mit einer Spritze intramuskulär verabreicht.
Die Erreger werden auf Kulturmedien unterschiedlicher Herkunft angezüchtet, etwa in Hühnerei (Grippevirus) oder Hühnerzellen (FSME, Tollwutvirus), und dann mit Chemikalien abgetötet beziehungsweise »inaktiviert«. Manche Impfantigene werden ebenso wie die mRNA-Impfstoffe gentechnisch in Hefe- oder Bakterienkulturen hergestellt (Hepatitis B, Pneumokokken, Herpes Zoster).
Trotz ausgefeilter Filtrationsverfahren lassen sich nicht alle Stoffe, die bei der Produktion eine Rolle spielen, komplett entfernen. Impfstoffe enthalten Bestandteile aus den Kulturen, etwa Proteine von Hühnerei, Hühnerembryonen oder Hefen. In manchen Impfstoffen finden sich auch Spuren von Formaldehyd oder Antibiotika. Dies kann in seltenen Fällen allergische Reaktionen hervorrufen. Besonders kritisch sind DNA-Verunreinigungen etwa in HPV- oder mRNA-Impfstoffen.
In Impfstoffen, die nur ein schmales Spektrum von Antigenen enthalten, werden Hilfsstoffe (Adjuvanzien) wie Aluminiumhydroxid zur Verstärkung der Wirkung eingesetzt, etwa in denen gegen Tetanus, Diphtherie, Keuchhusten, Hepatitis B, Pneumokokken und FSME. Die toxische Wirkung dieser Substanzen ist erst wenig erforscht. Aluminiumsalze werden nach einer Impfung in geringen Mengen im Nervengewebe abgelagert, wo sie oxidativen Stress verursachen können (Gherardi 2019, Ćirović 2021). Im Immunsystem können sie die Funktion von Zellen stören, die das Zusammenspiel des Abwehrsystems steuern (Glanz 2015, Terhune 2018). Nicht zuletzt können sie auch körpereigene Proteine als Feind »markieren«, wenn diese ähnliche Strukturen aufweisen wie das Impfeiweiß. Der britische Chemiker Christopher Exley, der seit Jahren die Wirkung von Aluminium erforscht und als »Aluminiumpapst« gilt, spricht von einer Wirkung als »indirektem Adjuvans« (Exley 2010). Bei genetischer Disposition können dadurch entzündliche Immunreaktionen und Autoimmunerkrankungen ausgelöst werden (Shoenfeld 2011, Esposito 2014).
Die WHO schreibt in ihren Leitlinien zur klinischen Bewertung von Impfstoffen:
»Während die meisten impfstoffbedingten Nebenwirkungen innerhalb von 1 bis 2 Wochen nach einer Dosis auftreten, besteht der begründete Verdacht, dass Krankheiten, die erst viele Monate nach der letzten Dosis auftreten, mit einer früheren Impfung in Zusammenhang stehen könnten. Beispielsweise besteht bei einigen starken Adjuvanzien die hypothetische Sorge, dass die Häufigkeit von Autoimmunerkrankungen in genetisch prädisponierten Subpopulationen zunehmen könnte.« (WHO2017)
Das Paul-Ehrlich-Institut spricht von einem »begrenzt bleibenden Wissensstand«. Man könne Adjuvanzien nicht generell zulassen, sondern müsse ihre Sicherheit immer zusammen mit dem jeweiligen Impfstoff beurteilen (PEI2019). Dies entbindet jedoch nicht von der Notwendigkeit, die Sicherheit der Adjuvanzien selbst eingehend zu untersuchen, denn jedes hat sein eigenes Nebenwirkungsprofil bis hin zu toxischen und autoimmunen Effekten (Doshi 2020).
mRNA-Impfstoffe
Mit der Coronapandemie wurde das Zeitalter der genetischen Impfstoffe eingeläutet. Sie bestehen nicht wie herkömmliche Impfstoffe aus einem Antigen, gegen das der Körper Antikörper bilden soll, sondern aus gentechnisch hergestellten Botenstoffen (messenger-RNA, mRNA), die den Bauplan für die Produktion von Antigen enthalten.
Bei einer Impfung werden Milliarden dieser mRNA-Moleküle, verpackt in Fett-Nanopartikel (LNP), in den Muskel gespritzt. Sie dringen in die Zellen von Muskeln, Lymphknoten, Blutgefäßen oder Körperorganen ein und geben dort das Signal zur Produktion von Impfantigen, im Fall von SARS-CoV-2 zur Produktion von dessen Spikeprotein. Körperzellen geimpfter Menschen werden praktisch zu winzigen Impfstofffabriken umfunktioniert.
Das Spikeprotein wird anschließend aus den Zellen geschleust und löst eine Abwehrreaktion aus, bei der die gekaperten Zellen von Killerzellen zerstört werden. Die Struktur des Spikeproteins wird nun an Abwehrzellen übermittelt, die Antikörper gegen das Spikeprotein bilden. Sie zirkulieren im Blut und können bei einer neuerlichen Infektion die Viren markieren und Abwehrvorgänge einleiten.
Die Theorie ist faszinierend, doch bei der praktischen Anwendung der COVID-19-Impfstoffe haben sich große Probleme ergeben.
Die Aktivität und die Verteilung der mRNA-Partikel im menschlichen Körper sind nicht unter Kontrolle. Im Herstellungsprozess werden die mRNA chemisch verändert, um sie vor der Körperabwehr zu schützen. Sie sind dadurch langlebig und bleiben nicht wie ursprünglich behauptet an der Injektionsstelle. Impf-Nanopartikel sind noch Wochen nach der Impfung im Blut oder in Lymphknoten nachweisbar und gelangen auch in Organe wie Leber, Milz, Herz, Lunge, Gehirn sowie Eierstöcke und Hoden (Merchant 2021, Röltgen 2022).
Durch die Massenproduktion der mRNA-Impfstoffe sind Reinheit und gleichbleibende Qualität nicht garantiert. Ein Teil der mRNA-Partikel ist fehlgebildet oder verkürzt (Tinari 2021, BMJ2021, BZ2022). Dadurch kommt es zu Fehlablesungen und zur massenhaften Produktion unerwünschter Proteine. Dies könnte für einen Teil der zahlreichen Nebenwirkungen verantwortlich sein (Focus 2022).
Besonders besorgniserregend ist die erhebliche Verunreinigung der mRNA-Impfstoffe mit DNA-Strängen, die sich in das menschliche Erbgut einfügen können (Demasi 2023). Mögliche Folgen sind Autoimmunangriffe auf betroffene Gewebe und das zumindest theoretische Risiko von Krebserkrankungen.
mRNA-Impfstoffe haben deutlich mehr Nebenwirkungen als konventionelle Impfstoffe, darunter auch schwere Komplikationen wie Thrombosen, Lähmungserkrankungen, Herzmuskelentzündungen und schwer fassbare Autoimmunreaktionen. Bis dato fehlen verlässliche Sicherheitsuntersuchungen. Aufgrund des enormen Zeitdrucks bei der Entwicklung wurden weder Studien zur Verteilung und zum Abbau im Körper durchgeführt noch Langzeitstudien zum Ausschluss von Auswirkungen etwa auf die Fruchtbarkeit oder die Entstehung von Krebs.
Die mRNA-Impfstoffe haben ein schlechtes Nutzen-Risiko-Verhältnis. Sie sind unausgereift und riskant.
Ungeachtet der unkontrollierbaren Risiken sind eine Reihe von mRNA-Impfstoffen in Entwicklung, etwa gegen Krankheiten wie RSV (respiratorisches Synzytial-Virus), Influenza, Zytomegalie, Herpes Zoster, Epstein-Barr-Virus, Borreliose, HIV und andere Coronaviren.
Die Zulassung von Impfstoffen
In Deutschland werden Impfstoffe durch das Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel Paul-Ehrlich-Institut zugelassen, geprüft und für den Handel freigegeben. Die Finanzierung dieser Einrichtung erfolgt aus Steuermitteln.
In Österreich wird die Zulassung durch das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG/AGES Medizinmarktaufsicht) erteilt. Sie finanziert sich hauptsächlich über Gebühren der Pharmaunternehmen für Zulassungs- oder Änderungsanträge.
Auch die Schweizerische Zulassungs- und Aufsichtsbehörde für Heilmittel Swissmedic finanziert sich zu vier Fünfteln über Gebühren der Antragsteller und über eine Umsatzbeteiligung an den von ihr zugelassenen Medikamenten.
Auf Ebene der Europäischen Union ist die EMA(European Medicines Agency) zuständig für die Impfstoffzulassung. Zwingend vorgeschrieben ist die europäische Zulassung für Impfstoffe, die gentechnologisch hergestellt sind. Auch die EMA finanziert sich über Gebühren der Antragsteller. Pikanterweise war Emer Cooke, die Präsidentin der EMA, jahrelang Lobbyistin der größten europäischen Pharmaorganisation EFPIA.
In vielen westlichen Ländern erwirtschaften die Zulassungsbehörden einen Großteil ihres Budgets durch Gebühren, die sie von der pharmazeutischen Industrie erhalten: in den USA65 Prozent, in Europa 89 Prozent und in Australien 96 Prozent. Zusätzliche Einnahmen werden durch »beschleunigte Zulassungsverfahren« generiert, die in Europa inzwischen 50 Prozent aller Neuzulassungen ausmachen.
Behörden, die sich über Gebühren der Antragsteller finanzieren, stehen in einem erheblichen Interessenkonflikt, denn sie werden von denselben Firmen alimentiert, deren Produkte sie beurteilen sollen. Viele Zulassungsbehörden arbeiten quasi als Dienstleistungsbetriebe für die Pharmaindustrie. Die Industrienähe der Behörden hat auch einen »Drehtüreffekt« zur Folge: Nach der Pensionierung arbeiten viele Beamte für die gleichen Unternehmen, die sie vorher reguliert und vermutlich geschont haben (Demasi 2022).
Die Zulassungen der COVID-19-Impfstoffe in den Jahren 2020 bis 2022 waren der Gipfel der Fahrlässigkeit. Die Politik hatte massiven Druck auf die EMA ausgeübt (n-tv 2020). Sicherheit und Wirksamkeit der Impfstoffe waren in keiner Weise ausreichend untersucht, und es dauerte Monate, bis sich die Öffentlichkeit ein Bild vom geringen Nutzen und der schlechten Verträglichkeit der Impfstoffe machen konnte.
Transparency International kritisierte das Fehlen verbindlicher Richtlinien und Vorschriften für die Veröffentlichung klinischer Studienergebnisse. So seien bei den zwanzig wichtigsten Impfstoffen gegen SARS-CoV-2 nur die Hälfte der klinischen Studien und nur 7 Prozent der Verträge veröffentlicht worden. Für 88 Prozent der registrierten Studien hätten keine öffentlich zugänglichen Protokolle vorgelegen, was bedeutet, dass wichtige Details unbekannt blieben (TI2021).
Im Grunde müssen die Behörden gesetzlich verpflichtet werden, in erster Linie den Interessen der Verbraucher und nicht denen der Pharmafirmen oder der Politik zu dienen. Nur restriktive und transparente Zulassungsbedingungen schützen die Verbraucher vor den massiven kommerziellen Interessen der Pharmaindustrie. Die Überwachung von Arzneimitteln und Impfstoffen nach der Zulassung (postmarketing surveillance) sollte einer Behörde übertragen werden, die vom Gesundheitsministerium unabhängig ist, mit der Zulassung nichts zu tun hat und somit nicht unter dem Druck steht, ihre eigenen Entscheidungen zu rechtfertigen.
Impfempfehlungen werden von der breiten Bevölkerung nur dann akzeptiert, wenn bei den Behörden die Bereitschaft erkennbar ist, Antworten auf die vielen ungelösten Fragen rund um die Anwendung von Impfstoffen zu finden. Solange immer nur von »Impfmüdigkeit« die Rede ist, fehlt dazu offensichtlich der Wille. Gerade die Debatte um die Impfpflicht und die Diffamierung und Ausgrenzung der Ungeimpften während der Coronapandemie hat dem Vertrauen in das Impfwesen immensen Schaden zugefügt.
Die deutsche Impfkommission STIKO
In Deutschland waren die Impfempfehlungen ursprünglich Sache der Bundesländer, wodurch die Impfpläne innerhalb der Bundesrepublik sehr unterschiedlich ausfielen. Das Bundesseuchengesetz legte 1961 jedoch eine Entschädigungspflicht der Bundesländer für Impfschäden durch öffentlich empfohlene Impfungen fest. Die Länder sahen sich somit genötigt, ihre Empfehlungen besser abzusichern und zu vereinheitlichen. Daher wurde 1972 die Ständige Impfkommission (STIKO) am Robert Koch-Institut (RKI) ins Leben gerufen.
Das RKI ist Leitinstitut für die Erkennung, Überwachung und Verhütung von Infektionskrankheiten und zentrale Forschungseinrichtung des Bundesministeriums für Gesundheit, vor allem auf dem Gebiet der Infektionskrankheiten.
Im Jahr 1991 beschloss die Konferenz der Gesundheitsminister, dass die Empfehlungen der STIKO künftig die Grundlage für die öffentlichen Impfempfehlungen der Länder bilden. Die gesetzlichen Kassen sind zur Kostenübernahme aller von der STIKO empfohlenen Impfungen verpflichtet.
Die Berufung der STIKO-Mitglieder erfolgt durch das »Bundesministerium für Gesundheit im Benehmen mit den obersten Landesgesundheitsbehörden« (Paragraf 20, 2 IfSG) für jeweils drei Jahre und maximal drei Amtsperioden, wobei die Berufungskriterien im Dunkeln bleiben. Die immer wieder betonte Unabhängigkeit der STIKO ist schon allein dadurch infrage gestellt. Auch die Ansiedelung der Impfkommission beim Robert Koch-Institut, das dem Gesundheitsministerium unterstellt ist, lässt an der Unabhängigkeit zweifeln.
Die STIKO-Empfehlungen dienen im Fall von haftungsrechtlichen Ansprüchen Impfgeschädigter als »vorweggenommenes wissenschaftliches Gutachten« und begründen im Schadensfall auch einen Versorgungsanspruch an den Staat (»Staatshaftung«). Voraussetzung ist allerdings, dass ein vom Paul-Ehrlich-Institut zugelassener Impfstoff verwendet wurde.
Welche geballten finanziellen Interessen auf das öffentliche Impfwesen einwirken, zeigt die Tatsache, dass Impfstoffe durch die immer umfangreicheren Impfempfehlungen zur umsatzstärksten Präparategruppe auf dem deutschen Arzneimittelmarkt geworden sind. Der Staat verdient dabei mit, indem er Mehrwertsteuer auf Impfstoffe erhebt, und unterliegt dadurch einem pikanten Interessenkonflikt.
Kritik an den STIKO-Empfehlungen kommt unter anderem aus der verfassungsrechtlichen Perspektive. Sie hätten eine vorrangig gesundheitspolitische Zielsetzung und vernachlässigten, dass zum Erreichen dieser Ziele die Gesundheit des Impflings eingesetzt werden muss. Impfnebenwirkungen würden weitgehend ausgeklammert, Impfkomplikationen als »selten« relativiert. Damit werde übersehen, dass für den Betroffenen auch seltene Risiken relevant sind. Die Impfempfehlungen erlaubten daher »keinen sachgerechten Abwägungsvorgang« und würden der gesetzlichen Informationspflicht des Staates in verfassungswidriger Weise nicht gerecht. Für den Betroffenen genüge der Hinweis nicht, sein eigener Tod oder eine dauerhafte gravierende Gesundheitsbeschädigung seien ein seltenes Ereignis (Zuck 2017).
Der Kinderarzt Stefan Nolte schrieb:
»Ziel des öffentlichen Gesundheitswesens und seiner Ausführungsorgane, in diesem Fall auch der niedergelassenen Ärzte, darf es nicht sein, Menschen zu Impfungen zu überreden und zu bedrängen, sondern für die größtmögliche Wirksamkeit und Sicherheit der Impfstoffe zu sorgen und durch rechtzeitige und umfassende Information über Nutzen und Risiken der Impfungen Überzeugungsarbeit für Impfungen zu leisten. Die pauschalen Impfempfehlungen der STIKO, die ein individuelles Impfvorgehen ausdrücklich nicht vorsehen, sollten hinterfragt und ausgedünnt werden« (Nolte 2015).
Dass die Impfempfehlungen nicht ausschließlich wissenschaftlich begründet sind, sondern auch politischem Druck gehorchen, zeigten die Empfehlungen zur COVID-19-Impfung (ÄZ2021).
In der Schweiz werden die Impfempfehlungen vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) herausgegeben. Dieses lässt sich dabei von einem Expertengremium beraten, der Eidgenössischen Kommission für Impffragen (EKIF). Sie besteht aus maximal fünfzehn Mitgliedern, die nach nicht veröffentlichten Kriterien berufen werden.
Der Impfplan in Österreich wird vom Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz in enger Zusammenarbeit mit dem Nationalen Impfgremium herausgegeben. Dieses besteht aus siebzehn Experten, die für die Dauer von jeweils drei Jahren vom zuständigen Bundesminister bestellt werden. »Die Mitglieder des Nationalen Impfgremiums üben ihre Tätigkeit persönlich, unabhängig und unentgeltlich aus.« (BMSGPK2024)
Interessenkonflikte im Impfwesen
In der STIKO befinden sich seit 2024 achtzehn Fachleute, ausnahmslos klare Impfbefürworter: Kliniker und Wissenschaftler unter anderem aus den Bereichen Immunologie, Virologie, Mikrobiologie, Pädiatrie, Gynäkologie, Allgemein- und Arbeitsmedizin. Sie sollen Interessenkonflikte auf der Website des Robert Koch-Instituts offenlegen, tun dies aber oft nur halbherzig.
Mehr als die Hälfte der STIKO-Mitglieder unterliegt gravierenden Interessenkonflikten. Einige erhalten direkte oder indirekte Forschungsförderung von Pharmaherstellern oder der Bill & Melinda Gates Foundation, andere halten pharmagesponserte Vorträge oder unterstützten in öffentlichen Ämtern die restriktiven Pandemiemaßnahmen von Bund und Ländern (Montag 2024, Hirte 2024).
Praktische Erfahrung scheint bei der Berufung zur STIKO nicht ausschlaggebend zu sein, denn es sind nur zwei niedergelassene Ärzte vertreten. Patientenvertreter fehlen völlig. Seit 2024 sind dagegen zwei Experten aus den Bereichen Modellierung und Kommunikation vertreten. Dabei dürfte die Absicht Pate gestanden haben, neue Impfstoffe auch etwa auf der unpopulären mRNA-Basis möglichst schnell und reibungslos unter die Leute zu bringen.
Alexander Konietzky vom Verein Ärztinnen und Ärzte für individuelle Impfentscheidung kritisierte:
»Offensichtlich bestand bei der Neubesetzung der STIKO kein Interesse, die Bedürfnisse von Patientinnen und Patienten wirklich ernst zu nehmen. Stattdessen baut man jetzt auf kommunikative Tricks, um darüber hinwegzugehen. Beeinflussung mittels Nudging tritt an die Stelle von evidenzbasierter Aufklärung und individueller Beratung. […] Die Bevölkerung und die Ärztinnen und Ärzte in Deutschland sollten sich endlich von der Vorstellung verabschieden, bei der STIKO handele es sich um eine Einrichtung, die unabhängig agiere und vorrangig das Patientenwohl im Auge habe.« (ÄFI2024)
Interessenkonflikte bestehen nicht nur in der deutschen Impfkommission. In praktisch allen Ländern der Welt und bis in die Spitze der Weltgesundheitsorganisation WHO hinein werden Impfexperten finanziell von der Industrie »umarmt«.
Interessenkonflikte der Schweizer Kommission für Impffragen EKIF sind nachzulesen auf der Website des Bundesrats unter dem Stichwort »Interessenbindungen«. 2024 saßen fünf der vierzehn EKIF-Mitglieder im Beirat von VacUpdate, einer Organisation, deren Impfveranstaltungen unter anderem von GlaxoSmithKline, MSD, Pfizer und Sanofi-Pasteur gesponsert werden. Der EKIF-Vorsitzende war im Vorstand von VASAS, einer Interessengemeinschaft, die von GSK und AstraZeneca gesponsert wird.
Die Mitglieder des österreichischen Nationalen Impfgremiums geben zwar regelmäßig Erklärungen zu Interessenkonflikten ab, diese bleiben aber unter Verschluss; eine Information der Öffentlichkeit ist nicht vorgesehen. Das zeugt von einem seltsamen Demokratieverständnis, denn die Bürger hätten als Erste ein