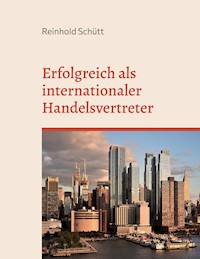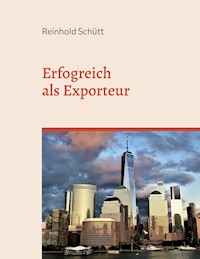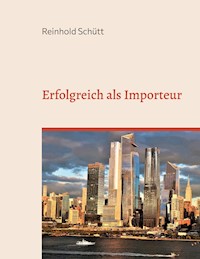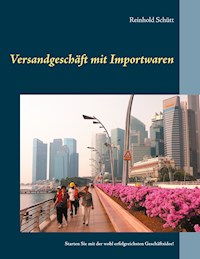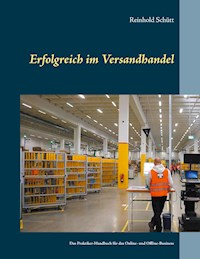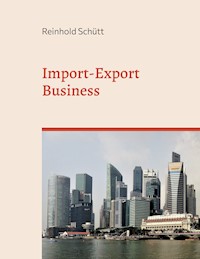
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Am Beispiel eines real existierenden Außenhandelsunternehmens zeigt Ihnen der Autor in einfach lesbarer Form, wie Sie sich aus kleinsten Anfängen und ohne großen Kapitaleinsatz Ihr Außenhandelsunternehmen aufbauen können. Sie finden anschauliches, praktisches Arbeitsmaterial, bestehend aus Musterbeispielen, Checklisten und Arbeitslisten unter anderem zu folgenden Themen: - Suche von Import- und Exportgelegenheiten, - Anbahnung und Abwicklung von Außenhandelsgeschäften, - Abschluss von internationalen Kaufverträgen, - Bearbeitung von finanz- und zollwirtschaftlichen Themen und - Vermeidung von Risiken bei Außenhandelsgeschäften. Mit dem Wissen dieses Wegweisers und den vielen Tipps aus der Praxis sind Sie in der Lage, Ihre ersten Außenhandelsgeschäfte ohne Risiko anzubahnen und abzuwickeln. Es erspart Ihnen viel Lehrgeld und bewahrt Sie vor so manchem Missgeschick. Inhaltsverzeichnis Teil I: Ihr Weg zum ersten Kaufvertrag Kapitel 1: Von der Vergangenheit in die Gegenwart Kapitel 2: Erste Schritte Kapitel 3: Informationsquellen Kapitel 4: Wahl Ihrer Handelswaren Kapitel 5: Geschäftspartner und Außenhandels-Politik Kapitel 6: Preisbildung und Preiskontrolle Kapitel 7: Verkauf Ihrer Handelsware Kapitel 8: Von der Anfrage zum Kaufvertrag Teil II: Fachwissen zum Außenhandel Kapitel 9: Internationales Vertragswesen Kapitel 10: Lieferbedingungen (Incoterms) Kapitel 11: Transport, Verpackung, Versicherung Kapitel 12: Transportdokumente Kapitel 13: Handelsdokumente Kapitel 14: Zahlungsbedingungen Kapitel 15: Internationaler Zahlungsverkehr Kapitel 16: Finanzierung und Zahlungssicherung Kapitel 17: Innergemeinschaftliche Warenverkehr Kapitel 18: Zoll - Einfuhr aus Nicht-EU-Staaten Kapitel 19: Zoll - Ausfuhr in Nicht-EU-Staaten
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 305
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vorwort
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Deutschlands Wirtschaft ist in allen Branchen stark mit der Weltwirtschaft verflochten. Ohne den Import und Export hätten viele Unternehmen keine Überlebenschancen. Auch unser hoher Lebensstandard und unser persönliches Wohlergehen sind ohne den Import und Export kaum vorstellbar. Fast jeder dritte Arbeitsplatz hängt direkt oder indirekt von ihm ab.
Ich kenne keine Branche unserer Wirtschaft, die Ihnen als Selbstständiger, Unternehmer oder Gründer so viele interessante und lukrative Geschäftsmöglichkeiten wie der Außenhandel bietet. Hier können Sie Ihr Warensortiment mit hochwertigen Importwaren erweitern, neue Märkte für Ihre Exportwaren erschließen und sich aus der einseitigen Abhängigkeit von Vorlieferanten und Großabnehmern lösen.
Vor diesem Hintergrund will ich Ihnen mit meinem „Import-Export Business“ helfen, die vielen Risiken und Schwierigkeiten des internationalen Handels zu erkennen und in den Griff zu bekommen. Mein Buch soll Ihnen als Unternehmer oder Gründer ein praxisnaher Begleiter und Ratgeber sein, der es Ihnen erlaubt, aus kleinsten Anfängen und ohne großes Risiko die internationalen Märkte mit Ihrem eigenen Unternehmen erfolgreich zu erschließen.
Ich hoffe, dass auch Sie in wenigen Jahren zu den vielen Lesern meiner Bücher gehören, denen das mit großem Erfolg gelungen ist. Ich wünsche Ihnen Freude und Erfüllung bei Ihrer Tätigkeit.
Ihr Reinhold Schütt
Inhaltsverzeichnis
Teil I: Ihr Weg zum ersten Kaufvertrag
Kapitel 1: Von der Vergangenheit in die Gegenwart
Kapitel 2: Erste Schritte
Kapitel 3: Informationsquellen
Kapitel 4: Wahl Ihrer Handelswaren
Kapitel 5: Geschäftspartner und Außenhandelspolitik
Kapitel 6: Preisbildung und Preiskontrolle
Kapitel 7: Verkauf Ihrer Handelsware
Kapitel 8: Von der Anfrage zum Kaufvertrag
Teil II: Fachwissen zum Außenhandel
Kapitel 9: Internationales Vertragswesen
Kapitel 10: Lieferbedingungen (Incoterms)
Kapitel 11: Transport, Verpackung, Versicherung
Kapitel 12: Transportdokumente
Kapitel 13: Handelsdokumente
Kapitel 14: Zahlungsbedingungen
Kapitel 15: Internationaler Zahlungsverkehr
Kapitel 16: Finanzierung und Zahlungssicherung
Kapitel 17: Innergemeinschaftliche Warenverkehr
Kapitel 18: Zoll – Einfuhr aus Nicht-EU-Staaten
Kapitel 19: Ausfuhr in Nicht-EU-Staaten
Stichwortverzeichnis
Teil I: Ihr Weg zum ersten Kaufvertrag
Kapitel 1: Von der Vergangenheit in die Gegenwart
Seit Jahrtausenden sind Angebot und Nachfrage nach Waren in vielen Ländern der Welt sehr unterschiedlich. Deshalb kamen Menschen schon vor Tausenden von Jahren auf den Gedanken, hier einen Ausgleich zu schaffen. Sie haben Waren ausgeführt (Export), nach denen im Ausland eine hohe Nachfrage bestand und umgekehrt Waren eingeführt (Import), nach denen bei ihnen eine hohe Nachfrage bestand.
Ein Blick in die spannende, kurze Geschichte des deutschen Außenhandels liefert dazu viele Beispiele. Am bekanntesten ist wohl die Preisentwicklung beim Öl. Der Weltmarkt und die Börsen reagieren sofort mit erheblichen Preisschwankungen, wenn die politische Lage in produzierenden Ländern wie Saudi-Arabien oder Kuwait instabil wird. Die Ölpreise können dann rasant schnell steigen. Besteht umgekehrt ein Überangebot bei sinkender Nachfrage, kann der Ölpreis genauso schnell sinken.
Der deutsche Außenhandel entwickelte sich nicht kontinuierlich, sondern wurde in den letzten 150 Jahren von einem ständigen Auf und Ab begleitet, das manchmal auch einen Nullpunkt erreichte. Davon erholte er sich jedoch in der Regel sehr schnell, weil Waren „Made in Germany“ bis heute im Ausland sehr beliebt sind und deutsche Kaufleute in der Welt wegen ihrer Tüchtigkeit und vor allem wegen ihrer Zuverlässigkeit hochgeachtet sind.
Die ältesten und bekanntesten Beispiele für erfolgreiche Außenhandels-Unternehmen sind im Süden Deutschlands die Familienunternehmen der Fugger und der Welser. Im Norden entwickelten sich keine vergleichbaren Unternehmen. Hier entstand allerdings mit der Hanse eine Handelsorganisation, in der sich bekannte und erfolgreiche Kaufleute zur Wahrung ihrer internationalen Interessen auf freiwilliger Basis zusammentaten.
Die Fugger
Der Grundstock für den Reichtum der Fuggerfamilie wurde Mitte des 15. Jahrhunderts mit dem Leinen- und Tuchhandel gelegt. Jacob Fugger, das bekannteste Mitglied des Hauses Fugger, erwirtschaftete den größten Teil seines Reichtums allerdings mit der Fugger-Bank, die er im Jahre 1486 gründete. Sie war immer dann zur Stelle, wenn es galt, die Ausbeutung von Minen zu finanzieren, Märkte für die Rohstoffe zu erschließen und technische Artikel für den Bergbau zu liefern. Als Gegenleistung erwartete die Bank eine Gewinnbeteiligung. Das Augsburger Handelshaus besaß Rechte an Minen in Böhmen, Schlesien, Tirol, der Slowakei und vielen anderen Orten Europas.
Die Fugger versorgten die Europäer mit Kupfer, Silber, Blei und Salz. Ihre Einnahmen investierten sie in andere gewinnversprechende Unternehmen. Dazu gehörte auch die Politik. Die Rückzahlung bestand aus Privilegien, Patenten, Marktrechten, Monopolen und Verträgen. Das wohl bekannteste Privileg war der Verkauf der geistlichen Ablässe, von dem allerdings auch der erste Schlag gegen das Handelsimperium ausging.
Nachdem sich Martin Luther gegen den Ablassverkauf aufgelehnt hatte, wurden kaum noch Einnahmen aus diesem einst so lukrativen Geschäft erzielt. Viele kirchliche und weltliche Schuldner konnten deshalb ihren Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen. Als Folge davon brachen die meisten Finanz- und Handelskonzerne zusammen, darunter auch die Fugger.
Die Welser
Seit dem 13. Jahrhundert lebten die Welser als ein bekanntes Patriziergeschlecht in Augsburg. Wie bei den Fuggern wurde der Grundstock ihres Reichtums durch den Textilhandel gelegt. Die von Anton Welser 1498 gegründete „Große Augsburger Handelsgesellschaft“ mit Zweigniederlassungen in allen europäischen Wirtschaftsmetropolen widmete sich in erster Linie dem europäischen und asiatischen Außenhandel. 1525 kam der Handel mit dem spanischen Teil Südamerikas dazu. 1528 verlieh Karl der V. den Welsern sogar das Recht zur Kolonisation Süd-Amerikas.
Die Welser werden zu Recht als die ersten deutschen Außenhändler bezeichnet, die einen weltweiten Handel betrieben. Als Frankreich, Spanien und die Niederlande ihren Zahlungsverpflichtungen gegenüber den Welsern nicht mehr nachkamen, erlitt das Augsburger Handelshaus beträchtliche Verluste und ging 1614 schließlich in Konkurs.
Die Deutsche Hanse
Was die unheilbar individualistischen Franzosen und Italiener nie lernten, dass Einigkeit stark macht, wussten die deutschen Kaufleute schon zu Beginn ihrer Karriere im internationalen Handel. Von Lübeck aus (1158) breitete sich die Hanse aus einem Geist der gemeinsamen Stärke zügig über den Nord- und Ostseeraum aus. Sie war ein seltsames Phänomen, das aber schnell einen gewaltigen Einfluss auf Europa ausübte.
Zunächst war die Hanse lediglich eine freiwillige Vereinigung von Kaufleuten. Aus ihr entstand dann eine Vereinigung mit dem Zweck, den Außenhandel zu fördern. Es dauerte nicht lange und es wurden in vielen Städten diese freiwilligen Vereinigungen von Kaufleuten gegründet. Aufgrund ihrer wirtschaftlichen und auch politischen Macht stand der Begriff Hanse schließlich für die Privilegien und Monopole ihrer Mitglieder. Doch zwei Elemente gehörten immer zu den Grundfesten der Hanse: das Element des Bundes und das Element des Handels.
Trotz ihrer Reichweite und Macht konnte die Hanse nur einen Teil des Umsatzes der italienischen Städte erzielen. Die Italiener handelten mit hochwertigen Luxuswaren wie Gewürzen, Weinen, Brokat, Juwelen, Seide, Tuchen, Keramik und Waffen, wohingegen sich die Hanse mit bescheideneren, aber nützlichen Waren begnügte: Eisen und Kupfer aus Schweden, Wachs, Felle und Leder aus Russland, Heringe und Salzfische aus Norwegen, Getreide, Holz, Flachs, Wolle, Bier, Pech und Teer aus den Ostseeländern.
Die politische und wirtschaftliche Macht der Hanse und ihr Einfluss auf große Gebiete zwischen Skandinavien, England und Russland war weitaus bedeutender als der Einfluss der italienischen Hafenstädte auf die Mittelmeerländer. Venedig und Genua träumten Jahrhunderte von einem mächtigen Handelsreich, die Hanse war ein mächtiges Handelsreich.
Es waren die Niederländer und die Engländer, die mit der Hanse in einen starken Wettbewerb traten. Die hanseatische Handelsflotte, die im Wesentlichen aus deutschen Schiffen bestand, war bis Anfang des 16. Jahrhunderts die größte in Europa. Sie wurde dann von der Flotte der Niederländer und schließlich von der der Engländer überholt. Der Dreißigjährige Krieg gab der Hanse beinahe den Todesstoß. Den letzten Hansetag besuchten 1669 von den einst mehr als 200 Städten nur noch neun. Danach wahrten nur noch Hamburg, Lübeck und Bremen die Tradition der Hanse. Sie hatten sich 1630 zu einem engeren Bund zusammengeschlossen.
Kommerzielle Techniken
Von der Hanse sind viele kommerzielle Techniken und Abwicklungsverfahren übriggeblieben, ohne die die wirtschaftlichen Erfolge der Hanse undenkbar gewesen wären. Zu den Errungenschaften gehören Rechnungen, gemünztes Geld, Akkreditive, Gebühren, Verträge, Buchführung, Kalkulation und Finanzierungsmethoden. Vieles davon prägt noch heute den Außenhandel und wird in diesem Buch noch ausführlich besprochen.
Es wurden auch Wege gefunden, das Zinsverbot der Kirche zu umgehen und Möglichkeiten, die privilegierten Herrscherhäuser zu finanzieren. Dieses brachte der Wirtschaft das seltsame und gefährliche Papiergeld als Erbe ein, das kaum zu kontrollieren war. Schnell war das Geld gedruckt, um so teure Kriege oder aufwendige Bauten zu finanzieren. Die Wirkung dieser Neuerung war ebenso verführerisch wie der Reiz des südamerikanischen Goldes oder des chinesischen Opiums auf Europa.
Der „Ehrbare Hanseatische Kaufmann“
Von großer Bedeutung waren die ungeschriebenen Verhaltensregeln (Handelskodex) der Hanse, die kein „Hanseatischer Kaufmann“ ungestraft verletzen durfte. Sie waren geprägt von kaufmännischer Solidität, zu der Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, Einfachheit, Wahrhaftigkeit, Treue und Ehrlichkeit gehörten. Der Handelskodex bezog sich auch auf die Privatsphäre eines „Hanseatischen Kaufmanns“.
Das Leitbild des „Ehrbaren Hanseatischen Kaufmanns“ wurde immer wieder dem Zeitgeist angepasst. Heute wird es geprägt von der sozialen und wirtschaftlichen Verantwortung gegenüber Mitarbeitern, Kapitalgebern, Lieferanten, Kunden und der Öffentlichkeit. Zum Leitbild gehört auch ein Bekenntnis zu den Menschenrechten, zum System der Sozialen Marktwirtschaft, zum Staat und zur Umwelt. Seine Tradition wird heute in der „Versammlung eines Ehrbaren Kaufmanns zu Hamburg e.°V.“ gepflegt. Ihre Wurzeln gehen auf das Jahr 1517 zurück. Die Versammlung ist zurzeit mit rund 1.200 persönlichen Mitgliedern die größte werteorientierte Wirtschaftsvereinigung Deutschlands.
Viele Geschäftsbeziehungen im Außenhandel werden auch heute noch vom Leitbild des „Ehrbaren Hanseatischen Kaufmanns“ geprägt. Ich empfehle Ihnen, sich bei Ihren geschäftlichen Aktivitäten an diesem Leitbild zu orientieren, um daraus dann eine eigene Unternehmens-Philosophie zu entwickeln.
Gemessen an seiner historischen Bedeutung ist der Handelsumfang in der frühen Geschichte des deutschen Außenhandels zahlenmäßig eher bescheiden. Im Jahr 1368 haben beispielsweise nur 870 Schiffe mit einer wertmäßigen Ladung von 5.000 Reichsmark Silber den Lübecker Hafen in Richtung Ausland verlassen. Das entspricht etwa 2,5 Millionen Euro.
Erst nach der Niederlage von Napoleon bei der Völkerschlacht bei Leipzig und dem Wiener Kongress, der im Jahr 1815 die Grenzen in Europa neu festlegte, gelang es hanseatischen Kaufleuten, sich auf breiter Ebene wieder in den Welthandel einzuschalten. Sie erwarben Territorien in fernen Ländern, die sie kolonisierten und als Rohstoffquellen und Absatzmärkte nutzten. So zum Beispiel im Jahr 1871 Togo durch die Bremer Familie Vietor und im Jahr 1883 Deutsch-Südwest-Afrika (heute Namibia) durch den Bremer Kaufmann Lüderitz.
Die Zeit bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts
Deutschland war noch bis Mitte des 19. Jahrhunderts mit kleinstaatlichen Reglementierungen und Wirtschaftsstrukturen belastet, die die Entwicklung der deutschen Wirtschaft stark behinderte. Im Vergleich zu vielen anderen Ländern wie beispielsweise Großbritannien und Belgien war die deutsche Wirtschaft sehr rückständig.
So hemmten Ende des 18. Jahrhunderts 1.800 Zollschranken den Handelsverkehr in Mitteleuropa; allein in Preußen gab es 67 lokale Zolltarife und ebenso viele Zollgrenzen. Ein-, Aus- und Durchfuhrzölle, vor allem aber Ein- und Ausfuhrverbote, dienten dem rigorosen Schutz der einheimischen Waren.
Vor 200 Jahren war Deutschland keineswegs dazu prädestiniert, heute zu den größten Handelsnationen zu gehören. Gekennzeichnet durch eine fast rein agrarische Wirtschaftsstruktur hatte Deutschland, verglichen mit Großbritannien, nur geringen Anteil an den technischen Veränderungen und revolutionären Spannungen, die Ende des 18. Jahrhunderts aufbrachen.
Deutschland im Zentrum von Europa stellte allerdings mit seinen 20 Millionen Menschen ein bedeutendes Wirtschaftspotenzial dar. Schlechte Straßen, weite Entfernungen zwischen den einzelnen Wirtschaftsstandorten, unregulierte Wasserwege und seichte Kanäle verhinderten, dass es aus den Vorteilen seiner geografischen Lage, seinem Reichtum an Bodenschätzen und landwirtschaftlichen Rohstoffen Nutzen ziehen konnte. Politisch gespalten hatte Deutschland keine Chance, größere Marktorganisationen aufzubauen.
Das änderte sich erst, als die in Großbritannien mit großem wirtschaftlichem Erfolg praktizierte kapitalistische Industrialisierung (industrielle Revolution) auch im deutschsprachigen Raum Eingang gefunden hatte. Deutsche Unternehmer hatten die Smith`schen Lehren aufgenommen und erkannt, dass die modernen Fertigungsprozesse nur mit groß angelegten Industriegründungen zu bewältigen waren – allerdings mit einer Verzögerung von mehr als 100 Jahren gegenüber Großbritannien.
Die Zeit bis zum 1. Weltkrieg
Anfang der achtziger Jahre des 19. Jahrhunderts entwickelte sich Deutschland immer mehr von einem Agrarstaat in einen Industriestaat mit einem bedeutenden Außenhandels-Volumen, das um die Jahrhundertwende größer war als das von Frankreich und Großbritannien. Im Jahr 1913 errang die chemische Industrie Deutschlands mit einem Export von 125 Millionen Mark erstmals Weltgeltung. Die deutsche Elektroindustrie hatte im gleichen Jahr mit 120 Millionen Mark Jahresumsatz die englische Spitzenposition überflügelt.
Auch mit dem Export von technischen Anlagen erzielten die deutschen Unternehmen große Exporterfolge. So waren deutsche Gesellschaften beim Bau von Eisenbahnen in vielen Teilen der Welt vertreten. Die Gotthard-Bahn, die Bagdadbahn und die Bahnen in Afrika und Süd- und Mittelamerika wurden unter nennenswerter Mitwirkung deutscher Unternehmen gebaut. Sie beteiligten sich auch an Bergwerksgesellschaften in Afrika, Asien, im Nahen Osten und in Russland, um den Import von Rohstoffen sicherzustellen. Dazu kamen noch Bankgründungen in Südamerika, im Fernen Osten, in Russland und in ganz Europa. Der erste große Anlauf zur Internationalisierung der deutschen Wirtschaftsaktivitäten in der Neuzeit war damit eingeleitet.
Über die Gründe dieser deutschen Exporterfolge wird heftig diskutiert und gerätselt. Sicherlich importierten deutsche Unternehmer das englische Know-how beim Bau ihrer Fabriken und bei der Organisation der Fertigungsprozesse. Hier wurden auch viele importierte Maschinen eingesetzt. So konnten die Waren jetzt in großen Mengen sehr kostengünstig hergestellt werden, nur waren sie damit noch nicht verkauft.
„Made in Germany“
Wie auch viele andere Wirtschaftshistoriker sehe ich den Beginn der deutschen Exporterfolge im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts. Am 23. August 1887 verabschiedete das britische Parlament mit dem „Merchandise Marks Act“ einen Vorschriftenkatalog, der allen Importwaren für England eine Herkunftsbezeichnung („Made in …“) auferlegte. Ursprünglich war sie als „Kainsmal“ für die aufstrebende Konkurrenz vom Festland gedacht, um damit britische Käufer vor der angeblich schlechten Massenware zu warnen.
Sehr schnell verwandelte sich das „Made in Germany“ jedoch zu einem Synonym für solide Verarbeitung mit einem hohen Qualitätsstandard. Dieses Markenzeichen „Made in Germany“ für deutsche Waren verbreitete sich sehr schnell auf der ganzen Welt und wurde von Unternehmern geschickt für ihre Verkaufspolitik genutzt. Ein besseres und kostengünstigeres Marketing für deutsche Waren kann ich mir in der damaligen Zeit kaum vorstellen.
Natürlich sind die Exporterfolge auch auf das damals sehr niedrige Lohnniveau und den hohen technischen Ausbildungsstand der Arbeiter und Angestellten zurückzuführen. Daneben waren es die modernen Fabriken und die sehr flexible Industriestruktur, die eine rasche Umsetzung wissenschaftlicher Erkenntnisse in die Praxis ermöglichte.
Doch je mehr die deutsche Wirtschaft für den Weltmarkt produzierte, desto mehr zeigte sich ihre Abhängigkeit von ausländischen Rohstoffquellen. Das Ausland begann auch die Expansion der deutschen Wirtschaft auf den Weltmärkten immer kritischer zu sehen und rückte zusammen, um dem jungen Wirtschaftsriesen wieder mit Handelshemmnissen Einhalt zu gebieten. Der ausbrechende Erste Weltkrieg setzte einen Punkt hinter dieses Kapitel deutscher Wirtschaftsdynamik.
Die Zeit bis zum 2. Weltkrieg
Doch paradoxerweise liefen nach 1918 die Industrie und der Export Deutschlands bald wieder auf Hochtouren: Deutschland war von den Siegermächten gezwungen worden, die Kriegsreparationen gegen eigene Exporte zu verrechnen, also ohne jede Gegenleistung. Es blieb nichts anderes übrig, als zu produzieren und zu exportieren, ohne dabei den eigenen Bedarf nur im Geringsten befriedigen zu können. Aus Mangel an Devisen wurden kaum Waren importiert.
Das verursachte in der Folge rasende Inflationsraten, bis 1924 der Dawes-Plan der geschüttelten deutschen Wirtschaft eine Verschnaufpause gewährte. Die darin beschlossene Aussetzung der deutschen Reparationsleistungen ermöglichte es, dass die deutsche Wirtschaft bereits 1927 wieder eine Exportquote erwirtschaften konnte, die um 7 Prozent höher war als die von 1913.
Die Weltwirtschaftskrise von 1929 wirkte sich kaum auf den deutschen Außenhandel aus. Er setzte seine Expansion bis 1936 fort und endete, als die Nationalsozialisten die deutschen Industrieunternehmen auf Rüstung umstellten. Ab jetzt musste alle Wirtschaftskraft den Wahnvorstellungen von Adolf Hitler unterstellt werden.
Zwangsläufig wurde jetzt immer weniger exportiert. Das Gleiche traf auch für die Importe zu, denn die Nationalsozialisten wollten vom Ausland unabhängig werden. Die diktierte Selbstversorgung hatte aber eine wichtige positive Seite, wenn von den kriegerischen Zielsetzungen abgesehen wird: Mit staatlicher Unterstützung investierten Unternehmen sehr viel Geld in die Forschung und in die Entwicklung und errangen schnell die Führung in kriegswichtigen Forschungsleistungen und innovativer Waren (Waffen).
Am Ende des Zweiten Weltkrieges lagen die meisten Industriebetriebe in Schutt und Asche. Im April 1945 brach die einheitliche Wirtschaftsorganisation des Großdeutschen Reiches zusammen. Einen Außenhandel gab es so gut wie nicht mehr.
Die Bundesrepublik als Handelsnation
Nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich die deutsche Außenwirtschaft überraschend schnell erholt. Abgesehen von kleinen Dellen in dieser Entwicklung, wurden ab 1952 ständig wachsende Ausfuhrüberschüsse erzielt. Von 2003 bis 2008 war Deutschland sogar Exportweltmeister.
Dieser Titel ist inzwischen an China übergegangen. Einen Grund zur Beunruhigung gibt es nicht. Das wirtschaftliche Potenzial der chinesischen Volkswirtschaft mit 1.300 Mio. Menschen ist größer als eine mit 82 Mio. Menschen. Nachdem die Weltwirtschaftskrise 2008/2009 überwunden war, startete die deutsche Wirtschaft mit einem glänzenden Comeback durch. Sie ist fit für die globalisierte Wirtschaft wie nie zuvor und hat alle Chancen, in den kommenden Jahrzehnten von den anhaltenden globalen Megatrends überproportional zu profitieren.
Gründe für das Scheitern
Viele Unternehmen haben mit großem Optimismus und beachtlichen Anfangserfolgen Waren auf den Weltmärkten exportiert und importiert, sind dann aber gescheitert und haben viel Geld verloren. Nach meinen Beobachtungen wollten sie mit ihren Waren viel zu schnell und unsystematisch auf unbekannten Märkten Fuß fassen oder haben die Außenhandelsrisiken völlig falsch bewertet. Andere Fehlerquellen waren:
Wegen falscher Markteinschätzungen wurden Absatz- und Beschaffungschancen maßlos überbewertet.
Die lange Anlaufzeit von Außenhandels-Geschäften und die damit verbundenen Kosten wurden unterschätzt.
Außenhandels-Geschäfte wurden abgeschlossen, ohne sich gegen die damit verbundenen Risiken abzusichern.
Um Anwaltskosten zu sparen, wurden falsche und völlig unzureichende Verträge abgeschlossen.
Mögliche Hilfen und Ratschläge von Banken, Kammern, Spediteuren und Beratern wurden überhaupt nicht oder zu spät in Anspruch genommen.
Das Management, die Mitarbeiter und die interne Organisation waren für Auslandsgeschäfte ungeeignet.
Die Freude über einen Geschäftsabschluss schränkte das Blickfeld ein; vertragliche Vereinbarungen wurden im rechtlichen Blindflug gebastelt.
Exporte
Die Handelsbeziehungen zwischen Deutschland und seinen Partnern in der Europäischen Union (EU) sind sehr eng. Fast zwei Drittel aller Exporte im Wert von 1.317 Mrd. Euro gingen im Jahr 2021 in diese Länder. Die wichtigsten Kunden innerhalb der Europäischen Union waren die Franzosen mit 102 Mrd. Euro, die Niederlande mit 100 Mrd. Euro und Polen mit 78 Mrd. Euro. Die wichtigsten Kunden außerhalb der Europäischen Union waren die Vereinigten Staaten mit 122 Mrd. Euro und die Volksrepublik China mit 104 Mrd. Euro
Besonders stark sind die deutschen Hersteller von Kraftwagen und Kraftwagenteile auf dem Weltmarkt engagiert. Die Exportquote dieser Branche lag im Jahr 2021 bei gut 65 Prozent. Genauso ausgerichtet aufs Ausland sind der Maschinenbau und die chemische Industrie.
Importe
Auch auf der Einfuhrseite zeigt sich eine enge Verzahnung Deutschlands mit seinen europäischen Nachbarn. Fast 65 Prozent aller Importe stammten 2020 aus den EU- Ländern. Wie die Statistik zeigt, waren 2021 die Volksrepublik China und die Vereinigten Staaten die wichtigsten Handelspartner außerhalb der Europäischen Union. Innerhalb der EU waren es die Niederlande, Polen und Italien.
Die wichtigsten Außenhandels-Partner Deutschlands 2021
Die größten Kunden (Export)
Die größten Lieferanten (Import)
Vereinigte Staaten
122 Mrd. €
142 Mrd. €
Volksrepublik China
Volksrepublik China
104 Mrd. €
105 Mrd. €
Niederlande
Frankreich
102 Mrd. €
72 Mrd. €
Vereinigte Staaten
Niederlande
100 Mrd. €
65 Mrd. €
Polen
Polen
78 Mrd. €
65 Mrd. €
Italien
Italien
75 Mrd. €
62 Mrd. €
Frankreich
Österreich
65 Mrd. €
49 Mrd. €
Schweiz
Vereinigtes Königreich
65 Mrd. €
48 Mrd. €
Tschechische Republik
Schweiz
61 Mrd. €
52 Mrd. €
Belgien
Belgien
50 Mrd. €
50 Mrd. €
Tschechien
Tschechien
47 Mrd. €
48 Mrd. €
Österreich
Gesamt Export
1.375
€ Mrd. €
1.203 Mrd. €
Gesamt
Import
Quelle: Statistisches Bundesamt Deutschland, Außenhandel
Als bedeutende Industrienation zählt Deutschland zu den größten Rohstoffkonsumenten der Welt. Ein Großteil der Massenrohstoffe wie Kalisalz, Schwefel, Gips, Kalkstein und Ton werden aus heimischen Lagerstätten gewonnen. Das gilt für viele andere Rohstoffe nicht. Bei Aluminium, Kupfer, Baumwolle und Erdöl besteht eine nahezu vollständige Importabhängigkeit. Ohne diese Rohstoffe kann unsere Wirtschaft nicht existieren und käme bald zum Erliegen.
Aber auch auf vielen anderen Gebieten ist Deutschland von ausländischen Waren abhängig, die im Inland nur in unzureichenden Mengen, in unzureichender Qualität oder viel zu teuer hergestellt werden. Denken Sie dabei nur an die elektronischen Waren und Textilien aus dem Fernen Osten, die Nahrungsmittel aus Neuseeland und Südafrika und die Autos und Maschinen aus Korea und Japan.
Arbeitskosten im internationalen Vergleich
Arbeitskosten je Stunde 2021 in €
Auswahl teure Standorte
Auswahl günstige Standorte
Land
Arbeitskosten/Std.
Land
Arbeitskosten/Std.
Dänemark
49,82 €
Griechenland
16,30 €
Belgien
44,83.€
Zypern
13,72 €
Schweden
43,47 €
Portugal
12,86 €
Deutschland
43,20 €
Ungarn
10,96 €
Österreich
41,25 €
Polen
10,45 €
Niederlande
40,79 €
Lettland
10,30 €
USA
34,83 €
Kroatien
10,28 €
Italien
28,92 €
China
9,46 €
Südkorea
27,23 €
Rumänien
7,30 €
Japan
25,65 €
Bulgarien
5,81 €
Quelle: Institut der Deutschen Wirtschaft
Hohe Arbeitskosten
Der Hauptgrund dafür, dass im Ausland Waren kostengünstiger hergestellt werden können, liegt meistens bei den niedrigen Arbeitskosten. Wie die Statistik „Arbeitskosten je Stunde“ zeigt, bezahlten Arbeitgeber in Deutschland 2021 durchschnittlich 43,20 Euro für eine Arbeitsstunde. In China, dem größten Konkurrenten der deutschen Volkswirtschaft, beträgt der durchschnittliche Stundenlohn lediglich 9,46 Euro und in Bulgarien gerade mal 5,81 Euro.
Die relativ hohen deutschen Arbeitskosten haben zur Folge, dass fast alle Waren in vielen anderen Industrieländern kostengünstiger hergestellt werden können als in Deutschland. Das gilt erst recht für Länder wie beispielsweise China, Polen und Rumänien, in denen die Arbeitskosten pro Stück weit unter denen der klassischen Industrienationen liegen. Viele Waren werden hier in modernen Fabriken mit einer hohen Produktivität gefertigt. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass fast alle Waren bei einem sehr hohen Qualitätsstandard viel preiswerter im Ausland hergestellt werden können als bei uns. Dazu ein Beispiel aus der Schuhindustrie:
Beispiel Schuhe
Ein Paar in Deutschland gefertigte Schuhe – und es sind nicht nur Qualitätsprodukte – kostete 2021 im Durchschnitt 39,60 Euro, ein Importpaar dagegen durchschnittlich nur 14,10 Euro. Zwar ist der Vergleich infolge der unterschiedlichen Schuharten nur bedingt aussagefähig, aber der Trend ist unverkennbar. Nach Berechnungen eines bekannten Herstellers von Sportschuhen wird beispielsweise ein für rund 110,00 US$ im Laden verkaufter Sportschuh in Thailand für 10,50 US-$ hergestellt – für deutsche Verhältnisse schwer vorstellbar.
Aus didaktischen Erwägungen hat es sich bewährt, Sie gleich am Anfang meines Buches mit einigen wichtigen Begriffen des Außenhandels vertraut zu machen. Später werde ich noch ausführlich auf sie zurückkommen.
Abgrenzung
In der Wirtschaftstheorie werden Waren und Dienstleistungen zusammenfassend als Produkte bezeichnet. Unter Waren werden dabei alle materiellen Wirtschaftsgüter verstanden, wie beispielsweise Autos, Maschinen und Bücher. Dienstleistungen sind dagegen immaterielle Wirtschaftsgüter wie Leistungen der Banken, Versicherungen, Transportunternehmen und Reisebüros. Da im Außenhandel der Handel mit Waren viel umfangreicher ist als der Handel mit Dienstleistungen, behandele ich in diesem Buch bevorzugt den Handel mit Waren.
Bei den Waren beschränke ich mich im Wesentlichen auf vertretbare Waren, also solche, die serienmäßig hergestellt werden und nach Gewicht, Maß oder Zahl bestimmt werden. Beispiele sind Werkzeuge, Früchte und Bücher. Nicht vertretbare Waren (Speziesware), wie beispielsweise große Industrieanlagen, einzigartige Kunstwerke oder auf Kundenwusch hergestellte Spezialmaschinen, behandele ich nur am Rande dieses Buches.
Der Außenhandel
Der Außenhandel ist der gewerbsmäßige Austausch von Waren über Staatsgrenzen hinweg. Je nach der Richtung des Güterverkehrs wird der Außenhandel in die beiden Grundformen Import und Export unterteilt.
Import
ist die Einfuhr von Waren und
Export
ist die Ausfuhr von Waren.
Aus wirtschaftlicher Sicht ist der Import eine Umkehrung des Exportes. Um unnötige Wiederholungen zu vermeiden, werde ich themenbezogen den Import und mal den Export mehr in den Vordergrund stellen.
Importeur oder Exporteur ist derjenige, der den Kaufvertrag direkt mit dem ausländischen Geschäftspartner abschließt. Ein Spediteur oder Frachtführer, der für ein Unternehmen Auslandstransporte übernimmt oder Ein- bzw. Ausfuhren abwickelt, ist weder Importeur noch Exporteur.
Gemeinschaftswaren, Nicht-Gemeinschaftswaren
In der Umgangssprache des Außenhandels wird überwiegend vom Import und Export gesprochen, egal ob die Waren aus EU-Staaten oder Nicht-EU-Staaten stammen. Aus steuerlicher und zolltechnischer Sicht ist das nicht ganz richtig. Hier wird der Handel mit „EU-Waren“(Gemeinschaftswaren) von dem Handel mit „Nicht-EU-Waren“ (Nicht-Gemeinschaftswaren) unterschieden. Dabei werden folgende Begriffe verwendet:
Eingang:
Import von Waren in ein EU-Land von einem EU-Land.
Versendung:
Export von Waren von einem EU-Land in ein anderes EU-Land.
Einfuhr:
Import von Waren in ein EU-Land von einem Nicht-EU-Land.
Ausfuhr:
Export von Waren von einem EU-Land in ein Nicht-EU-Land.
Im Kapiteln 18: „Zoll – Einfuhr aus Nicht-EU-Ländern“ und im Kapitel 19: „Zoll – Ausfuhr in Nicht-EU-Ländern“ werde ich noch ausführlich auf die Themen „Einfuhr“ und „Ausfuhr“ eingehen. Zum besseren Verständnis der nachfolgenden Ausführungen schließe ich mich bis dahin dem herrschenden Sprachgebrauch an und beschränke mich auf die Begriffe Import und Export.
Transithandel
Zum Außenhandel gehört auch der Transithandel. Es sind Handelsgeschäfte, bei denen Waren im Ausland eingekauft und im Ausland verkauft werden, ohne dass dabei die Ware einfuhrrechtlich im Inland abgefertigt wird. Der Transithändler hat dabei seinen Sitz weder im Import- noch im Exportland.
Beispiel: Ein deutscher Unternehmer kauft in Algerien Gemüse und verkauft es an einen norwegischen Geschäftspartner in Oslo. Es wird vereinbart, dass der Transport per Lkw durchgeführt werden soll. Das Gemüse, das als Transitware bezeichnet wird, gelangt durch die Transitländer Spanien, Frankreich und Deutschland nach Oslo. Die Transitware wird also nur durch diese Länder durchgeleitet und weder gelagert noch be- oder verarbeitet.
Beim Transithandel ergeben sich immer wieder sehr gute Geschäftsmöglichkeiten. Um diese wahrnehmen zu können, bedarf es aber langjähriger Erfahrungen im Import- und Exporthandel. Da ich diese hier nicht voraussetzen kann, beschränke ich mich in den weiteren Ausführungen auf den Export und den Import.
* * * * * * *
Kapitel 2: Erste Schritte
Bevor Sie wirtschaftliche Entscheidungen fällen, wenden Sie sich zuerst an Ihre Industrie- und Handelskammer und besprechen Ihr Vorhaben, sich ein eigenes Außenhandels-Geschäft aufzubauen, mit dem zuständigen Fachpersonal. Treffen Sie auf die richtigen Personen, erhalten Sie viele wertvolle Anregungen. Fragen Sie gezielt nach einer finanz- und betriebswirtschaftlichen Beratung, nach speziellen Branchen- und Marktinformationen und nach einem Erfahrungsaustausch mit Selbstständigen und Branchenkennern.
Zum Thema Unternehmensgründung werden im Internet viele Informationsquellen angeboten. Hier zwei der bekanntesten Internetforen, die Sie sich auf jeden Fall ansehen sollten:
Marktplatz für Existenzgründer, www.gruenderservice.de
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, www.bmwi.de
Um im nationalen und internationalen Geschäftsleben ernst genommen zu werden, müssen Sie bestimmte Formvorschriften und Geschäftspraktiken beachten. Am wichtigsten ist der Geschäftsbrief in gedruckter und elektronischer Form (E-Mail), die Eintragung ins Handelsregister und ein eigener Online-Shop.
Allerdings möchte ich nicht verhehlen, dass insbesondere bei Online-Importen gegen Vorauszahlung einige dieser Formalitäten nicht zwingend erforderlich sind. Ist der Kaufpreis bei dem ausländischen Geschäftspartner eingegangen, ist es ihm in der Regel egal, wer sich dahinter verbirgt – Hauptsache die Kasse stimmt.
Geschäftsbrief
Das gängigste Mittel zur Kommunikation im Geschäftsleben ist der Geschäftsbrief in gedruckter und elektronischer Form. Insbesondere im Außenhandel ist er die Visitenkarte für Ihr Unternehmen, mit dem Sie zeigen, wie professionell Sie auf den internationalen Märkten auftreten. Sie bahnen mit ihm Geschäftskontakte an und pflegen sie, Sie handeln Konditionen für Ihre Außenhandels-Geschäfte aus und bestätigen sie, Sie stellen Ihre Leistungen in Rechnung und mahnen überfällige Zahlungen an.
Alle gedruckten oder elektronischen Dokumente, die Sie für Ihren Geschäftsverkehr verwenden, müssen gesetzlich vorgeschriebene Pflichtangaben enthalten. Dazu gehören neben dem Namen Ihres Unternehmens (Firma) auch Angaben über die Rechtsform, den Firmensitz (Fachwort: Handelsniederlassung), das Registergericht und die Handelsregisternummer. Bei einer GmbH sind zusätzlich alle Geschäftsführer mit ausgeschriebenem Familiennamen und mindestens einem Vornamen zu nennen.
Neben diesen gesetzlichen Formvorschriften gehören zu jedem Geschäftsbrief die Telefon- und Telefaxnummer, die Internet- und E-Mail-Anschrift, die Bankverbindung und die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer.
E-Mails haben die gedruckten Geschäftsbriefe und die Telefongespräche im internationalen Geschäftsleben weitgehend verdrängt. Abgesehen davon, dass sie viel schneller als gedruckte Geschäftsbriefe geschrieben und verschickt werden können, bieten sie gerade gegenüber dem Telefongespräch einen weiteren, unschätzbaren Vorteil: Dank der gespeicherten Kopien hat der Versender einen schriftlichen Beleg, auf den er im Streitfall zurückkommen kann.
E-Mails haben aber auch Nachteile. Da sie schnell geschrieben werden, verleiten sie ihre Verfasser zu schweren Rechtschreib- und Grammatikfehlern und peinlichen stilistischen Mängeln. Vermeiden Sie solche Fehler und greifen bei der Beantwortung auf Textbausteine zurück. Dabei halten Sie sich eines vor Augen: Wie gedruckte Geschäftsbriefe repräsentieren E-Mails Sie persönlich und Ihr Unternehmen. Sie erwecken Vorstellungen, die sich Ihre Handelspartner von Ihnen, Ihren Absichten und von Ihrem Unternehmen machen.
Damit E-Mails nicht gleich im elektronischen Papierkorb landen und Sie mit ihnen das erreichen, was Sie erwarten, sind einige Regeln zu beachten. Nur so wird es Ihnen gelingen, die Vorteile von E-Mails voll zu nutzen.
Betreffzeile
Die wichtigste Komponente einer guten E-Mail ist ein bekannter Absender. Sind Sie oder Ihr Unternehmen noch nicht bekannt, entscheidet die Betreffzeile über das Wohl und Wehe Ihrer E-Mail. Eine Betreffzeile muss kurz sein und mit treffenden Worten Hinweise auf Ihre Handelswaren geben. Die Betreffzeile einer erfolgreichen E-Mail-Werbemaßnahme von Bernd Harmsen, den Sie gleich als Leitfigur dieses Buches kennenlernen werden, an Gourmet-Restaurants sah wie folgt aus:
Subject:Selling: Very reasonable lobster cans
Fassen Sie sich kurz
Wichtig ist, dass Sie dem Empfänger einer E-Mail kurz und verständlich den Inhalt Ihrer Nachricht mitteilen. Was Sie nicht in ca. drei Absätzen mit höchstens drei bis fünf Zeilen erklären können, gehört als Anhang in ein separates Word-Dokument. Ein dezenter Hinweis auf Ihren Online-Shop am Ende Ihrer E-Mail ist sehr sinnvoll:
„If you need further information, please visit our website www.harmsen-fisch.de“.
Persönliche Anrede
Vermeiden Sie unpersönliche Anreden wie „Sehr geehrte Damen und Herren“ und sprechen Sie den Empfänger Ihrer E-Mails grundsätzlich persönlich mit seinem richtigen Namen an. Um die Verwirrung um den Familienstand zu lösen, können Sie verheiratete und unverheiratete Frauen mit „Ms“ anreden.
Bei Titeln wie „Doctor“ oder „Professor“ fallen „Mr“ oder „Ms“ weg. Sie schreiben also „Doctor H. G. Sen“ oder „Professor J. H. Korness“.
Grußformel
Solange Sie nicht wissen, ob der Empfänger einer E-Mail eher einen lockeren oder einen steiferen Umgangston pflegt, gehen Sie sehr sparsam mit Anreden wie „Hallo“ und „Hi“ um. Wundern Sie sich nicht, wenn Ihr amerikanischer Geschäftspartner Sie mit Ihrem Vornamen anredet. Das bedeutet nicht, dass er Sie damit in seinen engsten Freundeskreis aufgenommen hat. In den USA geht man nach kürzerer Zeit als in Deutschland zu einem weniger formellen Umgangston über.
Antworten Sie zügig
Es gebietet die Höflichkeit, dass E-Mails nach Möglichkeit innerhalb eines Werktages beantwortet werden. Schaffen Sie das nicht, teilen sie es dem Adressaten mit und sagen ihm, wann er mit einer Antwort rechnen kann.
Formvorschriften
Für geschäftliche E-Mails oder andere elektronische Schreiben gelten die gleichen gesetzlichen Formvorschriften wie für Geschäftsbriefe in Papierform. Das trifft in Deutschland auch für Formulare wie Angebote, Bestellungen, Auftragsbestätigungen, Rechnungen und Lieferscheine zu.
Handelsregister
Es ist sehr wichtig, dass Sie sich mit Ihrer Firma zügig ins Handelsregister eintragen lassen. Die Firma ist der Name eines Kaufmanns (Unternehmens), unter dem er seine Handelsgeschäfte betreibt, seine Unterschrift abgibt, klagen und verklagt werden kann. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird das Wort „Firma“ gerne anstelle von Unternehmen, Unternehmung und Betrieb gebraucht.
Viele deutsche Unternehmen werden nur dann mit Ihnen Geschäftsbeziehungen eingehen, wenn Ihnen ein aktueller Handelsregister-Auszug vorliegt. Voraussetzung für die Eintragung ins Handelsregister ist Ihre Gewerbeanmeldung. Dazu müssen Sie der zuständigen Behörde mitteilen, dass Sie eine gewerbliche Tätigkeit beginnen, die möglichst genau zu beschreiben ist.
Nach der Anmeldung Ihres Gewerbes erhalten Sie als Bestätigung einen Gewerbeschein. Parallel dazu werden mehrere Behörden und öffentliche Körperschaften über Ihre Gewerbeanmeldung informiert. Wundern Sie sich also nicht, wenn Sie vom Finanzamt, von der Industrie- und Handelskammer, der Krankenkasse, der Arbeitsagentur und der Berufsgenossenschaft Post bekommen und aufgefordert werden, alle möglichen Daten anzugeben.
Online-Auftritt
Um sich ein Bild von Ihrem Unternehmen zu machen, informieren sich Lieferanten, Kunden und Dienstleister (Banken, Versicherungen, Logistiker) zuerst über Ihrem Online-Auftritt, in der Regel über Ihren Online-Shop. Sind Sie mit Ihrem Unternehmen nicht im Internet vertreten, werden Sie schnell als Kleinstunternehmer eingestuft, mit dem man besser keine Geschäftsbeziehungen eingeht.
Besonders wichtig bei Ihrem Online-Shop ist die Domain, also der mittlere Teil Ihrer Internet-Anschrift. Bei der „www.harmsen-fisch.de“ lautet die Domain beispielsweise „harmsen-fisch“.
Achten Sie deshalb bei der Vergabe des Namens (Firma) Ihres Unternehmens darauf, dass er Ihren Namen enthält und auf die Ware hinweist, mit der Sie handeln. So wie bei der „Harmsen Fisch Handelsgesellschaft mbH“ kann dann beides mit in Ihre Domain einfließen und so darauf hinweisen, was Sie in Ihrem Online-Shop anbieten. Egal, auf welchem Weg die Nutzer (Fachwort: User) den Zugang zu Ihren Waren suchen, sie erkennen so auf den ersten Blick genau das, was sie suchen.
Scheuen Sie sich nicht, Ihr Unternehmen in Ihrem Online-Shop werbewirksam darzustellen, ohne allerdings die Grenzen der Wahrheit allzu sehr zu strapazieren. Sie brauchen dabei kein schlechtes Gewissen zu haben, denn kleine Übertreibungen sind bei Selbstdarstellungen eigentlich gängige Praxis. Sind Sie erfolgreich, werden Geschäftspartner darüber hinwegsehen; wahrscheinlich haben sie auch mal so begonnen. Die Reaktionen auf Ihre E-Mails werden Sie ermutigen, das Thema Außenhandel nun richtig anzupacken.
Persönliche Anforderungen
Wie bei jedem Aufbau eines Unternehmens entscheidet letzten Endes Ihre unternehmerische Qualifikation darüber, ob Sie erfolgreich sein werden. Neben Ihrer fachlichen und sozialen Kompetenz gehören dazu auch Eigenschaften wie Risiko- und Leistungsbereitschaft, Durchsetzungsvermögen, Zielstrebigkeit, Kreativität, Zuverlässigkeit und Seriosität.
Ihre in- und ausländischen Geschäftspartner müssen immer das Gefühl haben, in Ihnen einen zuverlässigen Geschäftspartner mit einem hohen Wissensstand zu haben. Hüten Sie sich davor, Versprechungen zu machen oder Eindrücke zu vermitteln, die Sie im Nachhinein nicht erfüllen können. Maßlose Übertreibung des eigenen Geschäftsvolumens, Abnahmeversprechen von hohen Stückzahlen und Nichteinhalten von vertraglichen oder persönlichen Vereinbarungen führen oft zum Abbruch mühsam aufgebauter Geschäftsbeziehungen.
Als Außenhandels-Kaufmann werden von Ihnen gute englische Sprachkenntnisse in Wort und Schrift erwartet. Nach Möglichkeit sollten Sie auch die Landessprache Ihrer ausländischen Geschäftspartner sprechen. Gute Sprachkenntnisse sind auch bei der Internetrecherche sehr hilfreich. Viele landes- und branchenspezifische Informationen werden oft nur in der Landessprache veröffentlicht. Soweit erforderlich, beginnen Sie gleich mit der Aufbesserung Ihrer Sprachkenntnisse.
Weiterbildung
Nachdem Sie mein Buch durchgearbeitet haben, werden Sie vielleicht das Gefühl haben, sich durch eine Fortbildungsmaßnahme noch intensiver mit dem Außenhandel beschäftigen zu müssen. Ich kann Sie dabei nur unterstützen und Ihnen raten, sich durch eine gezielte Weiterbildung noch besser für den Außenhandel zu qualifizieren.
Denken Sie in diesem Zusammenhang auch daran, dass Sie vielleicht mit Ihrem Außenhandels-Unternehmen scheitern. Können Sie dann auf eine qualifizierte Ausbildung als Außenhandels-Kaufmann und auf praktische Erfahrungen verweisen, werden Sie kaum Probleme haben, eine gut bezahlte Tätigkeit als Angestellter zu finden. Interessant ist in diesem Zusammenhang die Ausbildung zum „Fachkaufmann/-frau für Außenwirtschaft (IHK)“.
Weiterbildungs-Informations-System (WIS) der IHK, www.wis.ihk.de
Leitfigur „Bernd Harmsen“
Durch weite Teile meines Buches wird Sie Bernd Harmsen begleiten, dem es in wenigen Jahren gelungen ist, aus kleinsten Anfängen ein erfolgreiches Außenhandels-Unternehmen mit Fischkonserven aufzubauen. Hier seine Geschichte:
Bernd Harmsen (Geburtsjahr 1981) wohnte in Stade an der Elbe und war in Hamburg als Marktleiter bei einem Discounter angestellt. Die ständige Fahrerei, der harte Job, das relativ bescheidene Einkommen und die schlechten Aussichten auf ein berufliches Weiterkommen ließen ihn ständig über andere berufliche Möglichkeiten nachdenken. Am liebsten hätte er sich mit einem eigenen Discountmarkt selbstständig gemacht, nur dafür fehlte ihm das Kapital.
Im Sommer 2007 lernte Bernd Harmsen einen Norweger kennen, der wegen einer Reifenpanne auf einer einsamen Straße in der Nähe von Tromsø liegen geblieben war. Bernd Harmsen überließ ihm seinen Reservereifen und sie fuhren gemeinsam in die nächste Werkstatt. Wie sich in dem anschließenden Gespräch herausstellte, hieß der Norweger Anders Fredriksen und war Inhaber der Konservenfabrik „A/S Anders Fredriksen“. Er verarbeitete hauptsächlich Königskrabben, Dorschleber und Makrelen für den norwegischen Markt.
Hier wurde Bernd Harmsen hellhörig. Warum sollte er die Dosen nicht importieren und sie in Deutschland vermarkten? Nach einem kurzen Wortwechsel kamen beide per Handschlag überein, dass Anders Fredriksen ihn jederzeit gegen Vorauskasse beliefern wird. Bernd Harmsen kaufte 300 Dosen als „Muster“ zu einem Vorzugspreis von insgesamt 500,00 Euro, lud sie in seinen Pkw und fuhr auf dem schnellsten Weg zurück nach Stade. Hier bot er die Fischkonserven bei eBay und Amazon zum Verkauf an und war überrascht, dass sie zum doppelten Preis nach wenigen Tagen verkauft waren. Das war sein Start als selbstständiger Außenhandels-Kaufmann.
Die Voraussetzungen dazu waren für ihn sehr günstig: Im Haus seiner Eltern gab es genug Platz für ein Büro und für ein Lager. Auf seinen Urlaubsreisen ins Ausland hatte er viele Länder kennengelernt. Neben seinen sehr guten Kenntnissen der englischen und der norwegischen Sprache, verfügte er auch über solide kaufmännische Kenntnisse, die er während seiner Angestelltentätigkeit erworben hatte.
Im Herbst 2010 eröffnete Bernd Harmsen für den Direktverkauf der Fischdosen seinen Online-Shop „www.harmsen-fisch.de“ und ein Mitgliedskonto bei Amazon und eBay. Mitte 2011 gründete er als alleiniger Gesellschafter die „Harmsen Fisch Handelsgesellschaft mbH“ (nachfolgende kurz „Harmsen GmbH“), die er dann auch sehr zeitnah ins Handelsregister von 21682 Stade eingetragen ließ. Das Stammkapital von 20.000,00 Euro finanzierte Bernd Harmsen mit 15.000,00 Euro Barmitteln und seinem PKW im Wert von 5.000,00 Euro.
Zum 1. Januar 2011 hatte er seine Angestelltentätigkeit aufgegeben und widmete sich nur noch dem Aufbau seines Unternehmens. Er importierte Fischkonserven in großen Mengen jetzt auch aus Japan, Chile und Russland und exportierte den größten Teil davon in die Länder der Europäischen Union.