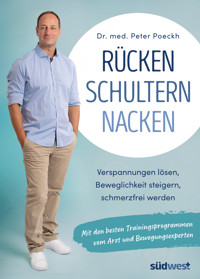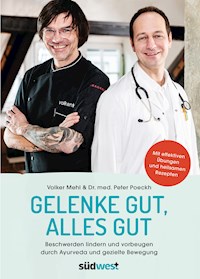Impression Management des Bewerbers und Interviewers bei Personalbewerbungsgesprächen E-Book
Peter Poeckh
36,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Diplomarbeit aus dem Jahr 2003 im Fachbereich Führung und Personal - Sonstiges, Note: 1, Wirtschaftsuniversität Wien, Sprache: Deutsch, Abstract: Es gibt viele verschiedene Definitionen von Impression Management. "The desire to make a favorable impression on others is universal. In one way or another, we all do things to attempt to control how other people see us, often attempting to get them to think of us in the best light possible." Diese Definition stammt von Greenberg (2003). Baron (1989) definiert Impression Management wie folgt: "This term refers to a process by which individuals change or manage several aspects of their behavior in order to create a positive impression on other." Ziel dieser Arbeit ist es darzustellen, wann und warum Individuen Impression Management betreiben und wie sie dabei vorgehen. Im Speziellen richtet diese Arbeit ihren Schwerpunkt auf das Impression Management im Rahmen des Einstellungsgespräches. Dabei lässt sich nicht nur auf Seiten des Bewerbers, sondern auch auf Seiten des Interviewers, der das Unternehmen vertritt, der Einsatz von Selbstdarstellungsverhalten nachweisen. Impression Management wird heutzutage nicht mehr als böswilliges, ausmanövrierendes Verhalten angesehen, sondern als rudimentärer Bestandteil aller sozialen Interaktionen, vor allem im Berufsleben. Den Anfang der Arbeit gestaltet die Abgrenzung der Begriffe Personalauswahl und Personalbeschaffung, da das Verständnis der Unterschiedlichkeit dieser beiden Begriffe notwendig ist, um die weiteren Ausführungen nachvollziehen zu können. Im zweiten Kapitel werde ich auf die Impression Management Theory im Näheren eingehen und dabei ihren Ursprung, ihre Entwicklung und ihre verschiedenen Techniken behandeln. Die unterschiedlichen Impression Management Techniken stellen einen fundamentalen Bestandteil dieser Arbeit dar, da sie einerseits die Möglichkeiten Selbstdarstellungsverhalten zu praktizieren kategorisieren, andererseits als Ausgangspunkt für das Verhalten im Rahmen eines Interviews dienen. Das Einstellungsgespräch und die Verwendungsmöglichkeiten von Impression Management vorher, während und danach, beschreibe ich im dritten Kapitel. Dieser Abschnitt soll einen detaillierten Einblick geben, wie breit das Spektrum an Möglichkeiten für einen Bewerber ist, seine Chancen zu verbessern, einen bestimmten Arbeitsplatz zu bekommen. Auf Gefahren, Selbstdarstellung zu übertreiben, weise ich auch im Speziellen hin. Auch für den Interviewer eröffnen sich Gegebenheiten, auch wirklich den besten und geeignetsten Kandidaten für das Unternehmen zu rekrutieren. [...]
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Page 1
Page 2
Vorwort
Auf diesem Wege danke ich Gott und meinen Eltern von ganzem Herzen, ohne die ich nie die Möglichkeit gehabt hätte, dieses Studium aufzunehmen und abzuschließen. Dafür bin ich ihnen unendlich dankbar…
All jenen, die mich auf dem Weg meines Studiums begleitet und unterstützt haben, insbesondere meinem lieben Freund Lukas, widme ich hiermit ein herzliches Dankeschön für eine spannende und unvergessliche Zeit.
Page 1
1 EINLEITUNG UND ZIELRICHTUNG DER ARBEIT
Es gibt viele verschiedene Definitionen von Impression Management. "The desire to make a favorable impression on others is universal. In one way or another, we all do things to attempt to control how other people see us, often attempting to get them to think of us in the best light possible." Diese Definition stammt von Greenberg (2003).1Baron (1989) definiert Impression Management wie folgt: "This term refers to a process by which individuals change or manage several aspects of their behavior in order to create a positive impression on other."2Ziel dieser Arbeit ist es darzustellen, wann und warum Individuen Impression Management betreiben und wie sie dabei vorgehen. Im Speziellen richtet diese Arbeit ihren Schwerpunkt auf das Impression Management im Rahmen des Einstellungsgespräches. Dabei lässt sich nicht nur auf Seiten des Bewerbers, sondern auch auf Seiten des Interviewers, der das Unternehmen vertritt, der Einsatz von Selbstdarstellungsverhalten nachweisen. Impression Management wird heutzutage nicht mehr als böswilliges, ausmanövrierendes Verhalten angesehen, sondern als rudimentärer Bestandteil aller sozialen Interaktionen, vor allem im Berufsleben. Den Anfang der Arbeit gestaltet die Abgrenzung der Begriffe Personalauswahl und Personalbeschaffung, da das Verständnis der Unterschiedlichkeit dieser beiden Begriffe notwendig ist, um die weiteren Ausführungen nachvollziehen zu können. Im zweiten Kapitel werde ich auf die Impression Management Theory im Näheren eingehen und dabei ihren Ursprung, ihre Entwicklung und ihre verschiedenen Techniken behandeln. Die unterschiedlichen Impression Management Techniken stellen einen fundamentalen Bestandteil dieser Arbeit dar, da sie einerseits die Möglichkeiten Selbstdarstellungsverhalten zu praktizieren kategorisieren, andererseits als Ausgangspunkt für das Verhalten im Rahmen eines Interviews dienen. Das Einstellungsgespräch und die Verwendungsmöglichkeiten von Impression Management vorher, während und danach, beschreibe ich im dritten Kapitel. Dieser Ab-
1GREENBERG,J. und BARON, R. A. (2003), S. 52
2BARON, R. A. (1989), S. 204
Page 2
schnitt soll einen detaillierten Einblick geben, wie breit das Spektrum an Möglichkeiten für einen Bewerber ist, seine Chancen zu verbessern, einen bestimmten Arbeitsplatz zu bekommen. Auf Gefahren, Selbstdarstellung zu übertreiben, weise ich auch im Speziellen hin. Auch für den Interviewer eröffnen sich Gegebenheiten, auch wirklich den besten und geeignetsten Kandidaten für das Unternehmen zu rekrutieren. Dabei passieren viele Fehler und nur ein gut geschulter Interviewer sollte einem potenziellen Mitarbeiter gegenüber sitzen.
In Kapitel 3.1. wird das Interview mit all seinen Bedeutungen, Funktionen, Stärken und Schwächen im Näheren beschrieben. Es wird auch auf den Ablauf eines Einstellungsgesprächs und auf die verschiedenen Möglichkeiten, Fragen an den Bewerber zu stellen, eingegangen. Wie Impression Management schon vor dem Interview betrieben werden kann, wird in Kapitel 3.2. aufgezeigt. In Kapitel 3.3. wird auf Impression Management beim Interview selbst eingegangen und sowohl von Bewerberals auch von Interviewerseite durchleuchtet und analysiert. Kapitel 3.4. erklärt dann noch, wie Impression Management nach dem Interview erfolgen kann. Das vierte Kapitel dient als Abrundung des gesamten Themenbereiches und soll noch einmal einen transparenten Überblick über die Thematik bieten. Da ich mich hauptsächlich mit dem Impression Management im Zuge der Personalauswahl beschäftigen werde, im Speziellen beim Interview, bedarf es einer Abgrenzung des Begriffes der Personalauswahl, vor allem im Vergleich zur Personalbeschaffung. Diese beiden Bereiche können mitunter sehr eng miteinander verbunden sein.
Nach Berthel (2000) ist Personalbedarfsdeckung der zentrale Begriff, worunter er alle Aktivitäten versteht, die auf "Gewinnung und Einsatz" personeller Kapazitäten ausgerichtet sind:
•Durch die Beschaffung erfolgt die Suche und Bereitstellung potenzieller Arbeitskräfte, d.h. die Rekrutierung oder Anwerbung von Bewerbern.
•Im Auswahlprozess wird entschieden, wer aus dem Kreise der Bewerber der best qualifizierteste für die vorhergesehene Stelle ist.
Page 3
•Der Bedarfsdeckungsprozess endet mit dem Einsatz, d.h. mit der Eingliederung des gewonnenen Mitarbeiters in den betrieblichen Leistungsprozess. Berthel (2000) sieht Beschaffung und Auswahl als aufeinanderfolgende Phasen des Bedarfsdeckungsprozesses an.3
Lueger (1996) fasst die Prozesse der Beschaffung und Auswahl von Mitarbeitern unter dem Begriff "Rekrutierung" zusammen. Er versteht diese beiden Phasen als von-einander abgrenzbar und aufeinander folgend. Personalbeschaffung umfasst alle Aktivitäten, die der Gewinnung von möglichst qualifizierten Bewerbern dienen (z.B. Festlegung der Arbeitsplatzanforderungen, Arbeitsmarktanalysen, Maßnahmen der Personalwerbung, etc.). Die Personalauswahl folgt der Phase der Beschaffung und bezeichnet all jene Aktivitäten, die der Auswahl des am besten geeigneten Bewerbers dienen (z.B. Vorstellungsgespräch, Tests, etc.)4Grundsätzlich sind Personalbeschaffung und Personalauswahl zwei verschiedene Prozesse, jedoch immer im Zusammenhang zu betrachten, da sie meistens fließend ineinander übergehen und eine exakte Differenzierung oft schwierig ist.
3BERTHEL, J. (2000), S. 162
4LUEGER, G. (1996), S. 338
Page 4
2 DAS IMPRESSION MANAGEMENT
In Kapitel 2 wird das Impression Management mit seinen Ansätzen und Ausführungen erläutert. Zunächst wird auf die Impression Management Theory in Kapitel 2.1. eingegangen und im Kapitel 2.2. eine detaillierte Beschreibung der unterschiedlichen Impression Management Techniken gegeben. Damit soll nicht nur eine Einsicht in das Impression Management vermittelt werden, sondern auch das Verständnis, wie wir uns in bestimmten Situationen verhalten, näher gebracht werden, da in weiterer Folge das Impression Management im Zuge des Interviews behandelt wird.
2.1. Impression Management Theory
Die Impression Management Theory ist Ausdruck eines Perspektivenwechsels oder zumindest einer Erweiterung der Perspektive in der Sozialpsychologie. Zum Impression Management wird jede Handlung gezählt, mit welcher der Eindruck oder die Attributionen von anderen Individuen beeinflusst werden soll.5Obwohl es offensichtlich ist, dass alle Menschen laufend versuchen, den Eindruck, den sie auf andere Menschen machen, zu beeinflussen (z.B. mit Kleidung, Kosmetik, Schmuck, etc.), wurde früher diese Dimension in der experimentellen Psychologie kaum beachtet.6
Die Impression Management Theory musste sich im Laufe ihrer Entwicklung mehrerer langsamer, teils schmerzlicher Transformationen unterziehen, die sie von einer "extremen"7zu einer momentan als "mainstream"8angesehenen Theorie machten.9"Despite a steady stream during the 1960s and 1970s, impression management remained a relatively peripheral topic in social and personality psychology, leading
5SCHLENKER, B. R. (1980) definiert Impression Management "as the deliberate attempts individuals
make to influence the images others form of them".
6vgl. TEDESCHI, J. T. und RIESS, M. (1981)
7laut ROSENBERG, M. J. (1965), S. 28 ff.: "Impression management effects were in the 'extreme':
they were artifacts, or instances of 'evaluation apprehension' that threatened the validity of labora-
tory experiments."
8seit Anfang der 80-er Jahre
9ROSENFELD, P. und GIACALONE, R. A. (1991), S. 4
Page 5
some to characterize the impression management approach as more of a guiding model than a theory of interpersonal behavior. More recently, however, impression management has attracted increased attention as a fundamental interpersonal process."10
Im folgenden Kapitel wird auf den "Begründer" der Theorie Bezug genommen, der noch heute mit seinen Ansichten den gesamten Bereich des Impression Managements beeinflusst.
2.1.1. Die Selbstdarstellung und die Metapher des Theaters
Die Impression Management Theory geht auf die Beobachtungen Erving Goffman's (1959) zurück, der behauptet, dass Individuen in der sozialen Interaktion bei ihren Interaktionspartnern den Eindruck, den sie auf diese machen, kontrollieren, dass sie also nicht nur passiv sozialem Eindruck ausgesetzt sind, sondern den Einfluss, der auf sie ausgeübt wird, durch die Vermittlung eines bestimmten Eindrucks von sich selbst auf die anderen mitsteuern.11
Erving Goffman (1959)12war einer der Ersten, der sich mit Selbstdarstellung aus-einandergesetzt hat. Der Soziologe schrieb das Buch "The presentation of self in everday life"13, in dem er die Metapher einer Theateraufführung benutzte, um unser Verhalten in sozialen Interaktionen mit anderen zu beschreiben. Die soziale Welt ist eine Bühne mit Publikum, Darstellern und Außenseitern, mit Zuschauerraum und Kulissen. Goffman verbindet mit dem Buch die Erkenntnis, dass unser Handeln in Gesellschaft stets in sozialen Rollen erfolgt. Es geht ihm um den Nachweis, dass die Selbstdarstellung des Einzelnen nach vorgegebenen Regeln und unter vorgegebenen Kontrollen ein notwendiges Element des menschlichen Lebens ist. Selbstdarstellung bestimmt unsere Handlungen und besteht aus dem Versuch, soziale Interaktionen zu kontrollieren. Sie hilft uns auch vorherzusehen, was wir von
10LEARY, M. R. und KOWALSKI, R. M. (1990), S. 35
11vgl. GOFFMAN, E. (1959)
12vgl. GOFFMAN, E. (1959)
13deutscher Titel: "Wir alle spielen Theater" (1996)
Page 6
anderen zu erwarten haben. Einige Formen des Selbstdarstellungsverhaltens sind bewusst kontrolliert, während andere wie Körpersprache oder Augenkontakt meistens unbewusst geschehen. Da es uns extrem wichtig ist, wie wir von anderen Menschen behandelt werden14, versuchen wir unser Selbstdarstellungsverhalten zu lenken, da dieses wesentlich verantwortlich dafür ist. "Wenn ein Einzelner mit anderen zusammentrifft, versuchen diese gewöhnlich, In-formationen über ihn zu erhalten oder Informationen, die sie bereits besitzen, ins Spiel zu bringen. Sie werden sich für seinen allgemeinen sozialen und wirtschaftlichen Status, sein Bild von sich selbst, seine Einstellung zu ihnen, seine Fähigkeiten, seine Glaubwürdigkeit und dergleichen interessieren. Wenn es auch so scheint, als würden einige dieser Informationen um ihrer selbst willen gesucht, so stehen doch im Allgemeinen praktische Gründe dahinter. Informationen über den Einzelnen tragen dazu bei, die Situation zu definieren, so dass die anderen im Voraus ermitteln, was er von ihnen erwarten wird und was sie von ihm erwarten können. Durch diese Informationen wissen die anderen, wie sie sich verhalten müssen, um beim Einzelnen die gewünschte Reaktion hervorzurufen."15
Max Reinhardt (1926) hat in einem Gespräch bereits früh folgende Formulierungen über das Theater spielen gefunden: "Wir suchen im Theater, wie in jeder Kunst, zuletzt immer nur die Persönlichkeit, und je stärker und größer diese ist, umso zufriedener sind wir. Wenn der Schauspieler als Persönlichkeit in einer Rolle untergehen sollte, nicht selbst in Erscheinung treten würde, so wären unsere Erwartungen enttäuscht. Die Schauspielkunst ist eine Kunst der Enthüllung, nicht der Verwandlung! Sich mit Maske, Ton, Gang und Gebärde äußerlich verwandeln, also etwas anderes darstellen, als man wirklich ist, scheint mir da unterhalb der Schauspielkunst zu sein. Der Schauspieler macht schon eine Verwandlung durch, in ein fremdes Schicksal, aber nicht in einen anderen Menschen... Das Glück des Schauspielers ist die Ekstase dieser Verwandlung, das Glück des Zuschauers ist die Enthüllung der Persönlichkeit."16
2.1.2. Three-component model von Leary und Kowalski
14die Abhängigkeit von anderen, die auch "co-dependence" genannt wird
15GOFFMAN, E. (1996), S. 5
Page 7
Leary und Kowalski (1990) versuchen mit ihrem Modell, das Verständnis, wann und warum wir Impression Management verwenden, besser zum Ausdruck zu bringen. Das Model setzt sich aus drei Prozessen zusammen: Impression Monitoring, Impression Motivation und Impression Construction.
Impression Monitoringtritt auf, wenn sich Individuen den Eindrücken, die sie auf andere machen, bewusst sind, und Impression Management als Möglichkeit ansehen um ihre Ziele zu erreichen. Wenn sie beeinflussen wollen, wie sie von anderen wahrgenommen werden, werden sie motiviert sein, Impression Management zu betreiben und somit in denImpression MotivationProzess übergehen. Die dritte Komponente im Modell von Leary und Kowalski (1990) handelt vom Prozess desImpression Construction.Wer motiviert ist einen bestimmten Eindruck zu hinterlassen, wird dementsprechend auch sein Verhalten anpassen. Dabei entscheidet man genau welche Vorgehensweise man anstrebt.17
2.2. Impression Management Techniken
In weiterer Folge werden nun verschiedene Techniken näher erläutert, die dazu dienen, Impression Management gezielt einzusetzen. Rosenfeld, Giacalone und Ri-ordan (1995) unterscheiden "acquisitive impression management", das darauf abzielt, positiv beurteilt zu werden, und "protective impression management", das davor schützen soll, negativ beurteilt zu werden.18 19
16REINHARDT, M. (1926), S. 315
17LEARY, M. R. und KOWALSKI, R. M. (1990), zitiert nach ROSENFELD, P. et al. (1995), S. 17 ff.
18ROSENFELD, P., GIACALONE, R. A., RIORDAN, C. A. (1995), S. 29 - in Anlehnung an ARKIN, R. M.
(1981)
19eine ähnliche Unterscheidung treffen TEDESCHI, J. T. und MELBURG, V. (1984), S. 32: assertive
vs. defensive Selbstdarstellungsarten
Page 8
2.2.1. Acquisitive Impression Management
Arkin (1981) bezeichnet "acquisitive impression management" als "attractionseeking behavior" und damit als zielgerichtetes Verhalten: "The process of engaging in self-presentation may be viewed as a function of incentive value and subjective probability of achieving a successful presentation of self. Accordingly, an individual would be expected to present himself in one or another way to the extent that approval itself is desired and to the extent that it seems probable to the individual that his behavior would achieve that end."20
In weiterer Folge beschreibe ich die verschiedenen Taktiken, die zum "acquisitive impression management" zählen: "Ingratiation" (einschmeicheln, sich beliebt machen), "Self-promotion" (kompetent erscheinen), "Intimidation" (einschüchtern), "Exemplification" (sich als moralisch vorbildlich darstellen), "Supplication" (hilfsbedürftig erscheinen), "Indirect Impression Management", "Acclaiming" (nach Anerkennung strebend) und "Nonverbal Impression Management".21INGRATIATION (einschmeicheln, sich beliebt machen)
Schlenker (1980) meint, dass von allen Impression Management Taktiken, "Ingratiation" die am besten und unmittelbarsten einsetzbare ist, die auf die organisationalen Bedingungen anwendbar ist.22
"Ingratiation refers to a set of related acquisitive impression management tactics that have as their collective aim making the person more liked and attractive to others."23In diesem Zusammenhang können wir "Ingratiation" auch als "attraction management" bezeichnen.24Ursprünglich wurde "Ingratiation" von Jones (1964) folgendermaßen konzeptuiert: "as a class of strategic behaviors illicitly designed to influence a particular other person concerning the attractiveness of one's personal
20ARKIN, R. M. (1981), S. 313
21vgl. ROSENFELD, P., GIACALONE, R. A., RIORDAN, C. A. (1995), S. 30 ff. und MUMMENDEY, H. D.
(1989), S. 141 ff.
22SCHLENKER, B. R. (1980), zitiert nach ROSENFELD, P. et al. (1995), S. 32 ff.
23JONES, E. E. (1990), zitiert nach ROSENFELD, P. et al. (1995), S. 31
24vgl. PANDEY, J. und SINGH, P. (1987), S. 287 ff.
Page 9
qualities"25, somit etwas von Natur aus unrechtmäßiges. Später wurde anerkannt, dass es sich bei "Ingratiation" um eine in Organisationen weit verbreitete und häufig wirkungsvolle Methode handelt, um sozialen Einfluss auszuüben.26Rosenfeld, Giacalone und Riordan (1995) stellen dazu fest, dass "Ingratiation" eher positive Effekte für eine Organisation mit sich bringen kann und weniger als verboten anzusehen ist und nur unter bestimmten Bedingungen sanktioniert werden soll. "Judiciously used, ingratiation can facilitate positive interpersonal relationships and increase harmony within and outside of the organizational setting."27Und auch Ralston (1985) meint, dass "in fact, it may be argued that moderate levels of ingratia-tory behavoir are beneficial to the organization in that it may be a form of social glue that builds cohesive work groups in the absence of compatibility. In sum, ingratiation can be considered a form of upward influence in organizations whereby individuals from the bottom try to influence those above them on the organization ladder."28Um sein Ziel zu erreichen, Erhöhung des Beliebtheitsgrades, wird je-mand, der "Ingratiation" erfolgreich einsetzt, sich auf andere Menschen einlassen, Normen der Reziprozität aktivieren und sich somit von einem stereotypisierten "Outsider" zu einem beliebten "Insider" wandeln.29
Im Folgenden werden verschiedene Formen der "Ingratiation" im Einzelnen dargestellt:Opinion conformity
Individuen gehen davon aus, dass sie sich beliebt machen, indem sie die Meinung ihres Vorgesetzten teilen: "Ingratiators often capitalize on the similarity-attraction relation by becoming 'social cameleons': experts in the art of opinion conformity. They express opinions or act in ways consistent with another persons's attitudes, beliefs, and values so as to increase liking".30
25JONES, E. E. (1964), S. 11
26vgl. RALSTON, D. A. und ELSASS, P. M. (1989), S. 235 ff.
27ROSENFELD, P., GIACALONE, R. A., RIORDAN, C. A. (1995), S. 32
28RALSTON, D. A. (1985), S. 478
29ODOM, M. (1993), S. E-12
30ROSENFELD, P., GIACALONE, R. A., RIORDAN, C. A. (1995), S. 34