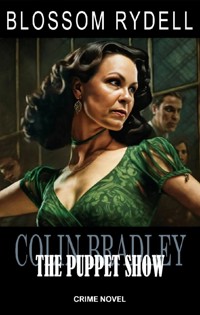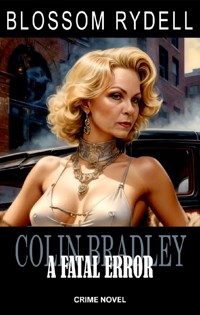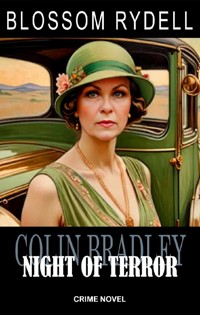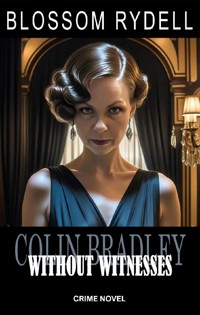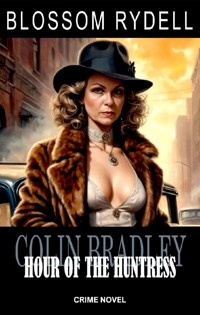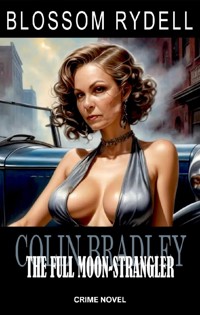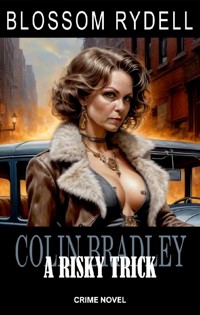Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Zwei Millionen Pfund Sterling in Goldbarren sind eine sichere Garantie für einen ruhigen Lebensabend. Das sagt sich auch Richard Cavendish – ein US-amerikanischer Multimillionär –, als ihn Mittelsmänner wissen lassen, dass ein blutrünstiger Diktator und Kleptokrat Staatsgold außer Landes und über den Atlantik in die Schweiz zu bringen versucht. Aber er benötigt Hilfe, um sich die verlockende Beute unter den Nagel reißen zu können, und spannt Colin Bradley unter einem Vorwand für sich ein. Doch er ahnt nicht, dass auch andere die gleiche Idee haben …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 168
Veröffentlichungsjahr: 2026
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Colin Bradley
IN SERIOUS DANGER
Crime Novel
Blossom Rydell
Bibliografische Information durch
die Deutsche Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
http://dnb.de abrufbar
1. Auflage 1984
2. Auflage 2025
ImpressumCopyright: © 2025 Blossom Rydell
Bissenkamp 1, 45731 WaltropDruck und Verlag: epubli GmbH, Berlin, www.epubli.deISBN siehe letzte Seite des Buchblocks
»Gold ist eine Kostbarkeit.
Jedem, der es besitzt,
erfüllt es alle Wünsche dieser Welt
und verhilft den Seelen ins Paradies.«
Christoph Columbus (1451 -1506)
Kapitel 1
Südatlantischer Ozean, Mitte der 1920er
Mit einem trägen, fast schon gelangweilt wirkenden Schlag der Flossen glitt der mächtige Leib des Tigerhais dicht unter der Wasseroberfläche dahin, deren Dünung ihn ein wenig anhob und absenkte, während seine dreieckige Finne in regelmäßigen Abständen durch das Wasser pflügte, überspült wurde und wieder eintauchte.
Durch das Wasser drang ein vertrautes Geräusch zu dem gefährlichen Raubfisch – eines, das von dem gleichmäßigen Stampfen eines Dieselmotors kam. Schon seit Tagen kreuzte das Schiff in dieser Gegend und ebenso lange folgte ihm das Raubtier. In wenigen Minuten würde die Sonne im Zenit stehen, dann würde der fast fünf Meter lange Tigerhai erwachen, die silbrig glänzende Spur des Schiffes suchen und nach den Abfällen schnappen, die jeden Tag um diese Zeit über Bord geworfen wurden.
Aber an diesem Tag kamen keine Abfälle. Es kam etwas anderes.
Hoch oben in der Luft brummte ein Flugzeug. Wie ein winziges Insekt kroch es über den tiefblauen Himmel. Es war eine ›Handley Page V‹. Eine von jenen, die die ›Royal Air Force‹ als ›Super Handley‹ noch im letzten Jahr des Großen Krieges in Dienst gestellt hatte. Doch letztlich waren die sechzig gebauten riesigen Doppeldecker nicht mehr zum Einsatz über feindlichem Gebiet gekommen und zum größten Teil entmilitarisiert und verkauft worden. Der Pilot in der offenen Kanzel trug eine Lederhaube, einen weißen Schal und ein Dress, wie man es vom Militär kannte.
Mühsam quälte sich die Maschine vorwärts. Die ehemaligen Bombenschächte waren zu einem Laderaum umgebaut worden, in dem eine Last verstaut war, die das untermotorisierte Flugzeug bis an die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit beanspruchte. Aber die vier ›Rolls-Royce-Eagle-VIII‹-Motoren zu je 380 PS in den beiden Motorgondeln hörten sich gesund an, und der Pilot grinste zufrieden, denn in weniger als zwei Stunden würde er sein Ziel erreichen.
Wenn er nach links aus der Kanzel blickte, sah er bis zum Horizont den Atlantik, der in der Sonne wie flüssiges Blei glänzte. Rechts, in etwa fünfzehn Seemeilen Entfernung, zog sich eine gewaltige dunkle Masse parallel zu seiner Flugbahn dahin: die Küste von Brasilien. Und was er dort sah, waren die von undurchdringlichem Dschungel bedeckten weiten Ebenen, eine ermüdende Gleichförmigkeit, die nur von einigen sich lang dahinstreckenden Höhenzügen unterbrochen wurde, die mit tropischem Urwald bewachsen waren, ebenso undurchdringlich wie der Dschungel, und in deren Tiefen immer Dämmerung herrschte und alle Mysterien und Grauen der Welt zu lauern schienen – ein riesiges, unerschlossenes Gebiet, in dem nur ein paar Ureinwohner hausten. Von dort, das wusste er, drohte ihm keine Gefahr. Eigentlich war es auch überflüssig gewesen, sich außerhalb der brasilianischen Hoheitsgewässer zu halten. Aber so hatte er es schon immer gehalten. Lieber einige Vorsichtsmaßnahmen zu viel als eine zu wenig. Es war ein Prinzip, das sich bewährt hatte, und die Last hinten im Laderaum war der beste Beweis dafür.
Zumindest bisher, denn plötzlich sah er die andere Maschine.
Es war das kurze, unerwartete Aufblitzen einer Frontscheibe, das ihn aus seinen Gedanken holte und auf sie aufmerksam werden ließ. Er musste die Augen fest zusammenkneifen, weil ihn die Sonne blendete. Aber der winzige schwarze Punkt war für ihn unübersehbar. Es war ein Flugzeug, das sich ihm mit einer Geschwindigkeit von höchstens hundertvierzig Stundenkilometern nur langsam näherte. Eine Zeit lang schien es sogar bewegungslos in der Luft stillzustehen, doch dann nahm es, fast schlagartig, feste Formen an. Die Tragflächen und der Rumpf waren jetzt durch das Fernglas, das er schnell zur Hand genommen hatte, deutlich zu erkennen; so deutlich, dass ein Irrtum ausgeschlossen war. Vor Verblüffung blieb ihm der Mund offen stehen, als das knatternde Motorengeräusch eines alten, einsitzigen, mit einem starr montierten Fahrwerk und Speichenrädern ausgestatteten Dreideckers die friedliche Stille über dem Atlantik zerriss.
Von den vorstehenden Zylinderköpfen des Reihenmotors abgesehen, besaß die Maschine eine aerodynamische Form, die sich hinter der offenen Pilotenkanzel tropfenförmig verjüngte. Der große hölzerne Propeller peitschte wie die Flügel einer alten Windmühle die Luft und trieb das Gefährt gemächlich voran. Die mit Leinwand bespannten Tragflächen knatterten im Fahrtwind und besaßen die an den Seiten ausgebogene Hinterkante, die für die ersten Flugzeuge so charakteristisch war. Von der Fronthaube bis zum hinteren Höhenleitwerk war die ganze Maschine knallgelb angestrichen. Er legte den Feldstecher zur Seite, als das Flugzeug jetzt unmittelbar hinter ihm war. Deutlich konnte er das schwarze ›Eiserne Kreuz‹ ausmachen, das Kennzeichen der Deutschen während des ›Großen Krieges‹.
Er zerquetschte einen Fluch zwischen den Zähnen. Als ehemaliger Jagdflieger kannte er diesen Trick natürlich, den Feind aus der Sonne heraus anzufliegen. Er selbst hatte ihn oft genug genutzt, um seinen Gegner anzugreifen. Aber zum Teufel, es ist Mitte der Zwanziger, dachte er bei sich und daran, dass ringsherum Friede herrschte, wenn er von den kleineren Konflikten, die es ja immer schon gegeben hatte, einmal absah.
Die andere Maschine schien das jedoch nicht zu kümmern, denn sie donnerte genau auf ihn zu. Er sah die Reflexionen des Aluminiumbeschlags der hölzernen Propellerscheibe und die drei auffälligen Tragflächen. Für einen Moment bildete er sich sogar ein, ein höhnisches Grinsen vom Gesicht des gegnerischen Piloten ablesen zu können.
Den Flugzeugtyp kannte er genau. Es war eine ältere ›Fokker DR 1‹, die vom deutschen Kaiserreich aus dem Wunsch entwickelt worden war, die gute Flugleistung und Wendigkeit der britischen ›Sopwith Triplane‹ zu kopieren. Mehr als einmal war er gegen sie im Luftkampf angetreten und einem Abschuss durch Manfred von Richthofen nur knapp entgangen, der ihn mit seiner rot lackierten Maschine bereits als nächstes Ziel im Fadenkreuz ausgemacht haben musste. Doch jetzt, keine zehn Jahre später, war sie bereits hoffnungslos veraltet. Trotzdem war sie immer noch schneller als seine ›Handley‹ und dafür konstruiert, Flugzeuge wie seines gnadenlos vom Himmel zu holen.
Er erfasste die Situation blitzartig, drückte das Steuerhorn nach vorn und zwang sein überlastetes Flugzeug in den Sturzflug.
Aus dem schlanken Leib der ›Fokker‹ stachen plötzlich Blitze und das Stakkato der beiden starren, synchronisiert durch den Propellerkreis feuernden ›08/15‹-Maschinengewehre übertönte das Dröhnen der Flugzeugmotoren.
Er spürte, wie seine ›Handley‹ erbebte, als ihr Rumpf ein paar Treffer abbekam, die er mit seinem Ausweichmanöver schnell aus der Schussbahn brachte.
Donnernd flog der Dreidecker vorbei, beschrieb eine enge Kurve und nahm die Verfolgung auf.
Er wusste, dass er keine Chance hatte, der ›Fokker‹ zu entkommen. Nicht, solange seine Maschine so überlastet war, denn es kostete ihn bereits alle Mühe, sie aus dem Sturzflug abzufangen.
Seine Gedanken rasten. Im Krieg hatte er solche Situationen über Frankreich oft genug erlebt, aber da waren sie immer im Pulk geflogen und hatten sich gegenseitig abgesichert. Nur einmal war er aus dem Rudel abgedrängt worden, und das war der Tag gewesen, an dem er dem schon sicheren Tod gerade noch von der Schippe gesprungen und dem ›Roten Baron‹ entkommen war.
Für einen Moment kam ihm der Gedanke, seine Last einfach abzuwerfen, um besser manövrieren zu können. Doch noch in derselben Sekunde presste er die Lippen zusammen, denn selbst wenn es ihm möglich gewesen wäre, hätte er seine Last um keinen Preis der Welt abgeworfen.
Er drehte den Kopf, als die ›Fokker‹ jetzt von hinten kam, und biss sich die Lippen blutig, als die sich langsam, aber unaufhaltsam an ihn heranarbeitete. Für solche Situationen brauchte er die Hilfe eines Heckschützen. Seine Maschine war dafür zwar mit einer entsprechenden Option versehen, aber er war allein – und es war ein verdammt bitteres Gefühl, diesem Angriff wehrlos ausgesetzt zu sein.
Er wartete, bis der Pilot im Dreidecker wieder das Feuer eröffnete, und riss seine ›Handley‹ dann scharf nach rechts, im Versuch, irgendwie noch übers Land zu kommen, denn das war seine einzige Chance, wenn er überhaupt noch eine hatte. Jetzt wusste er genau, worauf es dem Jäger ankam. Die ›Fokker‹ wollte ihn abschießen, solange er über dem offenen Meer war. Also galt es für ihn, schnellstens die Küste zu erreichen. Er mochte zwar nicht daran denken, wie eine Notlandung im dichten Dschungel ausfallen würde, aber es blieb ihm keine andere Wahl.
Sein Ausweichmanöver hatte ihm zwar einen kleinen Vorsprung verschafft, aber schon kurvte die wendigere ›Fokker‹ wieder heran. Erneut setzte er zum Sturzflug an, fing seine ›Handley‹ dicht über der Wasseroberfläche ab, ließ alle Vorsicht und alle Flugregeln außer Acht und schickte ein Stoßgebet zum Himmel, dass die Schweißnähte zwischen den Tragflächen und dem Rumpf hielten, als er seine Maschine wieder steil emporzog, indes rings um ihn die Vollmantel-Rundkopfgeschosse aus den beiden ›08/15ern‹ durch die Luft prasselten.
Er vermeinte zu spüren, wie die Nähte seiner völlig überforderten Maschine knackten, während die ›Fokker‹ mit spöttischer Leichtigkeit ihre Schleifen drehte. Ihm brach der Schweiß aus, der ihm jetzt in regelrechten Bächen über das Gesicht lief.
Aber noch war das Glück auf seiner Seite, und er näherte sich der Küste. Schon konnte er den hellen Streifen erkennen, der sich vor der dunklen Wand des Dschungels entlangzog – und schon glaubte er, Einzelheiten wahrzunehmen. Noch ein paar Minuten, sprach er sich in Gedanken Mut zu, dann habe ich es geschafft.
Doch dann erwischte es ihn endgültig, denn plötzlich stand die ›Fokker‹ schräg über ihm. Mit der Sonne im Rücken griff sie aus der für ihn denkbar ungünstigsten Position heraus an und jagte ihre tödlichen Projektile in langen Feuerstößen in den Leib seiner taumelnden ›Handley‹, aus deren Rumpf sich jetzt Fetzen lösten. Gleich darauf explodierte auch schon der Treibstofftank und seine Maschine zog eine riesige Rauchfahne hinter sich her.
Die ›Handley‹ taumelte dem Wasser zu, fing sich wieder, ging in den Gleitflug über und setzte dann hart auf dem Atlantik auf.
Der mächtige Tigerhai, eine knappe Meile entfernt, spürte den Aufschlag und erwachte aus seiner Trägheit. Der ausgemusterte Bomber sank infolge seiner schweren Ladung rasch in die Tiefe und das Wasser löschte den Brand, während ausströmendes Benzin brennend auf der Oberfläche des Meeres trieb.
Wie durch ein Wunder war der Pilot am Leben geblieben. Verzweifelt hämmerte er mit den Fäusten gegen die eingedrückten und ihn einengenden Wände seiner Kanzel. Er schlug sich fast die Fäuste blutig, bis es ihm gelang, sich aus seiner misslichen Lage zu befreien, schnappte sich die Schwimmweste und zwängte sich hinaus. Dann suchte er, mit wilden Schwimmbewegungen, dem Sog der untergehenden Maschine zu entkommen, ohne in die brennende Benzinlache zu geraten. Seine schwere Fliegerkombination saugte sich voll und zerrte ihn nach unten, bis er endlich in die Schwimmweste geschlüpft war. Dann trieb er im kalten Wasser und starrte nach oben. Er wusste, wie es nun weitergehen würde, denn schon donnerte sein Gegner im Tiefflug heran. Genau auf die Stelle zu, wo der Ölfleck und die treibenden Trümmer die Absturzstelle zeigten, und warf einen Farbbeutel ab. Der sich rasch ausbreitende gelbe Farbfleck würde die Stelle markieren, bis eine exakte Peilung vorgenommen worden war. Der Rest war ihm klar, zumal das Meer hier höchstens fünfzig Meter tief war. Letztlich also kein Problem für gut ausgebildete und ausgerüstete Taucher.
Er hätte vor Wut am liebsten heulen wollen, aber im Augenblick machte er sich andere Sorgen, weil ihn die Frage beschäftigte, ob ihn der Dreidecker entdeckte. Denn in diesem Fall würde dessen Pilot ein Scheibenschießen veranstalten. Aber selbst wenn er unentdeckt blieb, war es fraglich, ob er schwimmend ans Ufer gelangen würde. Er schätzte die Entfernung auf höchstens sechs Seemeilen – kein Problem, vorausgesetzt, es kam nichts dazwischen, wie eine ungünstige Strömung oder ein Hai.
Er tastete nach dem Gürtel mit den Signalpatronen, von denen er hoffte, dass sie trocken geblieben waren. Auch wenn er nicht recht daran glauben wollte, dass ihm ihre Wirkung im Fall der Fälle gegen Haie helfen würde, und er verspürte auch nicht die geringste Lust, es auszuprobieren.
Dagegen war die Wirkung klar, die das aus seinen verletzten Händen sickernde Blut haben würde. Mehr oder minder hilflos starrte er auf die dunklen Fäden, die sich im blauen Wasser verloren.
Genau zu diesem Zeitpunkt witterte der mächtige Tigerhai das Blut mit seiner stumpfen Nase und jagte los, und sein Kurs kreuzte sich mit dem des Schiffes, das jetzt ebenfalls Fahrt aufnahm – und auf dem sich ebenfalls Haie befanden …
… menschliche Haie.
***
Kapitel 2
Ein stämmiger, stiernackiger Mann betrat die offene Garage im Londoner Stadtteil Mayfair. Alles an ihm war unförmig, insbesondere der Schatten, den er auf den sauberen, geklinkerten Boden warf.
Dort war zunächst nur ein Paar lange Beine zu sehen, die in einem dunkelgrauen Overall steckten, indes der restliche Körper unter einem sportlich anmutenden blauen Wagen verschwand, einem aufgebockten›Cunningham Type V3‹. Langsam, fast schon in Zeitlupe, rollte der leicht ölverschmierte Monteur unter dem edlen Fahrzeug hervor und starrte den riesigen Burschen an, der sich wie ein bedrohlicher Eisberg vor ihm auftürmte.
»Hallo, Mister Bradley«, kam es dem Hünen über die Lippen, dessen rumpelnder Bass irgendwie an das Entgleisen eines Zuges erinnerte, während er Colin seine mächtige, behaarte Pranke zum Gruß entgegenstreckte. »Erfreut, Sie anzutreffen. Ich bin Jack Boysenberry.«
»Butcher oder Iceberg würde als Nachname eher zu Ihnen passen«, entfuhr es Colin, derweil er den Schraubenschlüssel zur Seite legte, sich auf seinem Rollbrett aufsetzte und seine mit Öl verschmierten Hände an einem alten Stofffetzen abputzte.
»Haha!«, lachte der Riese. »Das stimmt wohl. Ich weiß ja selbst, ich wirke auf viele, vor allem Kinder, wie ein ›Bugaboo‹. Aber Sie habe ich hoffentlich nicht erschreckt … oder etwa doch?«
»Nein, nicht im Geringsten, Mr. Boysenberry«, versicherte Colin ihm schmunzelnd. »Was kann ich für sie tun?«
»Ich komme im Auftrag von RichardCavendish«, verkündete Boysenberry gewichtig und wartete auf seine Reaktion.
Die kam auch, bestand allerdings nur in einem ratlosen Zucken der Achseln, weil Colin der Name nichts sagte. »Und?« Er erhob sich und massierte sich den Nacken.
»Richard Cavendish ist der Erdölkönig von Texas und über achtzig Millionen Dollar schwer«, klärte Boysenberry ihn auf.
»Verstehe«, erwiderte Colin trocken. »Und Sie helfen ihm, diese schwere Last zu tragen.«
Jack Boysenberry brauchte eine Weile, bis er das begriffen hatte, und nickte dann. »So kann man es ausdrücken. Ich bin sein Leibwächter.«
»Schön, Mr. Boysenberry. Aber was hat das mit mir zu tun? Ich meine, wir sind hier in London, Texas ist eine halbe Weltreise entfernt und nicht einfach mal so eben zu erreichen.«
»Das stimmt natürlich«, nickte der Riese. »Aber mein Boss hat einen Job für Sie.«
»Dankend abgelehnt.« Colin schüttelte den Kopf. »Ich übernehme zurzeit keine Arbeit, außerdem ist Texas nicht gerade mein Gebiet.«
»Ich weiß.« Boysenberry zog mit einem breiten Grinsen eine zusammengefaltete Zeitung aus der Jackentasche und tippte auf die riesige Schlagzeile auf der Titelseite. »Sie haben die Bande gehetzt, die für die Terrornacht in Padstow verantwortlich war, und jetzt wollen Sie sich erholen, mit ihrer Freundin in Paris und anschließend ans Mittelmeer zum Angeln. Vierzehn Tage, stimmt's?«
»Stimmt.«
»Aber Mr. Bradley, was wollen Sie dort schon angeln? Im Mittelmeer gibt es doch höchstens ein paar Sardinen. Winzige Dinger, die Sie mit einem Vergrößerungsglas suchen müssen, damit sie Ihnen an den Haken gehen.« Boysenberry machte eine wegwerfende Handbewegung. »Was wollen Sie mit denen anfangen, wenn es vor der texanischen Küste Schwertfische gibt, die bis zu acht Meter lang sind, und Haie von zwölf Zentnern, die Sie nur mit Hilfe eines Krans ins Boot hieven können? Das, Mr. Bradley, nenne ich angeln. Und dazu die hübschen ›Flapper-Girls‹ aus Richard Cavendishs privatem Harem!«
»Mir reicht meine Freundin, Mr. Boysenberry«, winkte Colin dankend ab und schaute ihn musternd an. »Besteht der Job darin, dass ich für Ihren Boss irgendetwas angeln soll?«
»Natürlich nicht. Das ist nur der Köder, damit Sie überhaupt nach Texas kommen. Mr. Cavendish ist davon überzeugt, dass Sie für ihn arbeiten werden. Wenn Sie es aber ablehnen, was Ihnen natürlich freisteht, lädt er Sie ein, auf unbestimmte Zeit sein Gast in Texas zu sein und mit seiner Yacht im Golf von Mexiko auf Großfischfang zu gehen. Ohne jede Verpflichtung für Sie. Nun, was sagen Sie dazu? Ist das ein Angebot?«
»Es klingt jedenfalls nicht schlecht, andererseits aber auch so, als würde es einen gewaltigen Haken geben. Und ich meine keinen, an dem am Ende ein Schwertfisch hängt.« Colin massierte sich das Kinn. »Ganz abgesehen davon, dass ich die Planänderung noch meiner Freundin beibringen muss.«
Boysenberry strahlte. »Oh, das werden Sie schon lösen, denke ich. Sehen Sie, achtzig Millionen auf dem Konto machen es Mr. Cavendish möglich, sich ausgesprochen großzügig zu zeigen. Versprechen Sie ihr ein teures Kleid, einen Mantel oder ein tolles Schmuckstück. Etwas, worauf Frauen anspringen … Aber, um es kurz zu machen: Auf dem Flugplatz steht schon eine Maschine bereit. Wir können also sofort aufbrechen.«
***
Kapitel 3
Die beschwerliche Flugreise nach Texas begann in Croydon und führte Colin nach Southampton, wo sie in eine moderne ›Supermarine Sea Eagle‹, einen einmotorigen Doppeldecker, umsteigen mussten. Das Flugboot mit der Kennung ›G-EBGR‹ gehörte der ›Imperial Airways‹ und wurde mit zwei weiteren eigentlich nur für eine regelmäßige Verbindung mit den Kanalinseln eingesetzt. Irgendwie war es dem amerikanischen Millionär aber gelungen, es für einen Flug über den Atlantik zu chartern, wo es für Colin und seinen Begleiter ab New York mit weiteren Zwischenstopps in einer dreisitzigen ›Waco 9‹ der ›Robertson Aircraft Corporation‹ weiterging, ehe die Maschine auf der staubigen Piste von ›Cavendish-City‹ in Texas aufsetzte.
›Cavendish-City‹, Richard Cavendishs Wohnsitz, bildete eine unerwartete und zugleich pittoreske Oase inmitten der ›Chihuahua‹-Wüste. Es war ein Herrenhaus im mexikanischen Stil – eine Hazienda, die sich durch ihre koloniale Pracht, ihren großen Innenhof, großzügig gestaltete Terrassen und viele Torbögen auszeichnete, dicke Mauern aus Adobe, Terrakotta-Dächer, bunte Fliesenböden und eine Integration in die Natur mit üppigen Gärten, umgeben von Palmen und Agaven. Die Zufahrtsstraße war ebenfalls von Palmen gesäumt. Nur ein Texaner konnte ermessen, was der Unterhalt einer solchen Oase inmitten der Wüste verschlingen musste.
Von der Rückbank des ›Chrysler B-70-Sedan‹, mit dem sie vom Flugplatz abgeholt wurden, besah sich Colin den Fahrer, einen Schrank von einem Mann, der ihn mit seinem stupiden Gesichtsausdruck, seinem breitrandigen Sombrero und den braunen hochhackigen Cowboystiefeln an einen einer Buster-Keaton-Klamotte entsprungenen, völlig verblödeten Sheriff erinnerte. Filme, die sie mittlerweile auch in den Londoner Kinos zeigten, an denen sich seine Freundin erfreute, die er aus Liebe dorthin begleitete, auch wenn er dabei sehr viel lieber dem Pianospieler lauschte, der dem Filmchen die nötige Atmosphäre verlieh. Ich schätze mal, er arbeitet in der gleichen Funktion wie Boysenberry für Cavendish, dachte er still, indes er über den amerikanischen Kleidungsstil noch innerlich den Kopf schüttelte und für sich festhielt, dass Cavendish es anscheinend nötig hatte, sich gleich mehrere Gorillas zum Schutz zu halten.
Kaum war der ›Chrysler‹ vor dem klimatisierten Patio ausgerollt, eilte ein dienstbeflissener, livrierter Mexikaner heran und riss die Tür auf. »Kommen Sie, Señor Bradley, kommen Sie. Hier entlang, Señor Cavendish erwartet Sie bereits.«
Durch eine große Tür aus Pinienholz betrat Colin die Eingangshalle der Hazienda, deren Ausmaße ihn unwillkürlich an eine Verkaufsebene bei ›Harrods‹ denken ließen. Mit ihrem Boden aus mexikanischen Azulejos, den Holzbalken und Bögen, traditionellen Möbeln und der reichhaltigen Pflanzendekoration schien sie das monumentale Herzstück des Hauses zu sein. Die im hinteren Bereich geöffneten Türen gaben über die Terrasse hinweg den Blick auf ein strahlend blaues Schwimmbecken frei.
Die schreiend bunten und zu einem großen Bild zusammengefügten Mosaikfliesen ließen die Schritte des Hausherrn vernehmen, der jetzt mit klappernden Sporen auf sie zukam – ein drahtiger Mann und mindestens einen ganzen Kopf kleiner als Colin. Richard Cavendish wirkte straff wie eine Stahlfeder. Sein Gesicht war so scharf gezeichnet wie der Kopf eines römischen Cäsaren, und trotz seiner geringen Körpergröße schaffte er es irgendwie, seine Umwelt wie ein mächtiger römischer Imperator zu überragen.