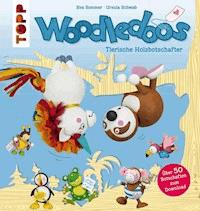6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Jutta und Alexander wünschen sich sehnlichst ein Baby, doch Jutta wird einfach nicht schwanger. Eine künstliche Befruchtung kommt für die beiden nicht in Frage. So entschließen sie sich für eine Adoption. Doch kaum haben sie die kleine Nelly aus Äthiopien abgeholt, gibt es »gute Neuigkeiten«: Jutta ist schwanger – mit Zwillingen! Plötzlich sind Jutta und Alexander eine Großfamilie und Jubel, Trubel, Heiserkeit nehmen ihren Lauf: Kampf-Stillerinnen und Mütterversteher nerven, die Wohnung platzt aus allen Nähten und was passiert, wenn aus drei niedlichen Babies drei kleine Frechdachse werden, hat einem auch keiner vorher gesagt!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 355
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Eva & Moritz Sommer
In Unterzahl
Ein Vater-Mutter-Kind-Kind-Kind-Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Jutta und Alexander wünschen sich sehnlichst ein Baby, doch Jutta wird einfach nicht schwanger. Eine künstliche Befruchtung kommt für die beiden nicht in Frage. So entschließen sie sich für eine Adoption. Doch kaum haben sie die kleine Nelly aus Äthiopien abgeholt, gibt es »gute Neuigkeiten«: Jutta ist schwanger – mit Zwillingen! Plötzlich sind Jutta und Alexander eine Großfamilie und Jubel, Trubel, Heiserkeit nehmen ihren Lauf: Kampf-Stillerinnen und Mütterversteher nerven, die Wohnung platzt aus allen Nähten und was passiert, wenn aus drei niedlichen Babys drei kleine Frechdachse werden, hat einem auch keiner vorher gesagt!
Inhaltsübersicht
1. Akt
Alexander
Jutta
Alexander
Jutta
Alexander
Jutta
Alexander
Jutta
Alexander
Jutta
Alexander
Jutta
2. Akt
Alexander
Jutta
Alexander
Jutta
Alexander
Jutta
Alexander
Jutta
Alexander
Jutta
3. Akt
Alexander
Jutta
Alexander
Jutta
Alexander
Jutta
4. Akt
Alexander
Jutta
Alexander
Jutta
Alexander
Jutta
5. Akt
Alexander
Jutta
Alexander
Jutta
Alexander
1. Akt
»Das hat wieder nicht funktioniert – trotz App.«
Alexander
Das war jetzt wieder nix«, seufzt Jutta.
Zwanzig Sekunden nach dem Sex ist so ein Satz an und für sich keine freundliche Geste. Aber die Sache ist ganz anders, ehrlich. So wie Jutta jetzt entspannt und noch immer ein bisschen kurzatmig neben mir liegt, kann es nicht so schlimm gewesen sein. Glaube ich zumindest. Es war ja auch nicht das erste Mal. Und Jutta hält es nun schon sechs Jahre mit mir aus. Also, da hätte sie ja schon vorher bestimmt mal was gesagt, von wegen Schmarrn im Bett und so.
Dass ich auch nach dem Sex noch gern bei ihr bin, ist für mich der beste Beweis, dass ich sie liebe. Ich mag es einfach, wie sie mit ihren halblangen braunen Locken neben mir in der Dämmerung sinniert. Jutta hat mir nie das Gefühl gegeben, ich müsste so schnell wie möglich flüchten, sobald ich meine Kleidung im Raum geortet habe. Das war in der Vergangenheit, also in der Vor-Jutta-Zeit, ganz anders. Früher endete so manche Liebesnacht mit einem großen Fluchtreflex. Wenn es die Situation erforderte, war ich dabei ähnlich akrobatisch wie die Larve des Sandlaufkäfers.
Jutta blickt auf ihr Handy und legt es enttäuscht weg. »Nein, das hat wieder nicht funktioniert«, wiederholt sie. »Trotz App. Heute ist doch der dritte Oktober, oder? Ich müsste gerade sehr fruchtbar sein. Aber ich spüre richtig, wie das jetzt wieder nicht eingeschlagen hat.«
Sie reibt sich den Bauch.
»Ab jetzt gibt’s Sex wieder zum Vergnügen und nicht, weil wir ein Kind wollen, Alex. Schluss. Aus. Ende.«
Ich drehe mich zur Seite und stütze den Kopf auf meine rechte Hand.
»Ich dachte, das muss sich nicht ausschließen.«
Jutta schüttelt den Kopf.
»Eh nicht, aber irgendwie hatte ich schon gehofft, dass es hier in der Therme funktioniert. Entspannter als in diesem Riesenplanschbecken kann mein Körper gar nicht mehr werden. Die Intuition sagt trotzdem: nein, es hat wieder nicht geklappt. Und damit meine ich die weibliche Intuition, nicht die männliche Phantasie. Die reicht sowieso kaum mal weiter als bis zu unseren Brustspitzen.« Damit klatscht sie meine linke Hand auf ihren Busen und starrt nachdenklich und mit leichtem Kopfwackeln an die Decke.
Als Biologe kann ich mit so großen Worten wie »Intuition« naturgemäß nichts anfangen. Weder hat man sie jemals als Zellstruktur entdeckt oder im Gehirn lokalisiert, noch habe ich bisher jemanden getroffen, auf dessen Intuitionen man sich verlassen konnte. Aber sei’s drum. Ich liebe Jutta nun einmal und akzeptiere dann auch gerne ihre Intuitionen. Ihren Körper kennt sie mit Sicherheit besser als ich. Egal, wie sie das jetzt nennt.
Sex nach Fruchtbarkeitskalender ist jedenfalls ein ganz eigenes Ding. Irgendwie nicht ganz so spaßig. Auch nicht, wenn der Fortpflanzungsmediziner ein modernes Smartphone ist. Jutta hat sich in ihrer App-Manie das Programm schon vor einem halben Jahr für ihr iPhone heruntergeladen. Es heißt lapidar »Kinderwunsch«. Ich hätte es »iSprung« genannt. Heute steht drohend der Schriftzug »Sehr fruchtbar« auf der rosa Oberfläche des Handys. Jutta hat mir von ihrem iSprung freundlicherweise auch noch eine Erinnerungsmail schicken lassen. Vor einer halben Stunde.
»Mach mir ein Baby«, stand da drin.
Gut, bitten lasse ich mich da nicht lange. Zumal es ja ein gemeinsames Projekt ist. Derlei Mails habe ich im letzten halben Jahr rund ein Dutzend Mal von ihrem iSprung bekommen. Zumindest biologisch hat das allerdings nichts genutzt. Die fruchtbaren Tage waren so fruchtbar nicht. Aber, ehrlich gesagt: Das ist mir ziemlich wurscht. Unser Kinderprojekt hat unser Liebesleben jedenfalls erheblich gepusht. Und als Mann hinterfragt man selten die Beweggründe, wenn der Weg ins Bett ein kurzer ist.
Es ist nicht so, dass wir ein Kind unbedingt brauchen würden, aber wir bemühen uns jetzt schon fast drei Jahre lang, schwanger zu werden. Jutta wird bald sechsunddreißig. Das ist nicht mehr das gebärfähigste Alter. Und ich bin noch ein paar Jährchen älter.
Natürlich haben wir schon alle möglichen Untersuchungen gemacht. Ich habe vor zwei Jahren sogar mit dem Rauchen aufgehört. Das bisschen, das ich geraucht habe, kann ich auch trinken, sage ich immer. Also zu meinen Bandkollegen, die das ziemlich daneben finden, das mit dem Nichtrauchen. Das verdirbt die Bühnenluft, sagt Hell immer. Der muss es wissen. Er kann ja nur noch durch Glimmstengel atmen. Wenn man ihm sein Tschickpackerl wegnähme, würde er wahrscheinlich tot umfallen. Mir hat das Nichtrauchen ganz gutgetan. Das ist, als würde man aus der dünnen Bergluft des Titicacasees auf Meereshöhe herunterziehen. Wahnsinn, wie viel Sauerstoff man plötzlich zur Verfügung hat. Dafür hat Jutta begonnen, ab und zu mal eine auf der Terrasse zu rauchen. Manchmal glaube ich, sie tut das nur aus Kummer, weil wir bislang nicht schwanger geworden sind, also zumindest nicht länger als ein paar Wochen. Schon seltsam, wie so eine moderne Frau, die eigentlich nie ein Kind haben wollte, plötzlich in den Gebärwahn hineinkippt.
Wie gesagt, wir haben ja alle möglichen Untersuchungen gemacht. Aber leider war alles okay bei uns. Das heißt natürlich nicht leider, sondern zum Glück. Es funktioniert eben nur einfach nicht mit Biene und Blümchen bei uns. Klar haben wir mal über eine künstliche Befruchtung diskutiert, aber nur kurz. Irgendwie sind wir noch nicht reif dafür. Und seit Jutta diese Reportage über die afrikanischen Mädchen gemacht hat, ist das Thema sowieso vom Tisch. Sie war mit einer Hilfsorganisation in Afrika und hat sich angesehen, wie ein Brunnen das Leben von Frauen und Kindern verändern kann. Die müssen traditionell das Wasser holen und sind oft einen ganzen Tag unterwegs, um ein paar Liter Wasser in ihr Dorf zu bringen. Darum können die Mädchen nicht zur Schule gehen und finden nie aus ihrem Elend heraus. Jutta hat mit einem Kamerateam dokumentiert, mit welch geringem Aufwand man den Frauen und Kindern dort Hoffnung und eine Zukunft jenseits des Wasserkruges geben kann. Und seit dieser Zeit will sie ein Kind aus Afrika adoptieren, wenn es bei uns auf natürlichem Weg dauerhaft nicht klappen sollte.
Bei den Käfern ist das mit dem Kinderkriegen viel einfacher. Da gibt es ein paar, die brauchen gar keinen Partner, sondern erledigen die Geschichte mit dem Nachwuchs einfach durch Jungfernzeugung. Für mich wär’s ein ziemlicher Verlust, wenn Jutta mich als Geschlechtspartner nicht mehr brauchen würde, aber biologisch gesehen ist das eine super Sache. Die Felsenspringer, zum Beispiel, da gibt’s Populationen ganz ohne Männchen. Und trotzdem bringen sie Kinder zur Welt. Gut, die leben irgendwo weit oben in den Alpen. Da ist es mit der Partnersuche natürlich so eine Sache. Bei uns in Wien funktioniert zumindest dieser Teil der Fortpflanzung wesentlich einfacher.
»Denkst du schon wieder an Sex? Oder an deine Käfer?«, fragt Jutta, als hätte sie meine Gedankenwanderungen erraten.
»An beides.«
Ich springe so agil wie möglich auf, so wie die Sandkäferlarve, nur ohne Fluchtgedanken, und ziehe Jutta aus dem Bett. Ein kleiner Stich in der Schulter verrät, dass es mit der Agilität auch schon mal besser war. Ich werfe Jutta den weißen Bademantel zu.
»Wir gehen jetzt noch mal runter in den Spa-Bereich.«
Die Welt scheidet sich in Reich und Arm – das ist sozusagen der alte Nord-Süd-Konflikt, sowie in Familien und Kinderlose. Diese neue Demarkationslinie zeigt sich in unserer Therme in Form einer überdimensionalen Glaswand, die den Familienbereich mit bunten Rutschen und Sprudelbädern von jenem Areal trennt, in dem sich die Dinks1, Bobos2 und Was-auch-immer erholen, sozusagen die Aperol-Entourage. Diesseits ist es so ruhig, dass man ganz fein das Leben von der anderen Seite hören kann. Wenn ein Solariendeckel unedel quietscht, schrickt der gemeine Leistungsträger, der sich hier von seinem Computerarbeitsplatz und der vermeintlich überbordenden Verantwortung erholt, mürrisch auf.
Jenseits, also auf der Familienseite, machen die kleinen Erdenbürger Kilometer. Will heißen, da ist Bewegung drin und Leben. Stille ist dort ein unbekannter Aggregatzustand des Daseins. Elternpaare sind zu Dutzenden damit beschäftigt, ihre Kinder davon abzuhalten, die Rutsche in ihre Einzelteile zu zerlegen, sich in der Sprudelanlage selbst zu opfern oder auf den Fußsohlen über die nassen Fliesen zu skaten.
Jutta starrt schon wieder so versonnen hinüber und schüttelt den Kopf.
»Ich glaube, dass man Kinder gar nicht braucht zum Glücklichsein«, sagt sie mit leiser Stimme. Seufzend lässt sie sich auf ihre Rattanliege sinken. Von der anderen Seite starren viele sehnsüchtig zurück in die diesseitige Ruheoase. Lange haben sie nicht dafür Zeit, weil sie sich schon wieder auf die Suche nach ihren hyperaktiven Sprösslingen machen müssen. Wahrscheinlich ist das gar nicht so schön, wenn man mal von sich selbst absehen muss und wirklich Verantwortung hat, nicht nur die behauptete.
Unglücklich, aber bis zum Anschlag entspannt fahren wir einen Tag später aus der burgenländischen Therme zurück nach Wien.
Jutta
Erste Vierlingsgeburt in Österreich seit zehn Jahren.« Diese Meldung hat mein Chef ausgerechnet mir heute Morgen auf den Tisch geknallt. »Das ist doch ein Thema für unsere Jutta«, hat er süffisant gemeint. »Bist ja gerade noch im gebärfähigen Alter, oder?« Achim Trauner, mein Vorgesetzter, lässt gerne bei jeder Gelegenheit seinen eigenwilligen Charme spielen. Die Vierlingsstory steht für die Abendsendung auf dem Programm. Und ich soll sie machen. Na super, nur weil ein übereifriger Reproduktionsmediziner wieder mal nicht zählen konnte. Anstelle von einem befruchteten Ei hat er vermutlich gleich eine Handvoll in die Gebärmutter eingesetzt.
Nein, künstliche Befruchtung kommt für mich überhaupt nicht in Frage. Nicht, weil ich grundsätzlich dagegen bin, sondern weil es ohnehin so viele Kinder auf der Welt gibt, die keiner haben will. Eines davon werde ich retten.
Nach meiner Afrika-Reportage vor eineinhalb Jahren haben Alex und ich uns vorsichtig erkundigt, wie schwierig so eine Adoption ist. Bis man sein Schokobaby endlich in Händen hält, wird die Geduld auf eine harte Probe gestellt. Das hat uns irgendwie angespornt. Zuerst mussten wir den Verein finden, der uns hilft, ein Kind aus Äthiopien zu adoptieren. Dann kam dieser ganze Papierkram mit dem Jugendamt und der Landesregierung. Schließlich dieser unangenehme Kurs, den wir absolvieren mussten, um sozusagen »adoptionstauglich« zu werden. Das alles ist innerhalb von vierzehn Monaten passiert.
Jetzt warten wir. Wir machen uns vorläufig nicht allzu viel Hoffnung auf ein Kind. Angeblich gibt es Wartezeiten von bis zu drei Jahren.
Das mit dem »Selbermachen« haben Alex und ich nach unserem missglückten Thermenbesuch vor drei Wochen endgültig aufgegeben. Nicht einmal in entspannter Atmosphäre hat’s mit der Fortpflanzung geklappt. Dabei harmonieren wir eigentlich perfekt, nicht nur sexuell. Nur hormonell laufen wir leider nicht so rund. Drei Jahre ohne Verhütung, und wir sind von einer Schwangerschaft so weit entfernt wie ein Eisbär von der Antarktis. Und das, obwohl wir ziemlich aktiv sind in Sachen Babyanbahnung. Andere lassen einmal die Hosen runter und neun Monate später fahren sie den Nachwuchs spazieren.
»Na, wann ist es bei dir so weit? Mir ist schon aufgefallen, dass du deutlich zugenommen hast.«
Konstanze, eine Kollegin, die ich in etwa so schätze wie Windpocken im Urlaub, steht in der Tür. Warum bloß habe ich ihr mal verraten, dass ich ein Kind will?
»Ich trage gerne Übergrößen. Das ist weitaus gemütlicher, als wenn sich die Speckfalten durch zu enge Blusen abzeichnen«, antworte ich wie aus der Pistole geschossen. Dabei schaue ich Konstanze abschätzig auf den Bauch.
»Deine Vorliebe für Fetzen in Größe 42 ist mir an dir bisher gar nicht aufgefallen«, feixt meine Kollegin weiter. »Hast du eigentlich schon ein Kamerateam für den Dreh bestellt?«
Konstanze entgeht einfach nichts. Sie nutzt jede Möglichkeit, andere zu provozieren. Leider hat sie recht. Das Kamerateam habe ich völlig vergessen, während ich über meiner persönlichen Kindermisere gebrütet habe. Was ich mir nicht sofort aufschreibe, vergesse ich einfach kurz darauf. Ohne mein Notizbuch auf meinem Smartphone wäre ich nicht lebensfähig. Das behauptet zumindest Alex immer, und der muss es ja wissen. Nicht einmal den für die Vierlingsgeburt zuständigen Arzt und die Eltern der Neugeborenen habe ich angerufen. Heute klappt es mit der Organisation nicht richtig, dabei arbeite ich normalerweise sehr strukturiert. Das Baby-Thema irritiert mich offenbar mehr, als mir guttut.
Mein Hals fühlt sich verspannt an. Glücklicherweise hat mein iPhone für alles eine Lösung. Ich starte die Massage-App und lege mir das leise vibrierende Handy auf die Schulter. Das ist vielleicht nicht die Art von Zuwendung, die ich jetzt bräuchte, aber irgendwie tut es gut, wenn sich jemand um kleine Probleme kümmert, auch wenn es eine Maschine ist.
Mal sehen, was bei den Interviews herauskommt. Damit steht und fällt mein heutiger Fernsehbericht. Die Eltern der vier Wonneproppen werden wahrscheinlich sagen, dass sie ihr Glück noch gar nicht fassen können. Der Arzt wird erklären, wie schwierig es war, dem Paar zum Nachwuchs zu verhelfen. Manchmal weiß man als Journalistin bereits vor einem Interview, was die Leute sagen werden.
Manchmal! Diesmal habe ich mich ziemlich getäuscht. Ich finde auf der Geburtenstation eine heulende Mutter vor, die sich außerstande sieht, die vier Kinder großzuziehen. Der vermeintlich stolze Vater schaukelt nicht wie vermutet mindestens zwei seiner Sprösslinge, sondern ist ausschließlich damit beschäftigt, seine Frau zu trösten. So ein Jammerbild soll ich im Fernsehen zeigen? Da bekomme ich ja Morddrohungen von der Müttermafia. Einzig der zuständige Arzt ist zufrieden mit seinem Werk. Aber das war sowieso klar.
Ich sehe zu, dass das Kamerateam die herzigen Babys filmt und alles Weitere, was ich für den Fernsehbericht benötige – Großaufnahmen von Babyspielzeug, einen herumliegenden Plüschlöwen, die Händchen im Vergleich zu einer Erwachsenenhand, das volle Programm eben. Zuletzt kann ich sogar den Vater noch zu einer Wortspende überreden.
Glücklicherweise hat der Gott in Weiß keine Redehemmung. Er plaudert wie ein Wasserfall. Das heißt, die notwendigen OTs, die »Originaltöne«, sind schnell im Kasten.
»Frau Journalistin, haben Sie auch Kinder?«
Ich hasse Ärzte. Immer wieder das gleiche Erlebnis. Viele respektieren weder meinen Beruf noch das weibliche Geschlecht. Und dann noch dieser gehässige Volltreffer.
»Danke, nein, das Interesse daran ist mir spätestens heute vergangen. Sehen alle Eltern dermaßen unglücklich aus?«
Ich deute mit dem Kopf auf die heulende Vierlingsmutter, die sich mit ihrem Unglück in sicherer Entfernung befindet und mich nicht hören kann.
»Ich mache Ihnen ein Baby, das Sie glücklich macht. Vertrauen Sie mir, Frau Schweiger.«
Der Erschaffer der befruchteten Embryos grinst siegessicher.
»Herzlichen Dank, ich halte wie im Fernsehen mehr von Eigenproduktionen als von Übernahmen.«
So, jetzt schweigt sogar der überhebliche Herr Doktor kurz. Ich reiße dem Kamerateam buchstäblich die Disk aus dem Gerät und mache mich so schnell wie möglich aus dem Staub, bevor ich vielleicht vor dem professionellen Babymacher zu heulen beginne.
Hoffentlich steht ein Taxi vor der Tür. Den Text für den Fernsehbericht muss ich während der Fahrt schreiben, damit ich nach der Rückkehr ins Fernsehgebäude sofort in den Schneideraum zischen kann.
Die Zeit läuft, die Sendung soll wie immer gnadenlos pünktlich beginnen. Puuuhhh! Manchmal sitzt mir der Sekundenzeiger bei der Arbeit wirklich im Nacken. Das glaubt einem ja keiner. Die Leute meinen, man hätte den geilsten Job der Welt, dabei ist alles in Wahrheit Knochenarbeit und die reinste Adrenalinkur. Gesund ist was anderes.
Einzig meine Freundin Astrid versteht, wenn ich ihr erkläre, wie stressig meine Arbeitstage sind. Sie ist Redakteurin bei einer österreichischen Tageszeitung, einem Qualitätsblatt, wie man so schön sagt, um den eigenen Schmarrn für das gebildete Publikum etwas aufzuwerten. Wir haben uns während unseres Studiums kennengelernt. Astrid weiß alles über mich und ich über sie. Sie weiß auch, dass es bei uns mit der Fortpflanzung nicht klappt. Ich habe ihr sogar erzählt, dass ich Alex immer verführe, wenn ich glaube fruchtbar zu sein. Er ist ohnehin dauernd bereit, und ich tue eben so, als ob ich schrecklich scharf auf ihn wäre. Manchmal stimmt es ja, aber eben nicht immer. Ein bisschen schummeln darf man schon. Männer merken das nicht. Ein Telefongespräch mit Astrid ist längst überfällig.
Der heutige Tag hat Erbarmen mit mir. Andreas, der sympathischste und beste unter den Cuttern, sitzt entspannt im Schneideraum.
»Hallo, du Fleißiger«, begrüße ich ihn und werfe ihm die Disk mit den Aufnahmen zu, damit er sie in den Computer einspielen kann. Andreas schiebt sie schmunzelnd in das Abspielgerät. »Heute geht’s um Kinder, habe ich der Sendeliste entnommen. Da kenne ich mich wenigstens aus. Meine drei haben mich heute früh wieder gequält.« Er schüttelt den Kopf, als würde er die Familienbilder vor seinem inneren Auge sehen. »Ich sag’s dir, der Wahnsinn in Leibhaftigkeit.«
Ich lache halbherzig und wünsche mir, dass ich irgendwann einmal Ähnliches werde erzählen können. Während Andreas die Bilder aus dem Krankenhaus sichtet und sich ein Schnittkonzept überlegt, tippe ich schnell den Text für den Fernsehbericht ab. Das Drehmaterial huscht im Schnelldurchgang über die Bildschirme. Dann geht’s etwas langsamer weiter. Andreas fügt ähnlich wie bei Copy und Paste Einstellung für Einstellung aneinander. Der Zeiger nähert sich schon bedrohlich dem Sendebeginn, als Andreas das Schlussbild auf die Videospur zieht – eine Einstellung der Vierlinge, während gerade einmal keiner schreit.
Als Andreas die Lautstärke anpasst, höre ich bereits die Kennmelodie der Sendung. Unser Bericht kommt in drei Minuten dran. Mein cooler Cutter sieht auf die Uhr und drückt auf den Speicher-Button. Gelassen beobachte ich den Balken, der sich zunehmend grün färbt. Zwei Minuten nach sechs ist der Bericht auf dem Server und damit sendefertig.
Wie es aussieht, geht heute alles wie geplant on Air – und zwar ohne Zittern und Nervenkitzel. Ich werfe noch einmal einen Blick in die Sendeliste und packe währenddessen meine Notizen ein. Andreas macht den Schnittplatz sauber. Mittlerweile sind alle Beiträge in der Sendeliste grün. Das heißt, sie liegen fertig auf dem Server. Auch Achim Trauner wirkt zufrieden. Im tiefsten Vorarlberger Dialekt funkt er in den Schneideraum: »Großartig, diese Tränen, gute Herzschmerz-Geschichte, Frau Kollegin.«
Ich ignoriere ihn und verlasse das Fernsehgebäude, um ein paar Erledigungen im Supermarkt zu machen. Beeilen mit dem Nachhausekommen muss ich mich nicht, denn heute ist Montag. Montag hat Alex Bandprobe, daran ist kein Vorbeikommen. Alex hat sich seinen Jugendtraum erfüllt und spielt Bass in einer Garagenband. Was auch immer das sein mag, ich kenne mich damit nicht so aus. Die Musik klingt gut, so richtig fetzig. Leider kennt Onion Pie kaum jemand. Wundern tut mich das nicht, bei diesem doofen Bandnamen. Den würde ich schleunigst ändern. Die Bandmitglieder Alex, Erik, Norman und vor allem Hell finden Onion Pie aber cool. Wenn schon etwas cool an dieser Band ist, dann einzig Alex, wie er mit seinem durchtrainierten Körper, dem eng anliegenden T-Shirt und seinen blonden kurzen Haaren auf der Bühne steht und die Bassgitarre bearbeitet.
Heute Abend gibt’s bei mir Kontrastprogramm. Ich werde mir eine romantische Schnulzenoper im Fernsehen reinziehen. Auf einem unserer siebzig Kanäle wird ja wohl etwas im Stil von »Hochzeit auf Schloss Landskron« zu finden sein.
Alexander
Hell ist so ziemlich der sanfteste Rocker, den man sich vorstellen kann. Natürlich hat er auf seinem behaarten Oberarm den obligaten Totenkopf tätowiert. Ein schauriger Schädel, der im Piratenstil ein Messer zwischen den Zähnen trägt. Und bei der Begrüßung streckt Hell Zeigefinger und kleinen Finger der rechten Hand in die Höhe, während er sich wie unter einer Nierenkolik verbiegt. In Wirklichkeit ist er ein echt cooler Typ, der es nicht nötig hat, sich hinter diesen Versatzstücken des Rockerlebens zu verbergen.
Hell kann nichts aus der Bahn werfen. Maximal Kinder, aber da er keine hat und auch keine plant, könnte ich nicht mal das beschwören.
Ich drücke dreimal auf die Klingeltaste, die mit dem Namen »Hellweg« beschriftet ist. Dass er einen Vornamen hat, haben wir nur durch Zufall erfahren.
»Servus, Ale«, begrüßt mich Hell und streckt seine Fingerhörner in die Höhe, als müsste er sich damit beide Augen ausstechen. Hell spricht »Ale« wie das englische Bier aus. Auch das ist so ein Relikt von einem Auftritt in einem Pub, als wir uns nach unseren zwanzig Nummern nur mehr mit Mühe geradehalten konnten. Am Schluss bin ich dann noch über mein Kabel gestolpert. Aber zu diesem Zeitpunkt war auch das Publikum schon so hinüber, dass die meisten das für einen Teil der Show hielten.
Wir treffen uns vor der Bandprobe immer zu einem kleinen Umtrunk in seiner Bude. Bude ist etwas untertrieben. Es ist eine schräge Wohnung, in der zirka ein Dutzend Gitarren herumstehen und so aussehen, als würden sie auch benutzt. Als Sohn von Bauern hasst er alles, was an Bäume und Natur erinnert. Maximal im Gitarrenkorpus erlaubt er Holz, dann allerdings muss es exotisch sein und von weit her kommen.
»Plastik statt Fichte«, sagt Hell. Deshalb hat er beim Interieur einen deutlichen Schwerpunkt auf Kunststoffe gesetzt, dazwischen gibt es einige Glasmöbel. Die werden immer dann mehr, wenn es ihm finanziell gerade wieder etwas bessergeht. Sein Hass auf alles Bäuerliche gipfelte in einem Song, dessen Refrain unter anderem mit den denkwürdigen Lines aufwartet: »Get rid of our farmers, bury them all. They are consuming nature and people and wait for subventions in fall.«
Nicht, dass das unser größter Hit geworden wäre. Wir singen dieses Relikt aus einer zornigen Zeit auch nur in Zentrumsnähe von Großstädten, nie am Stadtrand, nie auf dem Land. Nicht auszudenken, was uns pazifistischen Altrockern passieren könnte, wenn sich ein wütender, anglophiler Agrarier in unser Konzert verirrt. Eine Mistgabel im Bauch macht keinen schlanken Fuß, sage ich immer.
Hell jedenfalls lebt sein landwirtschaftliches Misstrauen. Lieber würde er sich mit Analogkäse umbringen, als Topfen aus heimischer Erzeugung zu essen. Sein Kühlschrank beherbergt quasi nur unverderbliche Lebensmittel und wäre wohl eher eine Fundgrube für einen Kunststofftechniker als für einen Biologen. In Sachen Ernährung ist Bier so ziemlich das Naturnächste, das Hell aufbieten kann.
Unaufgefordert stellt er mir auch schon eine Dose Gerstensaft hin. Ich sinke zufrieden auf Hells aufblasbare Plastikcouch. Auf dem Glastisch, dessen Füße aus vier umgedrehten Bierkisten bestehen, liegt ein Nietenarmband. Ich deute mit dem Kopf hin.
»Zweite Pubertät?«
Hell schüttelt den Kopf und stößt seine Dose gegen meine.
»Nein, ist nicht für mich. Für einen Altrocker bin ich noch zu jung. Es ist ein Geschenk für den Ältesten meiner Süßen. Er ist fünfzehn und möchte jetzt E-Gitarre lernen.«
»Sag bloß, das ist jetzt mal was Ernstes mit einer Frau?«
Hell zuckt mit den Schultern.
»Wie das mit Loana weitergeht, kann ich nicht sagen. Aber ihre vier Kinder sind cool.«
Er nimmt einen tiefen Schluck, so tief, dass er die Dose mit der rechten Hand mülltauglich zerquetscht, als er sie wieder absetzt.
Loana stammt irgendwo aus Mittelamerika und hat vier Kinder von fünf Männern. Oder so ähnlich. Seit fünf Jahren lebt sie in Österreich. Hier hat sie erst zwei Männer verschlissen, die allesamt brav ihre Alimente zahlen. Obwohl sie kaum höher ist als ein Stehtisch, ist sie echt eine Frau mit Statur, innerlich wie äußerlich. Einfach ein starkes Weib. Das merkt man spätestens, wenn sie den Mund aufmacht. Nun ja, der charmante spanische Akzent tut auch sein Übriges. Zumindest bei Hell, der seit einiger Zeit erstaunlich gelassen wirkt.
»Wirklich kindertauglich ist deine Wohnung ja nicht.« Ich tippe von der Couch aus auf eine seiner E-Gitarren.
»Muss sie auch nicht sein. Ich habe nicht vor, mit Loana zusammenzuziehen. Ihre Ältesten passen schon auf die jüngeren Kids auf. So kann sie ohne Probleme und ohne teuren Babysitter bei mir übernachten.«
»Vielleicht wärst du ja der ideale Papa.«
Hell schüttelt vehement den Kopf und knackt die nächste Dose.
»Ich bin mit vier Geschwistern aufgewachsen. Ich ertrage alles um mich herum, jeden finanziellen Durchhänger, Platten, aus denen nichts wird, und so fort. Du kennst mich ja. Aber vier Kinder? Nein! Da gründe ich eher ein volkstümliches Trio.«
Wer Hell kennt, weiß, dass er zwischen Tod und volkstümlicher Musik lieber den Tod wählen würde. Irgendwie hat er Probleme mit seinem Elternhaus, obwohl er seine Mutter sehr mag und mindestens einmal in der Woche mit der Altbäuerin telefoniert. Den Hof seiner Eltern, den jetzt ein Bruder bewirtschaftet, hat er seit sieben Jahren nicht mehr besucht. Er trifft sich nur auf neutralem Boden mit seinen Verwandten, sagt er. Zu seinem Leidwesen findet diese familiäre Zusammenkunft immer bei einer Wallfahrtskirche mit angehängtem Wirt statt.
Gleichzeitig ist Hell ein super Musiker. Er hat sogar ein halbes Musikstudium absolviert und kann irgendwie davon leben, manchmal mehr schlecht als recht. Das geht nur, weil er bei einem halben Dutzend Bands spielt. Warum er uns Dilettanten von Onion Pie noch erträgt, ist mir sowieso ein Rätsel. Wahrscheinlich sind wir seine Familie. Dort, wo er sich daheim fühlt. Da nimmt man einfach mehr in Kauf.
Unser Proberaum liegt im Keller von Hells Wohnhaus. Schweigend trotten wir hinunter. Ich halte noch eine halbvolle Dose Bier in der Hand und habe den Fünfsaiter in der Tasche über meiner Schulter hängen, Hell schleppt zwei Gitarren mit und hat keinen Platz mehr für ein mobiles Bier.
Nicht dass unser Proberaum sehr charmant wäre, aber er ist trocken und Strom gibt’s auch, zudem fühlt sich niemand im Haus von unseren Probeexzessen gestört. Das ist sympathisch. Umso erstaunlicher ist es, dass sich heute ein paar Asseln in unser Reich verirrt haben. Ein Porcellio scaber liebt normalerweise feuchte Biotope. Vielleicht gefällt den verhuschten Minikrebsen auch nur unsere Musik so gut. Wir sagen einfach, wir spielen Independent Rock. Hört sich gut an. Und es passt alles rein – die Milliarde englischer Bands, die wieder bei den Beatles gelandet sind, und wir vier Unverwüstlichen haben da drin auch unseren Platz, obwohl wir irgendwo zwischen Guns N’ Roses, The Killers und Snow Patrol stehen. Ja, halt irgendwo dazwischen, sonst wären wir erfolgreich.
Erik, der Notarzt und gleichzeitig unser Drummer, ist schon im Proberaum. Er braucht nach seinem Job immer ein bisschen Zeit für sich und geht deshalb ohne Umwege in den Keller. Neben ihm liegen bereits zwei Blechleichen, in seinem Jargon »meine Psychologen« genannt. Ich hoffe inbrünstig, dass ich Erik als Arzt nie brauchen werde. Daheim hat er immer mindestens vierundzwanzig »Psychologen« vorrätig, damit er von seinem Job runterkommt. Er braucht seine Shrinks allerdings täglich, was allen zu denken gibt, nur ihm nicht.
»Du wehrst dich mit Händen und Füßen gegen das Erwachsenwerden, stimmt’s?«
Erik deutet mit dem Kopf auf mein AC/DC-T-Shirt.
»Wir spielen seit einer halben Ewigkeit zusammen, Alex, und ich habe dich ausnahmslos immer mit Leibchen gesehen, die du auf Konzerten gekauft hast. Warum bestellst du dir nicht eines mit dem Aufdruck ›Berufsjugendlicher‹? Dann könntest du sicher einen ganzen Kasten daheim einsparen.«
Erik grinst und prostet mir mit seinem Blech zu. Er redet nicht viel, aber wenn, lebt er meistens seinen Zynismus aus. Ich vermute, dass er nur neidisch ist. Er hat vier Kinder, ein Haus und einen Hund. Ja, und auch eine Frau, die in ihrer Mutterschaft aufgeht, was er gewissermaßen mit Nachtdiensten und Krankenschwestern ausgleicht. Statt diesem Stress mit seinem Geliebtenmanagement habe ich lieber meine Leibchen und eine fortpflanzungsbesessene Frau. Ich finde, die Leibchen machen mich frischer. Jutta ist vier Jahre jünger, ich kratze jetzt bald am Vierziger. Da muss man sich in Sachen Jugendlichkeit schon ein bisschen anstrengen.
Bis Norman, der Keyboarder, kommt, grooven wir uns mit einer Bluesrock-Nummer in D-Dur ein. Das geht schön im Kreis, und man kann so richtig reinsinken in die Bluesstruktur, so dass der Alltag ganz schnell abfällt.
In einigen wenigen klarsichtigen Momenten weiß ich, dass ich als Musiker ungefähr so viel wert bin wie Armin Assinger als Profi-Skifahrer. Das ändert nichts an meiner Begeisterung für die Musik. Die Zeit der drei Akkorde haben wir zwar schon längst hinter uns gelassen, aber in den Charts sind wir nie angekommen. Wir sind auf dem Weg, sagt Hell immer tröstend. Manche Wege sind eben elendslang. Offenbar beschreiten wir den Jakobsweg der Rockmusik.
Wenn ich darüber nachdenke, ist unser Bandname Onion Pie einzig aus Ressentiments heraus entstanden: Meine Mutter hasst Zwiebelkuchen, was mir den Namen sympathisch gemacht hat, und Hells Eltern wissen gar nicht, was Onion Pie bedeutet. Wenigstens findet Jutta den Namen originell.
Jutta
Hallo, meine Liebe, lass dich küssen.«
Die zierliche, in Lila gekleidete, alte Dame erhebt sich aus ihrem Lehnsessel und umarmt mich herzlich. Weniger liebevoll fällt die Begrüßung jener Frau aus, die neben Tante Anna auf der Chaiselongue sitzt.
»Na schau, die Jutta, so eine Überraschung. Ihr seid doch vor mehr als drei Wochen zum Liebesurlaub in der Therme gewesen. Dürfen wir gratulieren, oder ist es wieder nichts mit einem Enkerl?«
Meine Schwiegermutter tut sich immer etwas schwer, den richtigen Ton zu treffen. Würde man umgekehrt sie derart brüskieren, wäre sogleich Feuer unterm Dach. Auch wenn Alex und ich nicht verheiratet sind, sprechen wir immer von unseren »Schwiegermüttern«. Das ist einfacher in der Handhabe.
»Sieht ganz danach aus. Wird wohl doch ein schwarzes Enkerl aus Afrika werden«, gebe ich provokant zurück. Ich weiß, wie groß ihre Angst ist, unser Vorhaben könnte irgendwann Wirklichkeit werden.
»Also, ich glaube, Jutta und mein Alexander passen einfach nicht zusammen. Das kommt vor. Ich habe mal gelesen, dass es Paare gibt, die miteinander nicht fortpflanzungsfähig sind, mit anderen Partnern aber schon. Vielleicht denkt ihr mal darüber nach.«
Ariane Hohenberg, die eigentlich Marianne heißt, ist in ihrem Element. Die stattliche Mittsechzigerin in ihrem Chanel-Kostüm und den Dolce&Gabbana-Schuhen hätte natürlich gerne eine Schwiegertochter aus »gutem Hause« gehabt. Allein, dass meine Eltern Lehrer waren und ich mit Gucci und Co. so überhaupt nichts anfangen kann, ist für sie reinste Provokation. Mit Tante Anna, einer langjährigen Freundin der Familie Hohenberg, versteht sie sich dennoch überraschend gut. Auch wenn die beiden Damen unterschiedlicher nicht sein könnten. Ich schaue auch häufig bei Tante Anna vorbei und plaudere ein wenig mit ihr. Alex meint, ich leide unter dem »Helfersyndrom«. Ich sehe das anders. Anna Hammerschmied ist eine äußerst liebenswerte Frau, die viel zu erzählen hat. Vielleicht ersetzt sie auch in gewisser Weise die Großmutter, die ich nie hatte.
»Man muss sich nicht gleich trennen, wenn man ein Kind haben will. Schon mal was von Adoption oder In-vitro-Befruchtung gehört?«, sage ich. Auch wenn Letzteres für uns nicht in Frage kommt, kann man meine Schwiegermutter mit Fremdwörtern immer beeindrucken. Langsam komme ich sprachlich in Fahrt.
»Was ist das denn nun wieder? Heißt so die Agentur, die diese armen Negerbabys vermittelt?«
»Nein Ariane, bei in vitro muss dein Sohn Alexander in ein Röhrchen onanieren.«
Anna ist schlagfertig und vor allem gebildet, was man von meiner Schwiegermutter nicht behaupten kann. Letztere reagiert pikiert und gekünstelt, wie immer.
»Anna, ich habe gar nicht gewusst, dass du solche Wörter in deinem Sprachschatz hast. Wie auch immer, mein Alexander hat so etwas nicht nötig.«
Ich bemerke aus den Augenwinkeln, wie die alte Dame langsam die Geduld verliert. Aufgewachsen in einer großbürgerlichen Familie hat sie allerdings gelernt, sich zu beherrschen.
»Georg und ich hätten auch so gerne Kinder gehabt. Wir dachten aber, dass unser Leben mit den vielen Reisen nichts für Kinder ist, und haben daher keine bekommen. Als Georg so früh gestorben ist, habe ich das sehr bereut.«
Tante Annas Mann war Arzt und Wissenschaftler gewesen. Er musste beruflich viel Zeit im Ausland verbringen, und Anna war immer dabei.
»Sag, Jutta, hast du mir mein geliebtes Olivenöl mitgebracht?«, versucht sie das Gespräch in eine andere Richtung zu lenken.
»Klar, deswegen bin ich doch ohne Vorankündigung bei dir vorbeigekommen.«
Eigentlich ist »Tantchen«, wie Alex und ich die agile alte Dame oft nennen, trotz ihres Wohlstandes ziemlich genügsam. Nur bei der Wahl ihres Olivenöls zeigt Anna leicht überspannte Charakterzüge. Das Öl muss in der Olivensorte Koroneiki hergestellt werden. Die wiederum gibt’s ausschließlich auf der griechischen Halbinsel Mani. Nur dort wird dieses fruchtige Öl gepresst, das angeblich ein Aroma von Kräutern und Wildblüten hat. Ich habe keine Ahnung, ob das tatsächlich stimmt. Früher hat Tantchen jedes Jahr ein paar Wochen in Griechenland verbracht und ihr Lieblingsöl persönlich importiert. Jetzt macht das ein Großhändler, der seine Produkte im Internet anbietet. Zum Glück! Dadurch kann ich das aromatische Öl online bestellen und immer, wenn Tante Anna Nachschub braucht, bei ihr abliefern.
»Meine Liebe, kannst du das Öl bitte in die Küche stellen?«
Anna sieht mich bittend an.
Ich bin froh, endlich aufstehen zu können, und gehe durch den blauen Salon mit seinem originalen Jugendstilkachelofen, der ebenfalls in Blau gehalten ist, in Richtung Küche. Ähnlich wie ihr Kleidungsstil ist auch die Einrichtung Ton auf Ton abgestimmt. Wie immer stelle ich das Öl in den Schrank neben dem roten Einbaukühlschrank. Sogar das Geschirr, die Pfannen und das Besteck passen farblich zur Ausstattung. Moderne Elemente fehlen ebenso wenig wie Antiquitäten, die bereits über Generationen im Besitz der Familie Hammerschmied sind. Tantchen hätte Innenausstatterin werden sollen, so sehr versteht sie es, die verschiedensten Einrichtungsgegenstände miteinander zu kombinieren.
Während ich noch einen Blick in den herrlichen Garten der alten Villa werfe und wie immer fasziniert bin, dass es diese Ruhe in einer Großstadt wie Wien gibt, höre ich schon wieder meine Schwiegermutter.
»Juttilein, wo bleibst du denn? Ich habe Kuchen mitgebracht. Wenn du schwanger werden willst, musst du was essen.«
Ich verlange ja nicht, dass die Mutter meines Liebsten einen Wettbewerb im logischen Denken gewinnt, aber etwas mehr Realitätssinn könnte sie schon zeigen. Warum bitte muss man Kuchen essen, wenn man ein Baby bekommen will? Dann dieses dämliche »Juttilein«, was absolut verzichtbar ist. Ariane Hohenberg gibt sich zwar sehr weltgewandt, oft kann sie jedoch nur schwer verbergen, dass sie nicht in einem Wiener Nobelbezirk, sondern auf einem Bergbauernhof aufgewachsen ist. Das ist an sich keine Schande, nur Ariane Hohenberg, geborene Marianne Holzapfel, versucht ihre Herkunft penibel zu verheimlichen. Ihr Ziel war immer gewesen, reich zu heiraten, und das ist ihr auch gelungen.
Während ich so vor mich hin sinniere, esse ich doch noch ein paar Bissen Kuchen und frage mich, wie Tante Anna die wöchentlichen Besuche meiner Schwiegermutter ohne Anflug eines Magengeschwürs übersteht.
Mein Handy klingelt.
»Liebste, wo bist du? Ich muss dir was sagen. Du glaubst nicht, was passiert ist.«
Alex macht es spannend und will mir am Telefon nichts verraten.
»Richard und Ines …«
Alexander
… bekommen ein Kind.«
Ich warte gespannt auf Juttas Reaktion. Sie zuckt nur mit den Schultern.
»Weiß ich. Deine charmante Mutter hat es mir vor knapp einer Stunde als Draufgabe zum Abschied erzählt. Nicht ohne darauf hinzuweisen, wie gut die beiden – im Gegensatz zu uns – doch zusammenpassen.«
Jutta lässt sich auf die rote Ledercouch fallen und nestelt etwas hilflos am Verschluss ihrer Schuhe. Ihr enges knalloranges Minikleid beißt sich etwas mit dem Sofa. Sie schaut darin trotzdem umwerfend sexy aus. Würde unser Gespräch nicht gerade eine sensible Richtung einschlagen, wüsste ich ein besseres Projekt für uns zwei.
»Okay, ich dachte, ich sag dir was Neues.« Natürlich bin ich ein wenig enttäuscht über Juttas gleichgültige Reaktion.
»Ausgerechnet diese beiden Schnösel.« Jutta ist noch immer mit ihren Schuhen beschäftigt.
»Die wollten doch nie ein Kind.«
»Was willst du denn von Ärzten erwarten, Jutta? Ich kenne keinen einzigen, der jemals etwas von Empfängnisverhütung gehört hätte. Ohne Ärzte und Zuwanderer gäbe es in unserem Land sowieso keine Kinder mehr.«
Ich kann Juttas hilfloses Herumhantieren an ihren Schuhen nicht mehr mit ansehen und knie mich vor sie hin, um ihr beim Ausziehen zu helfen. Blöderweise hat sie die wirklich interessanten Kleidungsstücke noch an. Während ich an den Schuhen nestle, erkläre ich ihr natürlich, dass meine demütige Haltung eine einmalige Ausnahme ist.
Jutta scheint ohnehin nichts davon zu bemerken und redet wie in Trance weiter.
»Ines, diese schleimige Hautärztin mit ihrem chemisch abgehobelten Gesicht. Ausgerechnet Ines, diese unterernährte Unfrau. Bevor das Baby drei Monate alt ist, hat es sicher schon die erste Fruchtsäurebehandlung hinter sich.«
Ich nicke nur. Besser jetzt nicht unterbrechen. Mein Kopf brummt noch ein bisschen von der gestrigen Bandprobe. Die Verstärkeranlage ist nicht daran schuld.
Als ich sie endlich von ihren Schuhen befreit habe, lege ich meine Hand auf Juttas Knie und setze mich neben sie. Mein Verhältnis zu meinem Cousin ist auch etwas angeknackst.
»Richard ist mir schon immer als Vorbild präsentiert worden: ›Schau mal, dein Cousin Richard golft jetzt! Hör nur, wie gut Richard Klavier spielt! Schau, wie weit dein Cousin Richard schon mit dem Studium ist! Hast du gehört, Alexander, wie viel Richard als Zahnarzt verdient?‹ Und so weiter. Glaubst du, das hat ihn sympathisch gemacht?«
Jutta schüttelt den Kopf. Ich bin mir nicht sicher, ob sie mich gehört hat.
»Angeblich waren sie sehr unglücklich, als sie erfahren haben, dass sie schwanger sind.« Meine braunhaarige Hübsche sieht mich eindringlich an.
»Kannst du dir das vorstellen? So ein undankbares Gesindel.«
»Warum bekommen sie das Kind dann trotzdem?«
»Weil sie so konservativ sind. Du kennst sie doch, Alex.«
Ja, leider. Ich kenne sie. Vor allem Richard, diesen Gel-Affen, der mit seinen niedergeglätteten Haaren durch die Welt stolziert wie ein metrosexueller Leguan. Richard, die Heimsuchung meiner Kindheit und meiner Jugend. Und jetzt kommt er schon wieder zu mir zurück wie ein wild gewordener Bumerang. Ich habe ihn in den letzten Jahren immer nur einmal jährlich gesehen, auf Familienfesten bei Tante Anna.
Ich hatte eigentlich gar keine andere Wahl gehabt, als Rockmusiker zu werden. Das mit dem Klavierlernen war erledigt gewesen, als Mutter mir das Talent des kleinen Richard vorgehalten hat, obwohl mich Klavier durchaus sehr interessiert hätte. Dass er ein Jahr später den Musikunterricht schon wieder geschmissen hat, davon hat sie mir nichts erzählt. So wie sie mir nie erzählte, dass er die sechste Klasse wiederholen musste, obwohl er doch der gescheite, fleißige, talentierte Richard war.
»Warum nickst du vor dich hin?«
Jutta sieht mich zweifelnd an.
»Ich bin gerade in einem schwarzen Loch versunken. Ein schwarzes Loch namens Richard.«
»Holst du uns Wein, Alex? Ich glaube, ich muss diese Nachricht irgendwie hinunterspülen.«
Jutta schaut mir nicht in die Augen, als wir ein wenig später auf der Couch anstoßen.
»Weißt du, Alex, ich habe mir gerade gedacht, dass ein Leben ohne Kinder auch seine Vorteile hat. Viele Vorteile.«
Mit einer großen Geste verdeutlicht sie die Größe der Wohnung und zeigt schließlich auf die fünf Leinwände, die ich mit Fotos seltener Käfer, wie dem Dynastes hercules, dem Herkuleskäfer, bedrucken habe lassen. Das Krabbelensemble reicht von der Decke bis fast auf den Boden.
»So ein kleiner Racker würde die Leinwände sicher abmontieren, sobald er durch die Wohnung wackeln kann.«
»Bestimmt. Diese Gremlinge sind die reinsten Zerstörer, Jutta.«
Sie schlägt mich auf den Oberschenkel.
»Sag so etwas nicht. So schlimm ist es auch wieder nicht.«
Jutta nimmt einen kräftigen Schluck und hält mir das leere Glas hin.
»Wann ist es eigentlich so weit bei den beiden? Deine Mutter hat es mir zwar gesagt, aber offenbar ist mein Gedächtnis momentan nicht das beste. Bei Schwangeren soll das übrigens auch so sein. Die können sich nichts merken. Es wäre also eine gute Gelegenheit, Ines zu beleidigen. Sie wird es in neun Monaten nicht mehr wissen.«
»Aber Richard wird sich daran erinnern können.«
»Sind Männer nicht co-schwanger, Alex?«
»Keine Ahnung. Schließlich habe ich keine Erfahrung mit Schwangerschaften.«
Jutta trinkt wieder und sucht ein weiteres Argument gegen Kinder. Ich folge ihrem Blick. Er bleibt beim CD-Regal hängen. Der spitze Finger meiner Liebsten deutet ins Herz meiner nicht gerade bescheidenen Musiksammlung.
»Mit einem Kind müsstest du adieu sagen zu deiner krankhaften Ordnung in deinem Musikfriedhof.«
»Musikarchiv, bittschön. So viel Zeit muss sein.«
»Musikfriedhof, geordnet wie deine Käfer in den Glaskästen. Nur die Katalogisierung in einem blechernen Schubladencontainer fehlt. Sonst hat alles seinen Platz und seine Systematik. Ein Baby würde sofort Chaos hineinbringen in diese pathologische Aufreihung.«
Sie nickt ihren Worten nach.
»Gar nicht zu reden von der Plattensammlung. Und wahrscheinlich würde so ein Minimensch dem Plattenspieler sofort den Arm ausreißen oder die Nadel schlucken. Nicht auszudenken. Wie gut, dass wir kein Kind haben.«
Jutta stürzt das nächste Glas hinunter, als wäre sie auf der Flucht.
»So ein Zwerg würde uns wohl auch den Rudolf Hausner zerstören.« Sie deutet auf die Lithographie des magischen Realisten, den uns meine Mutter vor drei Jahren zu Weihnachten geschenkt hat – eine seiner vielen Adam-Darstellungen in Grün.
»Tatsächlich, der hängt viel zu tief. Allerdings nur, wenn der Kleine den Tisch hinschiebt und auch noch einen Sessel draufstellt.«
Keine Reaktion. Jutta starrt den Adam an, als wartete sie auf eine Bewegung des Kopfes mit dem Turban. Ich lege meinen Arm fest um sie. Plötzlich beginnt sie zu weinen, ansatzlos. Sie heult los und gibt von Anfang an mindestens hundert Prozent. Jutta plärrt so heftig, dass ich unter der Gewalt der Tränen nicht weiß, ob ihr nicht auch der Wein durch die Augen wieder herausschießt. Davon hat sie in den letzten fünfzehn Minuten nicht zu wenig getrunken.
»Ich hätte es so gerne, dass ein Kind diesen hässlichen grünen Schädel zerstört«, schluchzt sie. Sie braucht fast eine halbe Minute, um den Satz zu vollenden. »Wie ich diesen Adam mit seiner fliegenden Untertasse am Kopf hasse.«
Wir stehen jetzt zeitlich bei Minute eins nach Beginn ihrer künstlerischen Kommentare, die nur stockend, zerdehnt und in mehreren Anläufen aus ihrem Mund kommen.
»Und deine CD-Sammlung darf das Zwergerl auch zerstören, wie es will. Wenn es nur endlich daherkommt.«
Da bin ich jetzt nicht Juttas Meinung. Ich verzichte aber auf Widerstand. Erneut verschlucken heftige Erschütterungen den Beginn eines neuen Satzes.
Eins dreißig, führe ich in meinem Kopf Statistik. Zählen ist ein gutes Mittel gegen Hilflosigkeit. Ich berechne voraus, dass der nächste Satz frühestens bei Minute zwei fertig sein wird. Wenn er kurz ist. Jutta hat mit ihrem Schluchzen wertvolle Zeit verloren.
Juttas Fuß wischt über das Fischgrätenmuster des Holzbodens.
»Und den wunderbaren Boden zerkratzen darf das Baby auch, wenn es mag. Das ist mir alles wurscht.«
Ihr Brustkorb hebt und senkt sich wie unter einem Anfall. Ich kann Jutta neben mir kaum geradehalten.
Als sie kurz Luft holt, drücke ich ihr das Glas in die Hand und führe es gleich zum Mund. Aber so viel Flüssigkeit kann ich kaum in sie hineinschütten, wie im nächsten Moment durch die Augen wieder herauskommt. Jutta ist in ihrem Schmerz nicht zu bremsen. Und ja, es wäre mir wurscht, wenn unser Kind den Hausner zerstört. Bloß die CD-Sammlung und die Platten muss es in Ruhe lassen. Da verstehe ich keinen Spaß. Jeder Angriff auf diese Heiligtümer weckt den Rasputin in mir. Das ist meine Spielecke. Das Kind soll in seiner bleiben, sprich in jenem Raum, den wir gerade als Büro-Rumpelkammer nutzen und eigentlich nicht brauchen.