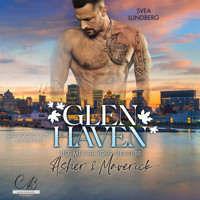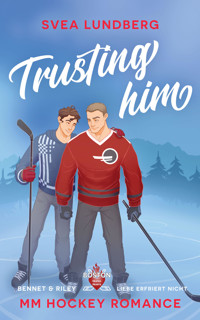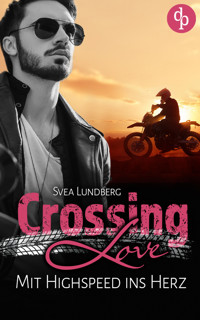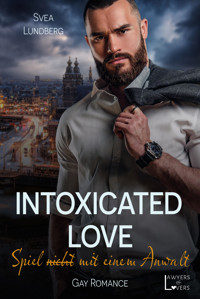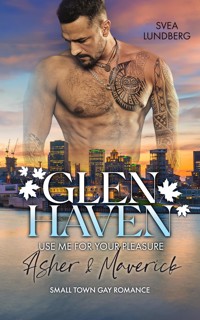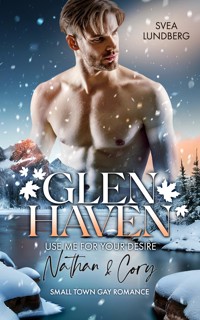Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dead soft verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nachdem der kalte Entzug an Jeriks Seite in einer Katastrophe endete, findet sich Alexej im Krankenhaus wieder. Die Ärzte raten ihm dringend zu einer professionellen Entzugsklinik, aber benommen von Beruhigungsmitteln und mit einer Infusion im Arm, bricht er die Behandlung lieber heute als morgen ab. Denn er ist sich sicher: Er hat die Beziehung zu Jerik endgültig zerstört und ohne ihn wird er den Entzug niemals schaffen. Statt in eine Klinik begibt sich Alexej zurück auf die Straße und hinein in die bittersüße Umarmung von Heroin und fremden Freiern. Sein Leben wird zum Schwebezustand zwischen Fallen und Fliegen. So lange, bis ihm eine unerwartete Begegnung die Augen öffnet. Wird er den Aufprall überstehen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 270
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inbetween–
Zwischen Fallen und Fliegen
Impressum
© dead soft verlag, Mettingen 2018
http://www.deadsoft.de
© the author
Cover: Irene Repp
http://www.daylinart.webnode.com
Bildrechte:
© Malush – fotolia.de
© Julenochek – shutterstock.com
1. Auflage
ISBN 978-3-96089-193-2
ISBN 978-3-96089-194-9 (epub)
Inhalt:
Nachdem der kalte Entzug an Jeriks Seite in einer Katastrophe endete, findet sich Alexej im Krankenhaus wieder. Die Ärzte raten ihm dringend zu einer professionellen Entzugsklinik, aber benommen von Beruhigungsmitteln und mit einer Infusion im Arm, bricht er die Behandlung lieber heute als morgen ab. Denn er ist sich sicher: Er hat die Beziehung zu Jerik endgültig zerstört und ohne ihn wird er den Entzug niemals schaffen.
Der Vorhang öffnet sich
Hamburg, Deutschland, September 2012
Ich schlug die Augen auf und starrte in gleißendes Weiß.
Schmerz bahnte sich stechend den Weg durch meine Stirn, bis tief in meinen Kopf hinein. Stöhnend kniff ich die Lider zusammen, blinzelte mehrmals. Brauchte Sekunden, um zu begreifen, dass ich direkt in das grelle Licht einer Neonröhre starrte. Fuck, wo war ich gelandet, dass derart altmodische Lampen an der Decke hingen?
Mein Blick hastete durch den Raum. Fand steriles Weiß und ekliges Grün. Mein Atem begann zu rasen. Ein durchdringendes Piepsen hallte in meinen Ohren.
Krankenhaus!
Eine plötzliche Enge im Brustkorb schnürte mir die Luft ab, als zöge jemand einen Stahlgürtel um meinen Oberkörper zusammen. Reflexartig wollte ich mir an die Brust greifen, den störenden Druck von mir reißen, aber ein Stechen im rechten Handgelenk stoppte die Bewegung.
Wie hypnotisiert starrte ich auf meinen Arm, auf die Infusionsnadel, die darin steckte, auf die Kanüle und den dünnen Schlauch, durch den irgendeine Flüssigkeit in meine Adern gepumpt wurde. Kurz flackerte der Gedanke in mir auf, wie absurd es war, dass ich mir Heroin, Koks und andere Highs in die Blutbahn jagte, im Krankenhaus aber fürchtete, etwas zugeführt zu bekommen, das mir schaden könnte. Doch ehe ich ernsthaft darüber nachdenken konnte, riss ich bereits an der Kanüle.
Mit einem Ruck löste sich der dünne Schlauch aus dem Röhrchen, ein Stechen und das widerliche Gefühl, wie sich eine Nadel in meine Adern wühlte, schossen durch mein Handgelenk und den Arm nach oben. Ich biss mir auf die Unterlippe, unterdrückte das halb dem Schmerz und halb dem Ekel geschuldete Wimmern. Für einen Moment kniff ich die Augen zusammen, spürte meinen rasenden Herzschlag. Mit der linken Hand, in der keine Nadel steckte, tastete ich nach dem Bettrand und stemmte mich hoch, stand eine Sekunde später auf meinen Füßen, nur um augenblicklich zu spüren, wie meine Knie weich wurden und meine Beine regelrecht einknickten.
»Fuck«, presste ich zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor. Schwer atmend hockte ich auf dem Rand des Bettes und blinzelte gegen die plötzliche Schwärze vor meinen Augen und die aufsteigende Übelkeit in meinem Magen an. Verdammt, was hatten diese verfluchten Ärzte mir eingeflößt, dass ich mich dermaßen beschissen fühlte?
»Herr Fillipow?«
Mein Kopf ruckte nach oben. Verschwommen nahm ich eine junge Frau in weißem Kittel wahr, die auf mich zustürzte.
»Herr Fillipow«, wiederholte sie meinen Namen, streckte ihre Hände nach mir aus. Reflexartig wich ich zurück, entging jedoch nicht ihrer Berührung an meinen Schultern.
»Sie dürfen doch nicht aufstehen, Sie müssen … Himmel! Haben Sie sich etwa die Infusion herausgerissen?«
Noch ehe ich reagieren konnte, packte sie mein Handgelenk und hielt es prüfend in die Höhe. Mit der anderen Hand tastete sie nach dem Notrufknopf am Kopfende des Bettes.
»Schon gut«, fauchte ich sie an und riss mein Handgelenk los.
»Nichts ist gut. Sie dürfen keinesfalls aufstehen, Sie …«
»Ich entscheide immer noch selbst, wann ich aufstehe und wann nicht«, fuhr ich die Schwester an und wollte mich erneut hochstemmen, versagte aber kläglich, was dem puckernden Druck in meinem Handgelenk ebenso geschuldet war wie dem Umstand, dass sich meine Beine wie Wackelpudding anfühlten. Eine neue Welle der Übelkeit tobte durch meinen Magen und brachte mich dazu, schwer atmend in die Kissen zurückzusinken.
Aus dem Augenwinkel begegnete ich dem vielsagenden Blick der Krankenschwester. Gleich darauf schob sich ein weiteres Gesicht in mein Blickfeld.
»Herr Fillipow, Sie sind also wach …«
Ich blinzelte, versuchte den Mann zu fixieren, zu dem die sonore Stimme gehörte.
»Er hat sich die …«
»Ich sehe schon.« Der Arzt neigte sich noch weiter über mich. »Wie fühlen Sie sich, Herr …«
»Bestens«, raunzte ich ihm entgegen, obwohl ich von bestens oder auch nur gut Lichtjahre entfernt war. Was ich ganz dringend brauchte, war …
»Verzeihen Sie mir, wenn ich Ihnen das nicht abnehme. Sie sehen nicht gerade wie das blühende Leben aus und sollten …«
»Ich muss gehen.«
Meine Aussage klang entschlossener, als ich es selbst für möglich gehalten hatte, und sie sorgte für eine kurze, drückende Stille im Raum. Doch gleich darauf entschied der Arzt mit fester und deutlich kühlerer Stimme als zuvor: »Sicher nicht. Herr Fillipow, Sie haben einen kalten Entzug hinter sich. Sie sind – gelinde gesagt – bis obenhin vollgepumpt mit Schmerz- und Beruhigungsmitteln. Ich werde Sie so auf gar keinen Fall gehen lassen. Sie haben …«
Was ich noch alles hatte, bekam ich nicht mehr mit. In meinem Kopf hämmerten zwei einzelne Worte: kalter Entzug… kalter Entzug … kalter Entzug …
Mein Atem stockte für einen Moment, ohne dass ich mich dazu hätte zwingen können, weiterzuatmen.
Kalter Entzug … Entzug … Entzug …
»Herr Fillipow?«
In meiner Kehle nahm ich den sauren Geschmack von Erbrochenem wahr. Hastige Atemzüge sorgten dafür, dass er sich in meinem gesamten Rachenraum festsetzte, während sich meine Kehle zuzuziehen schien. Immer weiter. Immer enger. Bis …
»Herr Fillipow, atmen Sie! Ganz ruhig.«
Panisch schnappte ich nach Luft, doch statt derer rann lediglich Erbrochenes, vermischt mit Blut, meine Kehle hinab. Etwas Heißes glitt über meine Wangen. Über mir das gleißend helle Licht.
Entzug … Erbrechen … Schmerz … Stundenlang!
Je schneller ich atmete, je verzweifelter ich die Luft in meine Lunge zu saugen versuchte, desto weniger davon schien anzukommen. Saurer Geschmack mischte sich mit Salzigem. Die Flüssigkeit brannte heiß auf meinen Wangen und Lippen. Ziehender Schmerz riss an meinen Gliedern. Oder war es nur die Erinnerung daran?
Die Panik schnürte mir weiterhin die Luft ab, ließ mich im selben Moment noch rascher und gehetzter atmen.
Gleißendes Weiß. Schatten im rechten Augenwinkel.
Und dann: Jerik … Jerik … Entzug mit Jerik … Gott, Baby… Jerik, nein …
Eine Maske wurde über mein Gesicht gestülpt. Ich versuchte sie wegzuschlagen, fand etwas, das ein Arm hätte sein können, und krallte die Finger hinein. Kämpfte und atmete. Und verlor.
Entfernt registrierte ich noch ein Stechen in meiner Armbeuge. Dann verflüchtigte sich das gleißende Weiß zu sanftem Grau.
Jerik …
Und wurde schwarz.
I. Akt
Hamburg, Deutschland, September 2012
»Ich kann Ihnen nur abermals ans Herz legen, sich in eine professionelle Klinik zu begeben. Sie …«
Ich unterbrach den Arzt mit einem verächtlichen Schnauben.
»So professionell wie Ihre, meinen Sie? Eine Klinik, in denen man Patienten ohne ihr Einverständnis Beruhigungsmittel in die Adern pumpt?«
Die Brauen des Arztes wanderten so weit nach oben, dass sie unter dem Ansatz des ergrauenden Haares verschwanden.
»Herr Fillipow«, über seinen Schreibtisch hinweg lehnte er sich mir entgegen, »Sie haben hyperventiliert und hatten eine waschechte Panikattacke. Als Sie eingeliefert wurden, hatten Sie …«
»Mir geht es bestens«, wehrte ich seine Erklärungen ungeduldig ab. »Wo muss ich unterschreiben?«
Lange Sekunden starrten wir uns in die Augen, ein stummes Duell der Blicke, doch schließlich schob mir der Arzt den Entlassungsbrief entgegen.
»Unten rechts. Das Datum ist bereits eingetragen.«
»Zu freundlich.«
Meine Hand zitterte nur ein kleines bisschen, als ich meine Unterschrift unter die des Arztes setzte.
»Sie sollten wirklich in Erwägung ziehen …«
»Was?«, fuhr ich ihn an, sprang von dem Stuhl auf und kam auf wackligen Beinen zum Stehen. »Ich brauche keine professionelle Hilfe.« Die letzten beiden Worte spie ich regelrecht aus. »Ich brauche keinen weiteren Entzug. Ich bin clean.«
»Herr Fillipow, bitte, seien Sie vernünftig, Sie …«
»Gottverdammt, nein!« Schwer atmend stützte ich mich auf der Stuhllehne ab, fixierte den verfluchten Weißkittel über seinen Schreibtisch hinweg. »Wie lange war ich hier? Vier Tage? Fünf? Habe ich in dieser Zeit etwa irgendwelche Drogen angerührt, abgesehen von Ihren Psychopharmaka?«
»Es waren keine Psychopharmaka, es …«
»Wie auch immer«, blaffte ich und stieß mich abrupt vom Stuhl ab, marschierte auf verblüffend sicheren Beinen zur Tür. »Besten Dank für Ihre Mühe, Herr Doktor, aber mir geht es blendend. Auf Wiedersehen.«
Ich riss die Tür auf und rannte regelrecht auf den Flur hinaus und den sterilen Krankenhausgang entlang. Meine eigenen Schritte hallten in meinen Ohren. Ebenso wie die Worte des Arztes. Aber zur Hölle, ich brauchte keinen Entzug. Ich brauchte keine Drogen. Kein Koks und kein Heroin. Alles, was ich brauchte, waren frische Luft und Jerik.
Jerik!
Der Gedanke an ihn versetzte mir einen feinen Stich. Weshalb hatte er mich all die Tage nicht besucht? Weshalb war er nicht mit mir ins Krankenhaus gefahren? Weshalb …?
Ich stolperte hinaus in die klare Herbstluft, saugte sie gierig in meine Lungen. Der raue Wind kühlte die Tränen auf meinen Wangen.
Weshalb war er nicht da?
Bebend sog ich den Atem ein, straffte die Schultern.
Tief in mir presste sich eine bösartige Stimme an die Oberfläche, die mir zuflüsterte, dass er …
Mit aller Gewalt drängte ich den Gedanken zurück.
Er würde da sein. Er würde zuhause sein und auf mich warten.
Er würde.
Er musste einfach.
Weil ich ihn brauchte und er es wusste.
Immer schon gewusst hatte.
Gott, Baby, flehte ich in Gedanken, während ich zittrig einen Fuß vor den anderen setzte, bitte, sei da. Bitte, bitte … bitte!
~~~
Er war nicht da. Oder er wollte schlichtweg nicht mit mir sprechen. Die Erkenntnis sickerte langsam – sehr langsam – in mein Bewusstsein durch, während ich auf das kahle Holz der Wohnungstür starrte. In meiner Hand puckerte ein feiner Schmerz, geschuldet den verzweifelten Versuchen, mit der Faust die verdammte Tür einzuschlagen.
Langsam trat in von der Tür zurück. Erst einen Schritt, dann zwei. Drei. Die Maserung des Holzes verschwamm vor meinen Augen.
Dumpfe Schritte hinter mir drangen watteweich durch den Dunst, der mich zu umgeben schien und sämtliche Reaktionen verlangsamte. Wie in Zeitlupe drehte ich mich um und sah eine Frau die Stufen in den dritten Stock hinaufsteigen. Ihr Blick wirkte zunächst irritiert, als sie mich sah, dann lichtete sich ihre Miene.
»Ach, Sie sind es«, sagte sie mehr zu sich selbst als zu mir, erinnerte mich mit ihren Worten jedoch daran, dass sie wohl Jeriks Nachbarin sein musste.
»Ich habe Sie ja eine Weile nicht mehr gesehen, Herr Fillipow. Ich nahm an, Sie und Jerik … Entschuldigen Sie, das geht mich nichts an.« Sie wandte sich ihrer Wohnungstür zu, schloss auf, drehte sich dann aber doch noch einmal zu mir um.
»Wenn Sie Jerik suchen … Er ist verreist, seit Anfang der Woche.«
»Verreist?«, brachte ich krächzend hervor. »Wohin?«
»Oh, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, er wollte zu seinen Eltern und dann nach Schweden.«
Ihre letzten Worte ließen das drückende Gefühl unbestimmter Panik in meiner Brust aufsteigen.
»Schweden?«, wiederholte ich mit zittriger Stimme. »Für … wie lange?«
»Das weiß ich leider nicht. Aber er sagte mir, ich solle mich nicht wundern, wenn in den nächsten Wochen eine Freundin vorbeikäme, um nach dem Rechten zu schauen. Er scheint also für längere Zeit fort zu sein. Ich glaube, er wollte …«
Ihre Stimme verhallte im Nebel. Ihre Silhouette verschwamm vor meinen Augen, ebenso wie die Treppenstufen, die ich hinunterhastete.
»Tut mir leid, Herr Fillipow, ich …«
Ja, wollte ich schreien, ja, verdammt, mir tut’s auch leid! Gott, Jerik … du … du …
»Arschloch«, presste ich zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor. Tief in meiner Brust wütete der Schmerz über die Erkenntnis, dass ich alleine es war, der Jerik fortgestoßen hatte. Wurde jedoch überlagert von der plötzlichen Wut darüber, alleine gelassen worden zu sein. Ich hatte ihn gebraucht. Hatte seine Nähe so verdammt dringend gebraucht. Brauchte sie immer noch. Und er spielte Feigling, verschwand aus Hamburg und ließ mich mit meinem Trümmerhaufen zurück, der sich Leben schimpfte.
Ich stürmte aus dem Haus, die Treppen hinunter und auf die Straße. Schnappte einmal tief nach Atem und lief los. Tränen brannten in meinen Augen, Zorn in meinem Bauch und Schmerz in meinen Gliedern. Trotzdem lief ich, im selben Takt, in dem eine sengende Stimme in meinem Kopf hämmerte.
Arschloch! Gottverdammtes Arschloch, warum hast du mich alleine gelassen? Warum, wenn ich dich so sehr brauche!
~~~
Das Loft sah noch genauso aus, wie ich es vor rund einer oder zwei Wochen verlassen hatte. Es war kalt. Steril. Und der Schauplatz einer verfluchten Heroin-Party.
Langsam trat ich näher an die Sofalandschaft heran. Betrachtete die benutzten Spritzen, das Feuerzeug und den Löffel, das kleine Fläschchen, in dem sich noch ein Rest Ascorbinsäure befand, weil wir es bevorzugt hatten, möglichst viel Heroin mit möglichst wenig Ascorbin aufzukochen. Ich konnte mich nicht genau daran erinnern, wer wir gewesen war. Beim Heroinkonsum ging es schließlich nicht um nette Gesellschaft, sondern um das gigantische Gefühl, wenn die Droge das Bewusstsein zum Schweben brachte. Zum Fliegen.
Leider war der Aufprall auf dem Boden jedes Mal schmerzhaft und ekelerregend gleichermaßen.
Zögerlich ging ich neben dem Fixerbesteck in die Knie. Ergriff mit spitzen Fingern den Löffel. Minutenlang betrachtete ich die eingebrannten Reste, die an den Rändern klebten. Mit dem Daumen fuhr ich darüber. Eine flaue Übelkeit kroch durch meinen Magen.
Ruckartig stand ich auf, sammelte hastig die Spritzen, das Feuerzeug und das Fläschchen auf und beförderte alles in den Mülleimer unter der Küchenzeile. Dann schaute ich mich im Wohnraum des Lofts um. Suchte mit Blicken fahrig nach … irgendetwas. Nach einer Beschäftigung, die mich von der Wut und den tief in mir nagenden Schuldgefühlen ablenken würde.
Mit großen Schritten durchmaß ich den Raum, rannte beinahe zu der Musikanlage. Ungeachtet dessen, welche CD sich im Laufwerk befand, drückte ich auf Play. Mit großer Wahrscheinlichkeit würde eine von mir selbst zusammengestellte Playlist ertönen. Tracks, die ich mir aus dem Netz gezogen hatte und die ich in aller Regel für mein tägliches Workout nutzte.
Die ersten Takte von Imagine Dragons ›Radioactive‹ erklangen und ich drehte sofort den Lautstärkeregler nach oben. Mit den ersten Klängen übernahm mein Körper die Kontrolle über mein Handeln. Ich ließ mich leiten. Treiben. Gab die Führung auf.
Ich registrierte noch, wie ich mir Pullover und T-Shirt über den Kopf zog und die Kleidungsstücke in eine Ecke des Raumes pfefferte. Dann stand ich inmitten des Lofts, atmete tief durch. Meine Glieder streckten sich. Fühlten den Beat. Und ich begann zu tanzen.
›Radioactive‹ war wie gemacht, um die Kontrolle abzugeben. Wie gemacht, um Wut und Schmerz und Schuld aus dem eigenen Körper herauszutanzen. Kraftvolle Stimmen, ein rauer Beat – Ekstase in der Bewegung.
Das Loft um mich herum verblasste. Was blieb, waren mein Körper und die Musik und … Furcht. Ein nagendes Gefühl von Angst, welches ich nicht einordnen konnte. Dem ich keinen Ursprung und kein Ziel geben konnte. Das nicht da sein sollte. Weil es irrational war und weil es in meinem Tanz niemals einen Platz dafür geben sollte.
Aber das Gefühl … die Furcht … war da und ließ sich nicht durch fließende Bewegungen und Einssein mit der Musik abschütteln. Warum nicht?
Abrupt hielt ich inne. Meine Blicke huschten fahrig durch den Raum. Mein Atem kam stockend. Hastig. Unkontrolliert. Das Lied verklang. Die nagende Unruhe blieb. Die Playlist sprang zum nächsten Track.
Robin Thick. ›Compass or map‹.
Zitternd schloss ich die Augen.
Jerik … unser Tag am See … mein erster Tanz für ihn … seine Lippen unter meinen … das erste Mal … so viele Male danach … Jerik … Jerik … Gott, Baby …
Ohne die Stereoanlage auszuschalten, floh ich aus dem Raum. Aus dem Loft. Griff im Flur nach einer Jacke. Schaffte es wenigstens noch, den Schlüssel abzuziehen und mit bebenden Fingern in meine Hosentasche zu stopfen. Dann war ich draußen und auf der Straße. Ein Auto fuhr hupend einen Haken. Ich stolperte rückwärts auf den Gehweg, sah mich gehetzt um. Wohin? Wohin denn nur, ohne ihn? Wohin, wenn mir nichts mehr blieb, als ein Trümmerhaufen Leben und …?
~~~
Ich hatte in jungen Jahren nicht lange gebraucht, um herauszufinden, dass es genau zwei Dinge gab, die mich dazu bringen konnten, alles um mich herum – jeden noch so dunklen Schatten des Hier und Jetzt – zu vergessen: Sex und Drogen.
Wenigstens mit Jerik war es irgendwann so gewesen, dass ich mich voll und ganz hatte fallen lassen können. Den Kopf hatte ausschalten und einfach nur fühlen können.
Drogen hatten gegenüber Sex jedoch zwei entscheidende Vorteile: Erstens wirkten sie länger als jeder Orgasmus und zweitens brauchte man keinen anderen Menschen dazu.
Ich musste mir nichts vormachen: Jerik war fort. Alles, was mir blieb, um die nagende Furcht und den Schmerz und die Wut in meinem Inneren zu betäuben, war das Kokain. Und wie ein wirklich guter Freund war Koks stets da, wenn ich es brauchte und es wirkte zuverlässig.
Binnen weniger Sekunden brachte es meine Nervenbahnen zum Klingen. Vertrieb Angst und Sorgen aus meinem Kopf. Prickelte verheißungsvoll auf meiner Haut. Ließ die Lichter des Clubs und die Menschen auf der Tanzfläche schillern. Und endlich – endlich! – konnte ich mich mit allem, was ich hatte, in den Rhythmus und die Beats fallen lassen. Konnte tanzen.
Tanzen und leben.
Und fliegen.
Im Grunde gab es nur eine einzige Sache, die besser war als Sex und noch viel besser als jede Droge: Vögeln auf Koks.
Jede noch so flüchtige Berührung des Typen hinter mir schickte elektrische Wellen durch meinen Körper. Ließ mich erregt und atemlos nach Luft schnappen.
»Komm«, raunte er mir ins Ohr, seine Hände strichen bereits auf ruheloser Wanderschaft über meine Haut. Meine Jacke hatte ich am Eingang des Clubs abgegeben – vermutete ich zumindest –, sodass ich mich oben ohne auf der Tanzfläche bewegte. Seine nackte Brust rieb über meinen Rücken. Mir brach der Schweiß aus.
»Lass uns in eine Kabine gehen.«
Sein harter Schwanz drückte an meinen Hintern, ich wand mich verlangend in seinen Armen. Keuchte. Aber konnte nicht.
»Nein«, hörte ich mich selbst über das Dröhnen der Bässe hinweg sagen, »geht nicht. Hab nen Freund.«
Sein raues Lachen flutete heiß über meinen Nacken, erzwang ein erregtes Stöhnen aus meiner Kehle. Fuck – und ich war so verdammt hart.
»Blödsinn«, knurrte er mir ins Ohr, grub die Zähne in meinen Hals. »Bist ne kleine Diva, hmm? Willst erobert werden?«
Ich schüttelte schwach den Kopf, umklammerte sein Handgelenk.
»Nein … wirklich, ich … er heißt …« Doch ich brachte seinen Namen nicht über die Lippen. Vielleicht, weil ich tief im Inneren wusste, dass er nicht mehr mein Freund war, dass ich ihn verraten hatte. So oft. Oder vielleicht auch, weil es eine Schande wäre, seinen Namen zu benutzen, um aufzuhalten, was ich im Begriff war zu tun. Wieder zu tun. Immer und immer wieder.
Statt die Hand des Fremden wegzuschieben, presste ich sie fester auf meinen Schritt. Keuchte und wimmerte leise, als er zudrückte und meinen Schwanz durch den Jeansstoff hindurch massierte.
»Nicht …« Meine Worte – nur ein hilfloses Flüstern. Der Kerl hinter mir hörte sie nicht oder reagierte einfach nicht darauf. Stattdessen packte er mich am Arm – grob möglicherweise, doch das Koks ließ jede Berührung geil erscheinen – und zerrte mich mit sich in Richtung der Toiletten.
Ich hörte zwar das knirschende Geräusch, als er den Riegel vorschob, und mir dämmerte es am Rande meines kokainbenebelten Bewusstseins, dass er hier drin mit mir anstellen konnte, was immer er wollte, aber der Gedanke ängstigte mich nicht im Geringsten. Stattdessen wandte ich mich zu ihm um, sah ihm zum ersten Mal seit unserer Begegnung auf der Tanzfläche ins Gesicht.
Rohe Erleichterung durchflutete mich, weil er groß und breit und bärtig war. Überhaupt nicht mein Typ und so anders als Jerik. Aber genau der Kerl von Mann, den ich jetzt brauchte. So dringend brauchte und wollte, um mir den allerletzten Rest schlechten Gewissens und Scham aus dem Hirn vögeln zu lassen.
Ich streckte eine Hand nach ihm aus, hielt jedoch mitten in der Bewegung inne und starrte wie hypnotisiert auf die Tütchen, die er aus der Hosentasche zauberte. Er langte an mir vorbei und klappte den Toilettendeckel herunter, legte den Stoff darauf ab. Paralysiert folgte ich jeder seiner Bewegungen. Mein Atem beschleunigte, als er einen Löffel und ein Feuerzeug zu Tage beförderte.
»Was …?« Ich deutete in einer fahrigen Geste auf die drei Tütchen.
»Richtig guter Stoff«, entgegnete er mit einem tiefen Grollen in der Stimme. »Wird dir gefallen.« Mit zwei Fingern umfasste er mein Kinn, presste seinen Mund auf meinen. Kurz nur, ehe ich mich von ihm losmachte und einen Schritt zurückwich. Ich spürte die Wand der Kabine im Rücken und erbebte.
»Heroin?« Meine Stimme zitterte noch heftiger als meine Hände, mit denen ich Halt an der Wand suchte.
»Speedball. Schon mal probiert?«
Ich nickte. Mein Atem flog.
Ich hatte die Mischung aus Heroin und Koks schon mehr als einmal ausprobiert und wusste um das gigantische Gefühl, wenn Sedativa und Highs ihre gegensätzliche Wirkung entfalteten. Aber auch in meinem aufgeputschten Zustand wusste ich nur allzu gut, wie leicht es zu einem Kreislaufkollaps mit Todesfolge kommen konnte, wenn man aus Versehen eine Überdosis Heroin beimischte. Andererseits war der Moment, wenn die aufputschende Wirkung des Kokains nachließ und die einschläfernde Wirkung des Heroins einsetzte, mit nichts auf der Welt zu vergleichen.
»Ich … nehm kein Heroin mehr«, presste ich hervor. Der Hüne vor mir lachte nur.
Er ging vor dem Toilettensitz in die Knie und träufelte ein wenig Ascorbinpulver auf den Löffel, schob mit der Spitze seines Taschenmessers eine geringe Menge Heroin dazu und vermengte die beiden Pulver miteinander. Mit einem Blick über die Schulter zu mir griff er nach dem Feuerzeug.
Der Anblick, wie Heroin und Ascorbin zunächst am Löffelrand flüssig wurden und dann die gesamte Mischung zu köcheln begann, brachte meinen Puls zum Rasen. Der Kerl hatte wirklich wenig Heroin beigemischt, eine versehentliche Überdosis war unwahrscheinlich. Sehr unwahrscheinlich.
»Wie viel von dem Zeug hast du schon genommen?«
Mein Blick flog von dem Löffel nach oben in das Gesicht des Hünen.
»Hmm?«
»Du bist doch auf Koks, oder? Wie viel hast du in den letzten Stunden genommen?«
Ich schluckte trocken, stieß mich von der Wand ab, sodass ich wieder direkt vor ihm stand.
»Nicht viel. Zwei Lines, mehr nicht.«
»Okay.«
Ich hätte ihn anlügen können, sicher hätte er nicht danach gefragt. Doch noch hing ich genug an meinem Leben, um es nicht willentlich in einem einzigen Löffel Heroin zu ertränken.
Mit angehaltenem Atem sah ich zu, wie er das komplette Tütchen Kokain in die brodelnde Flüssigkeit schüttelte. Rasch löste es sich auf, zurück blieb ein verlockend goldbraun schimmerndes Gemisch. Meine Essenz zur Glückseligkeit.
Mein Atem kam stoßweise, als er die Flüssigkeit in eine Spritze aufzog. Nur die Hälfte davon. Aber eben auch nur eine Spritze. Auffordernd hielt er sie mir entgegen und deutete auf meinen Arm. Ich wich einen halben Schritt zurück, in Richtung der verschlossenen Tür.
»Was ist mit dir?«
Er grinste breit bei meinen Worten.
»Ich setz mir den Schuss, sobald du deinen hast. Oder kannst du’s alleine? Dann können wir auch gemeinsam.«
Ich zögerte, schüttelte den Kopf. Tatsächlich hatte ich mir noch nie selbst eine Spritze gesetzt. Zu sniffen war eine Sache. Sich einen Schuss in die Adern jagen zu lassen, eine ganz andere. Aber mir selbst mit einer Nadel die Haut, die letzte Barriere, zu durchstechen, lag außerhalb meiner Vorstellungen.
»Tja, dann … Willst du oder willst du nicht?«
Mein Herz raste. Ich bekam kaum Luft. Es war Wahnsinn und ich wusste es. Wusste ganz genau, dass mich dieser verdammte Speedball vollkommen wehr- und willenlos machen würde. Dass ich den Kerl alles würde tun lassen, ganz egal, was es sein mochte.
Ich fixierte den Kerl durch zusammengekniffene Augen. Einen Moment lang starrten wir uns an, dann griff er in seine Hosentasche und hielt mir deren Inhalt auf der flachen Hand entgegen: eine zweite Spritze, ein Kondom, ein Tütchen Gleitgel.
Zischend atmete ich aus, schloss für einen Moment die Augen. Taumelte innerlich. Und fiel.
Als ich die Lider wieder hob, streckte ich ihm meinen Arm entgegen, ließ zu, dass er mir meinen Gürtel mit einem Ruck aus der Jeans zog. Das Geräusch jagte mir eine Gänsehaut über den Rücken hinab. Gleich … gleich …
Er band mir den Arm oberhalb des Ellbogens ab und packte am Unterarm zu. Ich stand stocksteif da. Wagte es nicht mehr, mich zu rühren. Der Moment, als die Spitze der Nadel meine Haut durchstach und sich in meine Vene bohrte, war wie verdammte Magie. Ich sah zu, wie der Fremde den Inhalt der Spritze in meine Blutbahn drückte. Die Härchen an meinen Armen stellten sich auf und ich hätte schwören können, dass ich die Bewegung jedes einzelnen Haares spürte.
Nur wenige Sekunden später war es, als würde mein Hirn explodieren. Das flüssige Koks traf meinen Körper mit der Wucht eines in Watte gepackten Vorschlaghammers. Keuchend ging ich in die Knie. Jeder Millimeter meiner Haut prickelte, mein Herz hämmerte, als wolle es gleich aus meiner Brust springen.
Ich schaffte es gerade noch, den Gürtel um meinen Arm zu lösen. Über mir sah ich die Silhouette des Hünen und spürte, dass er nach mir griff. Im ersten Moment war seine Berührung nur ein Hauch. Mein eigener Körper fühlte sich viel zu sehr wie ein riesiger, klingender, chinesischer Gong an, als dass ich einen anderen Leib hätte wahrnehmen können. Doch als er meine Arme umschloss, mich in die Höhe zerrte und mit dem Gesicht voran gegen die Kabinenwand drückte, jagte der Kontakt seiner und meiner Haut wie eine elektrische Schockwelle durch meinen Körper.
Ich wollte schreien und weinen gleichzeitig, brachte jedoch nur ein hilfloses Keuchen zustande. Mein ganzer Leib vibrierte. Mir war heiß und kalt und heiß und kalt und wieder heiß. Mein Atem raste, als sei ich soeben fünfhundert Meter gesprintet, ich bekam kaum Luft und war mir so verdammt sicher, dass ich nicht zu Atmen brauchte. Alles, was ich brauchte, war das hier.
Koks in meinen Venen und dieser Schwanz in meinem Arsch.
Die harten Stöße des Hünen pressten mich grob gegen die Wand, mehrfach krachte mein Becken dagegen. Doch ich fühlte keinen Schmerz. Ich fühlte nur Ekstase und Geilheit. Vollkommene Glückseligkeit.
Ich hörte irgendjemanden schreien und vielleicht war ich es selbst.
So – verdammt nochmal, genau so – fühlte sich das Paradies an. So fühlte es sich an, zu fliegen.
Mein Orgasmus kam schnell und mit einer solchen Intensität, dass ich befürchtete, es nicht zu überleben. In meinem Hirn manifestierte sich die irrwitzige Vorstellung, meine Lebenskraft spritze wie mein Sperma in heißen Schüben aus mir heraus und bliebe an der Toilettenwand kleben. Und das Fantastische daran war, dass ich es liebte.
Keuchend sank ich gegen die Wand. Vermochte nicht zu sagen, ob der Kerl hinter mir mich noch hielt, noch in mir oder längst verschwunden war. Und es war mir so verdammt egal.
Irgendwann ließ der Kick des Kokains nach und das Heroin entfaltete seine Wirkung. Mehr noch als das Koks zuvor hob das Heroin die Schwerkraft auf. Statt hochzufliegen, glitt ich im sanften Sinkflug dahin. Schwebte, wie auf zärtlichen Wattewolken getragen. Fühlte mich ruhig und zufrieden. Jede Bewegung, jeder Atemzug, kam mir verlangsamt vor. Ganz so, als würde ich schwerelos dahingleiten und irgendwann zerfließen. Ich schwebte weiter. Sank tiefer. Und tiefer.
Und fiel.
~~~
So schwebend der Sturz auch gewesen sein mochte, der Aufprall am Boden war umso schmerzhafter.
Ich erwachte schweißgebadet und zitternd vor Kälte, spürte widerlich glattes, kühles Leder am Rücken. Zu gerne hätte ich nach der Wolldecke gegriffen, die zusammengefaltet am Ende des Sofas lag, doch das hätte bedeutet, mich bewegen zu müssen. Mein Körper fühlte sich matt an, die Glieder viel zu schwer, um sie wegen etwas so Unwichtigem wie einer Decke zu rühren. Also blieb ich minutenlang liegen, drückte das Gesicht gegen das Leder der Seitenlehne und versuchte mit tiefen, ruhigen Atemzügen gegen die drückende Übelkeit in meinem Magen anzuatmen.
Irgendwann – als ich nicht mehr fürchtete, bei der kleinsten Bewegung wieder in meinen deliriumsartigen Schlaf zu fallen – kämpfte ich mich in eine sitzende Position hoch. Sofort begann sich der riesige Wohnraum des Lofts zu drehen und ich presste die Lider zusammen, zwang mich erneut zu einem ruhigen Atemrhythmus.
Ich kannte die Downs nach einer Nacht voller Highs zur Genüge, um zu wissen, dass das beste Mittel gegen den Hangover Bewegung war. Es galt, den Kreislauf in Schwung zu bringen, doch wenn nicht nur Reste von Kokain, sondern auch von Sedativa in der Blutbahn zirkulierten, wurde der erste Schritt zur echten Qual.
Langsam stieß ich die Luft durch leicht geöffnete Lippen aus, ehe ich die Augen aufschlug und die Beine vom Sofa schwang. Zwar drehte sich das Loft nicht mehr, der riesige Raum bot aber auch keinerlei Fixpunkt für meine Augen, um sich daran zu klammern. Also konzentrierte ich mich statt auf einen festen Punkt im Raum auf meinen zerschlagenen Körper und nahm mit Unwohlsein das altbekannte, schwammige Gefühl nur wenige Stunden zurückliegenden Analverkehrs wahr. Ruppigen Analverkehrs.
Mit einem Grollen in der Kehle kämpfte ich mich vollends vom Sofa hoch, kam schwankend zum Stehen und gab dabei mein Bestes, den ziehenden Schmerz in meiner Kehrseite und das Gefühl, noch immer einen viel zu großen Schwanz im Arsch zu haben, zu ignorieren.
Es gelang mir jedoch nicht.
Auch nicht, als ich es endlich bis ins Badezimmer geschafft hatte und mich dort meiner Jeans und Pants entledigte. Um nicht umzufallen, musste ich mich am Waschbeckenrand festklammern und der Griff schickte flackernde Bilder durch mein Gedächtnis. Erinnerungsfetzen an zu lange Nächte, zu viele Kerle und zu viele Drogen.
In meiner Jeans auf dem Boden fand ich mein Handy und ein Blick darauf bestätigte mir, dass ich nicht eine Nacht durchgemacht hatte, sondern drei. Wo genau die Tage dazwischen geblieben waren, vermochte ich nicht zu sagen. Und wenn ich ehrlich war, wollte ich es auch nicht wissen.
Achtlos ließ ich mein Handy auf die Ablage über dem Waschbecken gleiten, bückte mich noch einmal nach meinen Klamotten, um sie in den Wäschekorb gegenüber der Dusche zu befördern, stockte jedoch mitten in der Bewegung. Sekundenlang starrte ich wie gebannt auf das verschmierte Stück Stoff in meiner Hand und währenddessen setzte sich eine neue, ekelerregendere Übelkeit als zuvor in meinem Magen und in meinem Kopf fest. Weil textile Zeugen und Erinnerungsfetzen plötzlich ein reales Bild ergaben. Weil ich begriff, dass mein Arsch und meine Schenkel nicht alleine von Schweiß, sondern auch von winzigen Tröpfchen Blut und Sperma verklebt waren. Mein Blut, aber nicht mein Sperma.
»Fuck«, flüsterte ich der Pants in meinen Händen zu. Kurz stockte mein Atem. Und dann: »Gottverdammt, fuck …!«
Ich murmelte den Fluch immer wieder, während ich begriff, dass ich nach einem drogenreichen Höhenflug noch nie derart tief und schmerzhaft gefallen war. Wirklich noch nie. Nichtmal, als ich Jerik …
Ich verbot mir, den Gedanken weiterzudenken. Nicht Jerik. Nicht jetzt.
Hastig stopfte ich Jeans und Pants in den Wäschekorb, sprang regelrecht in die ebenerdige Duschkabine und drehte den Strahl der Regendusche auf volle Stärke. Keuchte auf, als das zunächst kalte Wasser meine Schultern traf. Doch gleich darauf wurde es wärmer, dann heiß und ich ließ mit einem verzweifelten Stöhnen den Kopf in den Nacken sinken. Schloss die Augen. Vermied absichtlich den Blick nach unten. Ich musste nicht sehen, wie sich lösendes Blut die Pfütze zu meinen Füßen zartrosa färbte. Der brennende Schmerz an meinem Hintern war Erinnerung genug. Ebenso das flaue Gefühl in meinem Inneren.
Und während ich mir minutenlang das heiße Wasser auf den Körper prasseln ließ, fragte ich mich, was schwerer zu ertragen war: Die endlose Ungewissheit, die immer wiederkehrenden, stillen Fragen nach dem Was, wenn doch? Oder die Gewissheit, ein einziges Mal zu viel nicht aufgepasst zu haben?
~~~
Ich entschied mich für Gewissheit. Obwohl ich mir nicht sicher war, ob ich sie überhaupt haben wollte.
»Wie lange …?« Ich räusperte mich und setzte erneut an: »Wie lange wird das Testergebnis dauern?« Bei den Worten wagte ich es kaum, die Labormitarbeiterin anzusehen, geschweige denn, meinen Blick auf die Spritze in ihrer Hand zu richten.
»In der Regel nur sechs bis zwölf Stunden. Da es noch recht früh ist …«, aus dem Augenwinkel warf sie einen prüfenden Blick auf die Uhr, »… dürfte das Ergebnis noch heute vorliegen.«
Vermutlich erwartete sie ein erleichtertes Aufatmen oder dergleichen, doch sechs bis zwölf Stunden