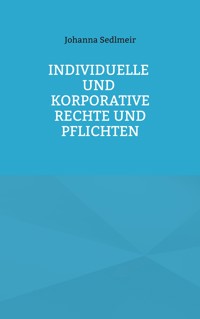
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Wirtschaft ist kein moralfreier Raum. Somit lassen sich auch alle Beziehungen in diesem Kontext aus einer ethischen Perspektive betrachten. Die Hauptfrage in diesem Buch lautet also: Welche moralischen Rechte und Pflichten schulden sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber wechselseitig?. Der Fokus liegt dabei auf zwei Normen: Integrität und Loyalität. Diese geraten jedoch oft in Konflikt, wie z. B. beim Thema Whistleblowing.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 336
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Wirtschaft ist kein moralfreier Raum, auch wenn die gegenteilige Annahme einer gewissen Anhängerschaft nicht entbehrt. Insofern lassen sich auch jegliche Beziehungen innerhalb des wirtschaftlichen Kontextes aus einer ethischen Perspektive betrachten. Der Fokus dieses Buches liegt dabei auf der Beziehung zwischen Individuum und Unternehmen, wobei es sich primär mit den moralischen Rechten und Pflichten beschäftigt, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegenüber ihrem Arbeitgeber und umgekehrt die Unternehmen gegenüber ihren Angestellten haben. Die Hauptfrage lautet demnach: „Was schulden sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber wechselseitig?“. Neben der Darlegung von den sogenannten moralischen „Grundrechten“ im Wirtschaftskontext, werden insbesondere zwei Normen erläutert und diskutiert: Das Recht der Arbeitnehmer auf den Schutz ihrer Integrität sowie das Recht der Unternehmen auf die Loyalität ihrer Mitarbeiter. Aufgrund ihres jeweiligen Geltungsbereichs treten genau diese beiden Rechte jedoch oftmals in Konflikt zueinander, wie beispielsweise beim Thema Whistleblowing.
Johanna Sedlmeir studierte Philosophie, Psychologie und VWL in München und Madrid. Sie begann ihre berufliche Karriere in der Personalberatung und arbeitete parallel dazu an ihrer Dissertation; diese schloss sie im Jahr 2020 ab. Seit ihrem Berufseintritt ist die Autorin in verschiedenen Funktionen mit Fokus auf Personalauswahl und-diagnostik in unterschiedlichen Unternehmen tätig.
Meiner Mutter und Volker in Dankbarkeit
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Einführung und Relevanz des Themas
1. Voraussetzungen
1.1 Moralität im Markt
1.1.1 Thematische und historische Einordnung
1.1.2 Das Verhältnis von Ethik und Ökonomik
1.2 Die Konzeption der praktischen Vernunft
1.3. Das Unternehmen als moralischer Akteur
1.3.1 Unternehmensdefinition
1.3.2 Kollektive Handlung und kollektive Verantwortung
1.3.3 Der moralische Status von Unternehmen
2. Individuelle und korporative Rechte und Pflichten
2.1 Rechte und Pflichten – eine Begriffsklärung
2.1.1 Analyse des Rechtsbegriffs
2.1.2 Analyse des Pflichtbegriffs
2.2 Moralische Rechte und Pflichten im wirtschaftsethischen Kontext
2.2.1 Individuelle Rechte des Arbeitnehmers
2.2.2 Korporative Rechte des Arbeitgebers
2.3 Integrität als besonderes Recht des Individuums
2.3.1 Begriffliche Annäherung
2.3.2 Integrität als besonderes Recht des Arbeitnehmers
2.4 Loyalität als besonderes Recht des Unternehmens
2.4.1 Begriffsbestimmung
2.4.2 Loyalität gegenüber dem Unternehmen
2.4.3 Loyalität als besonderes Recht des Unternehmens
2.5 Diskussionsbeispiel: Bilanzierung
Schlussbemerkung
Literaturverzeichnis
Vorwort
Die Arbeit an meiner Dissertation begann ich unter der Prämisse, dass die Wirtschaft kein steriler, weil moralfreier Lebensbereich ist. Entsprechend sind die Interaktionen zwischen allen Akteuren stets auch von einer ethischen Dimension geprägt. Dabei hatte mich insbesondere die Beziehung zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern unter moralischen Gesichtspunkten interessiert. Da diese Thematik jedoch selbst für eine Doktorarbeit zu umfassend war, fokussierte ich mich auf zwei Aspekte: Integrität und Loyalität. Diese beiden Begriffe kristallisierten sich unter dem Einfluss der damaligen öffentlichen Debatten um das Thema Whistleblowing (z. B. Edward Snowden 2013) sowie der Aufdeckung umfassender illegaler Aktivitäten von Unternehmen (z. B. der VW Dieselskandal 2017) heraus. Aber selbst in diesem definierten Rahmen eröffneten sich stetig weitere philosophische Fragestellungen wie beispielsweise zu dem Status von Unternehmen als kollektiven Akteuren oder den „besonderen Pflichten“ von Arbeitnehmern. All diese Themen hoffe ich mit der ihnen angemessenen Sorgfalt behandelt (und ohne dieses Buch unnötig erweitert) zu haben.
Hierbei handelt es sich um die überarbeitete Version meiner 2020 an der LMU München eingereichten und angenommenen Dissertation. Dieses Projekt hätte ich jedoch ohne die Unterstützung meines beruflichen, universitären sowie privaten Netzwerks nicht abschließen können. Daher gilt mein Dank all denjenigen, die mich während der Arbeit an der Promotion begleitet, gefördert und unterstützt haben. Im Besonderen möchte ich dazu die folgenden Personen nennen.
Zunächst danke ich v. a. meinem Doktorvater Prof. Dr. Dr. h. c. Julian Nida-Rümelin für die mehrjährige Betreuung der Arbeit und für seine stets konstruktive Kritik. Des Weiteren danke ich meinem Zweitgutachter apl. Prof. Dr. Martin Rechenauer und meinem Drittprüfer Prof. Dr. Dr. h. c. Hans-Ulrich Küpper für wertvolle Hinweise, auch über den philosophischen Tellerrand hinaus. Mein Dank gilt außerdem allen TeilnehmerInnen des Forschungskolloquiums am Lehrstuhl für Philosophie und politische Theorie der LMU München sowie den TeilnehmerInnen des Forums für Wirtschaftsphilosophie 2019 in München für hilfreiche Anmerkungen und Denkanstöße.
Zudem möchte ich mich sehr herzlich bei den Geschäftsführern und zugleich meinen beiden ehemaligen Vorgesetzten David Buchberger und Uli Ritter von Glasford International Deutschland bedanken, die mir die Promotion vonseiten der Firma ermöglichten. Durch den Beruf als Personalberaterin erhielt ich über die Jahre direkte und umfassende Einblicke in die Strukturen, Funktionsweisen und Kulturen verschiedener Organisationen sowie in die Rollen und Aufgaben von deren Mitarbeitern. Vielen Dank auch an meine aktuellen wie ehemaligen KollegInnen für die bisherige sehr gute und erfolgreiche Zusammenarbeit.
Außerdem bedanke ich mich bei den folgenden Personen, die mich in den unterschiedlichen Phasen meiner Doktorarbeit durch lange Gespräche, Korrekturen und andere Impulse nachhaltig beeinflusst und unterstützt haben (in alphabetischer Reihenfolge): Dr. David Althaus, Sabine Götzensberger, Timo Greger, Prof. Dr. Lisa Herzog, Andreas Hörtner, Dr. Barbara Kollenda, Julia Lamprich, Kim Morgan-Maier, Prof. Dr. Christian Neuhäuser, Dr. Martin Scherer, Frauke Schmode, Dr. Lea Watzinger und Klaus-Dieter Weinzierl.
Abschließend gilt mein größter Dank meinem Mann Volker Becher, meiner Mutter Hildegard Sedlmeir, meiner Familie und meinen Freunden, die dieses Projekt von den ersten Überlegungen an mit viel Geduld und Ausdauer bis zur Fertigstellung gänzlich mitgetragen haben.
Einführung und Relevanz des Themas
Diese Arbeit befasst sich mit der Analyse der Beziehung zwischen Individuum und Unternehmen, wobei sie sich vorrangig mit der Fragestellung beschäftigt, welche moralischen Rechte und Pflichten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter1 gegenüber ihrem Arbeitgeber und umgekehrt die Unternehmen gegenüber ihren Angestellten haben. Die Hauptfrage lautet demnach: „Was schulden sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber wechselseitig?“. Dabei handelt es sich weniger um die vertraglich und juridisch festgelegten, sondern vielmehr um die moralischen Rechte und Pflichten. Das Ziel dieser Arbeit besteht somit in der Darstellung und Ausarbeitung der individuellen wie korporativen grundlegenden Rechte, welchen jeweils auch eine grundlegende Pflicht korrespondiert. In Bezug auf die Individualrechte werde ich mich insbesondere auf die entsprechenden Menschenrechte beziehen sowie auf die Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO, engl.: ILO) verweisen. Für Unternehmen existieren jedoch bislang keine allgemein gültigen moralischen Regeln, da sie bisher zumeist lediglich als juristische Körperschaften oder rein wirtschaftliche Einheiten und nicht als moralische Akteure angesehen werden.
Neben der Darlegung der „Grundrechte“ im Wirtschaftskontext, beabsichtige ich zudem in dieser Arbeit zu zeigen, dass zu diesen zusätzlich zwei weitere Normen zählen: Das Recht der Arbeitnehmer auf den Schutz ihrer Integrität sowie das Recht der Unternehmen auf die Loyalität ihrer Mitarbeiter. Aufgrund ihres jeweiligen Geltungsbereichs treten genau diese beiden Rechte jedoch an einigen Stellen in Konflikt zueinander. Das Spannungspotential zeigt sich beispielsweise deutlich anhand der Thematik des Whistleblowings. Angenommen, ein Beschäftigter entdeckt bei seinem Arbeitgeber eine unmoralische Praxis. Überwiegt in diesem Fall sein Recht auf die Wahrung seiner Integrität, dem er nur durch den Gang an die Öffentlichkeit nachkommen kann, oder ist nicht doch der Anspruch der Firma auf die ihr entgegenzubringende Loyalität größer, da öffentliches Whistleblowing dem Unternehmen signifikanten Schaden zuführen würde, wodurch möglicherweise auch viele Angestellte ihre Arbeit verlieren würden? Auf diese Frage lässt sich in der Tat keine einfache und verallgemeinernde Antwort geben. Vielmehr gilt es, eine ausführliche Betrachtung der beiden Rechte durchzuführen, um deren Geltungsbereiche klar darzustellen und sie voneinander abzugrenzen. Für die Grenzgebiete, in denen sich beide Normen überlappen, sind die verschiedenen Gründe umfassend gegeneinander abzuwägen.
Thematische Relevanz
Mit der Diskussion dieser grundlegenden Rechte möchte ich insbesondere auch dem folgenden Gedanken widersprechen, den ein ehemaliger Manager eines großen Unternehmens prägnant formulierte:
„What is right in the corporation is not what is right in a man's home or in his church. What is right in the corporation is what the guy above you wants from you. That's what morality is in the corporation“2.
Die Moralität von Unternehmen hängt natürlich in Teilen von ihren Führungskräften ab, durch deren moralische Handlungen die Firma selbst in der Lage ist moralisch zu „handeln“, weshalb die Manager auch eine gewisse Vorbildfunktion für ihre Mitarbeiter einnehmen sollten. Dennoch handelt es sich innerhalb einer Firma – oder auch insgesamt im Wirtschaftssystem – nicht um einen moralfreien Raum, in welchem jeder die Regeln selbst setzen kann, denen er folgt. Vielmehr gelten auch hier die gesellschaftlich allgemein gültigen moralischen Normen. Dennoch kommt es in der Praxis regelmäßig zu unternehmerischen Verstößen. Insofern erfreut sich auch das Gebiet der Wirtschaftethik seit einigen Jahrzehnten einer stetig wachsenden Aufmerksamkeit. Dafür mag es noch weitere Gründe geben, wie beispielsweise die Verbreitung von negativen Schlagzeilen im Zuge der steigenden medialen Aufmerksamkeit gegenüber Unternehmensfehltritten oder auch individuellen Verfehlungen und deren Folgen. Um hier nur einige Beispiele zu nennen: Der größte Bilanzbetrug in der deutschen Geschichte durch die Firma Wirecard; der systematische Steuerbetrug von institutionellen Investoren (z. B. Banken oder Fonds) im Rahmen der Cum-Ex- sowie Cum-Cum-Geschäfte; die illegale Überwachung von Mitarbeitern, wie es bei Lidl der Fall war oder auch die regelmäßig auftretenden Korruptions- und Veruntreuungsaffären, wie sie den Fußballweltverband FIFA getroffen hatten.
Zudem trägt die v. a. durch den Kapitalismus angetriebene Glorifizierung und Überhöhung des Prinzips der Gewinnmaximierung als universeller Beurteilungsnorm zur Unterordnung aller anderen Güter, wie beispielsweise individuelle Autonomie oder Erhaltung der Natur, bei. Auf der anderen Seite hat das System Wirtschaft im Zuge der Globalisierung immer mehr an Komplexität gewonnen. Dadurch ist gleichzeitig auch der Rechtfertigungsanspruch gestiegen, der sowohl an ein solches System als auch an seine Akteure gestellt wird.
Auch wenn – oder möglicherweise genau weil – die Wirtschaftsethik noch gerne als „Bindestrich-Ethik“ belächelt wird, ist die Forschergemeinde in vergleichsweise kurzer Zeit rasant gewachsen und hat durch ihre interdisziplinäre Ausrichtung neben Philosophen auch Ökonomen3 und Theologen4 zu interessanten Beiträgen inspiriert. Im deutschsprachigen Raum haben sich dazu mittlerweile vier Ansätze etabliert: Der Institutionenansatz von Karl Homann5, das Konzept der integrativen Wirtschaftsethik von Peter Ulrich6, der Werteansatz von Josef Wieland7 sowie das Konzept der analytischen Unternehmensethik von Hans-Ulrich Küpper8. Alle vier Konzeptionen greifen verschiedene Schwerpunkte bzw. Ebenen der Wirtschaftsethik auf, welche sie jeweils beleuchten. So blickt Ulrich aus der Makroperspektive auf das gesamte wirtschaftsethische System, welches für ihn eine Einheit von Ethik und Ökonomik darstellt. Für Homann lassen sich die beiden Bereiche nicht integrieren, sondern lediglich die Methoden des einen Gebietes auf das andere anwenden. Damit ist moralisches Verhalten alleine durch die Etablierung spezifischer, allgemein gültiger Anreize möglich, die durch geeignete Institutionen festgesetzt werden. Wieland hebt wiederum die Verbindung von Werten und Strukturen innerhalb von Unternehmen hervor. Im Gegensatz dazu sieht Küpper die Aufgabe der Unternehmensethik nicht in der Vermittlung spezifischer Werte, sondern vielmehr in der Analyse der innerhalb einer Unternehmung auftretenden Wertproblematiken. Der systematische Ort der Unternehmensethik liegt dabei in der Organisation selbst, nicht in der wirtschaftlichen Rahmenordnung.
Diese Fokussierung auf die Unternehmen im Rahmen der Unternehmensethik ist insbesondere in den USA vorherrschend. Dazu hat sich die Strömung der Business Ethics entwickelt.9 Deren Gegenstandsbereich lässt sich dabei als die Analyse der ethischen Dimensionen von produzierenden Organisationen und geschäftlichen Tätigkeiten zusammenfassen. Dazu zählt auch die ethische Betrachtung von der Produktion, dem Verkauf und dem Konsum von Gütern wie Dienstleistungen. Dabei werden oftmals einzelfallbezogene Berufsgruppen untersucht und entsprechende Ethikkodizes erarbeitet.
So ist beispielsweise ein Arzt, basierend auf dem hippokratischen Eid, in besonderer Weise dazu verpflichtet zur Gesundheit seines Patienten beizutragen, wohingegen ein Anwalt sich um ein möglichst günstiges Urteil für seinen Klienten bemühen muss. Weitere Themen umfassen die moralischen Aspekte von Führung („Was ist gute Führung?“) oder den Umgang mit Whistleblowern. Das Gewinnprinzip als oberste Maxime wird zumeist in Debatten um Corporate Social Responsibility (CSR) hinterfragt, da hierbei die These vertreten wird, dass Firmen auch der Gesellschaft gegenüber in einer sozialen Verantwortung stehen und diese somit bei Unternehmensentscheidungen zu berücksichtigen ist.
Dass jedoch nicht nur bestimmte Werte in Organisationen gelten, sondern dass tatsächlich auch moralische Rechte und Pflichten zwischen eben dieser und ihren Angestellten bestehen, war sowohl im nordamerikanischen wie auch im europäischen Raum bislang nur in überschaubarem Rahmen Gegenstand einer wissenschaftlichen Untersuchung. Das Ziel dieser Arbeit besteht darin, einen Beitrag zur Schließung dieser Forschungslücke zu leisten. Dabei erhebe ich keinen Anspruch darauf, diese Thematik aufgrund ihres inhaltlichen Umfangs vollständig behandeln zu können. Vielmehr beabsichtige ich, diese Problematik systematisch darzustellen und einen möglichen Lösungsweg aufzuzeigen.
Gerade weil unsere Lebenswelt, unsere Gesellschaft sowie deren Strukturen seit der Industriellen Revolution, insbesondere in den vergangenen Jahrzehnten, drastischen Veränderungen und Disruptionen unterworfen war, ist es notwendig diese neuen Umstände regelmäßig zu reflektieren. Insofern nehmen mittlerweile kollektive Akteure, wie z. B. Firmen, einen nicht zu übersehenden Anteil des gesellschaftlichen Lebens ein. So gab es alleine in Deutschland 2017 über 3,48 Millionen Unternehmen und darunter mehr als 15.000 Firmen mit über 250 Mitarbeitern.10 Historisch bedingt besteht ein Abhängigkeitsverhältnis des Arbeitnehmers vom Arbeitgeber. Unter den Arbeitgebern verstehe ich in dieser Arbeit mindestens mittelständische Unternehmen bis hin zu Großkonzernen. Laut Europäischer Union gelten gemäß der EU Empfehlung 2003/361 alle Firmen mit 50 bis 249 Mitarbeitern sowie einem Umsatz zwischen 10 und 50 Millionen Euro als mittelständische Unternehmen. Alle Firmen mit darüber hinausgehenden Umsatz und Mitarbeiterzahlen sind als große Unternehmen zu bezeichnen.11
Da der Arbeitnehmer zur Bestreitung seines Lebensunterhalts auf den Arbeitgeber angewiesen ist, befindet sich der Arbeitgeber in einer Machtposition ihm gegenüber. Um diese einzugrenzen, wurde in Deutschland während der Weimarer Zeit das Arbeitsrecht juristisch verankert.12 Dieses Arbeitsrecht „ist vor allem dadurch gekennzeichnet, dass die kollektiven Beziehungen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer erstmals eine angemessene rechtliche Ordnung erhielten“13. Auch wenn der Gesetzgeber bis heute eine Vielzahl an Arbeitsgesetzen verabschiedet hat, existiert dennoch keine einheitliche Kodifikation des Arbeitsrechts. Vielmehr handelt es sich um viele Einzelurteile, weshalb das Arbeitsrecht als Richterrecht zu bezeichnen ist. Entsprechend bestehen im Hinblick auf Gesetze und Rechtsprechung noch erhebliche Lücken, da diese kaum in der Lage sind, die Zukunft zu antizipieren und daher lediglich reaktiv tätig sein können.
Ähnlich verhält es sich mit den Arbeitsverträgen – seien diese individuell oder kollektiv bzw. tariflich organisiert. Diese Problematik stellt sich jedoch sowohl auf rechtlicher wie auch auf wirtschaftlicher Ebene. So hat sich seit einigen Jahrzehnten innerhalb der Volkswirtschaftslehre die Ansicht der Neuen Institutionenökonomik durchgesetzt, welche annimmt, dass Institutionen notwendig sind, um Transaktionen erfolgreich am Markt durchzuführen.14 Denn entgegen der neoklassischen Strömung geht diese Theorie von folgenden Voraussetzungen aus: beschränkte Rationalität, asymmetrische Informationen sowie unvollständige Verträge. Dies bedeutet, dass jede Transaktion mit gewissen Kosten verbunden ist; so beispielsweise auch beim Kauf einer Ware. Üblicherweise informiert sich der Käufer vorab über Eigenschaften, Preise usw. eines Produkts. Die Beschaffung dieser Informationen verursacht jedoch Kosten, also die für die Recherche investierten Zeit, die auch anderweitig hätte genutzt werden können. Da wir Menschen jedoch einerseits kognitiv nicht in der Lage sind, alle verfügbaren Informationen zu verarbeiten und andererseits die anfallenden Kosten einer vollständigen Recherche den daraus entstehenden Nutzen um ein vielfaches übersteigen würden, entsprechen die eben genannten drei Aspekte (asymmetrische Informationen usw.) deutlich eher der realen Lebenswelt.
Analog verhält es sich mit Verträgen. Aufgrund der beschränkten Rationalität sowie der Unmöglichkeit der Zukunftsvorhersage sind diese stets als unvollständig zu beschreiben. Entsprechend beinhalten Verträge hinsichtlich verschiedener Aspekte Lücken und damit immer auch einen Interpretationsspielraum. Eine Möglichkeit diese Lücken zu füllen, besteht in einer Herangehensweise aus moralischer Perspektive. Unabhängig davon, ob diese juristischen Vakua existieren oder nicht, gehe ich davon aus, dass Recht und Moral nicht gänzlich unabhängig voneinander, sondern vielmehr miteinander verschränkt sind. Das positive Recht ist nur solange stabil und gesellschaftlich akzeptabel, solange es nicht mit grundlegenden moralischen Kriterien in Konflikt gerät.15
Das Ziel dieser Arbeit ist es, genau diese Intuition in Bezug auf die nicht ausreichende Berücksichtigung von moralischen Normen im Arbeitskontext darzustellen. Im Fokus steht dabei ausschließlich das Verhältnis zwischen dem Unternehmen als Arbeitgeber und den Individuen als Arbeitnehmern. Auf die Ansprüche anderer Stakeholder wie Lieferanten, Kunden, die Gesellschaft oder auch die Umwelt kann in dieser Arbeit nicht eingegangen werden, da dies den Rahmen deutlich sprengen würde. Die Ausklammerung dieser Bereiche schmälert jedoch deren Dringlichkeit in keinster Weise. Auch beziehe ich mich im Hinblick auf die Gesellschaft und die Wirtschaftsordnung in erster Linie auf die derzeit in Deutschland vorherrschenden sozialen Strukturen sowie das marktwirtschaftliche System. Inwiefern sich also die hier generierten Erkenntnisse und Argumente auf andere Nationen und Kulturen anwenden lassen, ist daher im Einzelfall zu prüfen.
Methodisches Vorgehen und Aufbau
Zunächst ist darauf zu verweisen, dass diese Arbeit größtenteils philosophischer Art ist, zugleich aber auch (empirische) Elemente aus anderen Wissenschaften wie der Psychologie, Soziologie und Ökonomie beinhaltet. Damit steht nicht die quantitative oder qualitative Datenerhebung zur Feststellung des faktischen Status quo im Fokus. Vielmehr erfolgt die Darstellung und Diskussion der eingangs gestellten Hauptfrage auf einer theoretischen, d. h. normativen, Ebene. Zudem kann auf viele grundlegende Fragen in diesem Kontext nicht vertieft eingegangen werden, wie beispielsweise das Spannungsverhältnis zwischen Moral und Recht oder auch die Problematik der Letztbegründung von Menschenrechten. Diese Arbeit stützt sich auf Annahmen und Ergebnisse ausgesuchter Autoren und erhebt nicht den Anspruch, einen vollständigen Überblick über die gesamte Forschungsliteratur aller eben erwähnten Wissenschaftsdisziplinen geben zu können. Des Weiteren gehe ich davon aus, dass die Aufgabe der Philosophie darin besteht, eine Brücke zwischen abstrakten Überlegungen und der gelebten Praxis zu schlagen. Insofern schließe ich mich auch dem folgenden Gedanken von Julian Nida-Rümelin an:
„Es gibt keinen philosophischen Standpunkt, der über allem steht. Die Philosophie ist im Gemenge, sie ist, wenn sie relevant bleiben will, Teil einer umfassenden Praxis der Erkenntnisgewinnung und damit Teil der menschlichen Lebensform“16.
Diese Arbeit gliedert sich grundsätzlich in zwei Teile: Zu Beginn ist das Fundament der Fragestellung zu klären, also unter welchen Umständen diese Frage überhaupt gestellt werden kann. Im zweiten Teil erfolgen die Diskussion und die konkrete Ausgestaltung der individuellen sowie korporativen moralischen Rechte und Pflichten. Der erste Teil besteht selbst wiederum aus drei Voraussetzungen. Zunächst ist dabei zu zeigen, in welchem Verhältnis Ethik und Wirtschaft zueinander stehen. Dazu werde ich drei mögliche Ansätze diskutieren: Ethik als angewandte Ethik, Ethik als normative Ökonomik und Wirtschaftsethik als integratives Konzept. Ich werde mich dabei den Befürwortern eines verbindenden Ansatzes anschließen, wonach der Markt keine moralfreie Zone ist, die jenseits der Lebenswelt liegt, sondern vielmehr als Teil von dieser zu betrachten ist. Denn durch die Globalisierung der Wirtschaft und den technischen Fortschritt ist der Markt zu einem abstrakten, grenzenlosen Konstrukt avanciert. Insofern entspricht er heute zwar nicht mehr dem einstigen Konzept des Marktplatzes im Stadtzentrum, verfügt aber nach wie vor über dessen Funktion als Plattform für den interindividuellen Warentausch. Der Markt umfasst demnach jegliche Akteure (Individuen, Unternehmen, Staat), die sich an einer wirtschaftlichen Handlung beteiligen und kann daher auch nicht als von diesen isoliert angesehen werden.
Als nächstes werde ich die hier zugrunde liegende Vernunftkonzeption darlegen, welche größtenteils dem Ansatz der strukturellen Rationalität von Nida-Rümelin entspricht. Diese basiert auf der Praxis des wechselseitigen Gründe-Gebens und Gründe-Nehmens, welche auch insgesamt das Fundament gelungener zwischenmenschlicher Kommunikation darstellt. Im Gegensatz zur ökonomischen Rationalität, welche die Beurteilung einer individuellen Handlung alleine nach dem Kriterium der Eigennutzmaximierung zulässt, beinhaltet die strukturelle Rationalität kein oberstes Entscheidungsprinzip, sondern fokussiert vielmehr auf das jeweilige, situationsabhängige Abwägen von Handlungsgründen. Die Handlung wird also auch im gesamten, die Person betreffenden Kontext gesehen und nicht nur punktuell betrachtet. Ziel ist dabei eine individuell kohärente Handlungspraxis, also dass ein Individuum nicht heute auf die eine Art und morgen auf eine ganz andere Weise agiert. Denn ein solches sprunghaftes und unvorhersehbares Verhalten ist sowohl für den Betreffenden selbst problematisch, da die interne Verbindung von sich gänzlich widersprechenden Werten oder Überzeugungen in vielen Fällen schwer möglich ist und daher nur durch die Aufspaltung in verschiedene Persönlichkeiten durchführbar ist; als auch für die Umgebung des Individuums, da seine Interaktionspartner nicht wissen wie sie auf eine solche Person reagieren sollen.
Schließlich ist zu erläutern, in welchem Umfang Organisationen den Status von kollektiven Akteuren einnehmen können sowie moralisch zu berücksichtigen sind. Diese Überlegungen bauen dabei auf den Debatten um kollektive Handlungen, kollektive Verantwortung sowie kollektive Intentionalität auf. Eine Person gilt dann als Akteur, wenn sie eine Handlungsabsicht ausbilden, die Handlung tatsächlich ausführen und schließlich auch die Verantwortung dafür übernehmen kann. Inwiefern dies auch auf Kollektive zutrifft, stelle ich u. a. in Rückgriff auf Peter French, Deborah Tollefsen und Margaret Gilbert dar. Der Handlungsbegriff eines Kollektivs wie einer Organisation kann dabei nicht derselbe sein wie derjenige, der für ein Individuum gilt, da Kollektive offensichtlich einen anderen ontologischen Status im Vergleich zu Menschen einnehmen und daher nicht auf dieselbe Art handeln können. Allerdings werden Organisationen in der Praxis als Akteure wahrgenommen und gelten als juristische Personen, die Verträge schließen und dementsprechend für etwaige Vergehen haftbar gemacht werden können. Insofern sind dafür alternative Ansätze wie ein angepasster Verantwortungsbegriff oder ein sekundäres Handlungskonzept zu entwickeln. Dabei orientiere ich mich insbesondere an den Arbeiten von Christian Neuhäuser sowie Patricia Werhane.
Nachdem die Voraussetzungen betrachtet wurden, beleuchtet der zweite Teil die individuellen und korporativen Rechte und Pflichten. Dieser gliedert sich wiederum in fünf Unterkapitel. Zunächst werde ich die Begriffe des Rechts und der Pflicht erläutern, wobei ich die verschiedenen Rechtskategorien darlegen werde. Der Pflichtbegriff wird zudem in die Debatte um die special obligations, also die besondere Verpflichtungen, eingeordnet. Dabei wird sich zeigen, dass die spezifische Beziehung zwischen Individuum und Unternehmen ebenfalls eine besondere Beziehung konstituiert.
Im Anschluss daran werde ich eine Auswahl der moralischen Rechte (und den entsprechenden Pflichten) von Arbeitnehmern und Arbeitgebern vorstellen. Diese sind dabei als Ergänzung zu den in Deutschland bereits bestehenden Arbeitsgesetzen zu verstehen. Denn diese konkretisieren sich insbesondere in der Ausgestaltung des Arbeitsvertrages.17 So legt der Vertrag viele technische Details wie Beschäftigungstitel, Aufgaben, Gehalt, Urlaubstage, Krankheitsfall, Schweigepflicht, Pausen, Kündigungsschutz usw. fest. Die nicht vertraglich festgelegten Rechte und Pflichten entstehen zumeist implizit durch die Interaktion zwischen Individuum und Organisation, sind jedoch zugleich durch die gesellschaftliche Kultur sowie bisherige Unternehmenstradition geprägt.
Das Ziel dieser Arbeit besteht nun darin, diesen Rechten und Pflichten ein philosophisch-moralisches Fundament zur Verfügung zu stellen, auf welchem sie sich systematisch entfalten können. Zu diesen grundlegenden Rechten zählt beispielsweise das Recht auf die Anerkennung des jeweiligen moralischen Status – sowohl für die Arbeitnehmer als auch für die Arbeitgeber. Dies ist insbesondere in Bezug auf die Individuen bedeutsam, da es darauf abzielt, dass die Unternehmen die Angestellten nicht mehr nur als menschliche Ressourcen ansehen, sondern sie tatsächlich auch als Menschen und somit als Zwecke an sich begreifen. Weitere Rechte umfassen z. B. das Recht auf Freiheit im Sinne der freien Meinungsäußerung und entsprechender Bereitstellung einer offenen Kommunikationskultur sowie das Recht auf Sicherheit am Arbeitsplatz. Durch Zuwiderhandlung würden die Organisationen eines der elementarsten Menschenrechte, das Recht auf körperliche Unversehrtheit, verletzen. Außerdem darf eine Institution keinen Angestellten oder Bewerber für eine Position aufgrund seines Geschlechts, seiner Rasse, seiner Hautfarbe oder anderer Merkmale diskriminieren, da alle Menschen als gleich und frei anzuerkennen sind. Außerdem verfügt das Unternehmen über das Recht nicht geschädigt zu werden.
Des Weiteren werde ich ausführlich das individuelle Recht auf den Schutz der Integrität des Mitarbeiters diskutieren. Dazu werde ich zunächst den Integritätsbegriff klären und darlegen, inwiefern die hier verwendete Konzeption über das Alltagsverständnis von Integrität („das tun, was man für richtig hält“) hinausgeht. Anschließend wird auf die hohe Relevanz von personaler Integrität im wirtschaftlichen Kontext anhand eines Beispiels hingewiesen und aufgezeigt, wie sich ein entsprechendes Recht konstruieren lässt. Abschließend werde ich die Gründe, die für dieses Recht sprechen, erörtern.
Dazu werde ich ebenso ausführlich das korporative Recht auf Loyalität der Mitarbeiter betrachten. Auch hier wird zunächst eine Begriffsbestimmung vorgenommen, wobei insbesondere auf die Loyalitätsstrukturen sowie deren Dimensionen eingegangen wird. Im Anschluss daran werde ich die Konzeption sowie Ausgestaltung des korporativen Rechts auf Loyalität im wirtschaftlichen Kontext darlegen.
Abschließend skizziere ich das Spannungsverhältnis der beiden zuletzt genannten Rechte anhand eines beispielhaften Szenarios in der Buchhaltung. Dieses ist als Grenzfall zwischen beiden Polen des höchst Unmoralischen sowie der minimalen moralischen Verfehlung gestaltet. Dabei gilt es zu klären wie sich beide Rechte dabei zueinander verhalten.
1 Um die Lesbarkeit des Textes zu gewährleisten beinhalten im Folgenden die Begriffe „die Mitarbeiter“, „die Arbeiter“, „die Arbeitnehmer“, „die Kollegen“, „die Angestellten“ sowie „die Beschäftigten“ stets die Individuen aller Geschlechter – sofern nicht anders ausgewiesen. Alle aufgezählten Begriffe verwende ich zudem als Synonyme.
2 Jackall 1988, S. 109; Hervorh. im Original.
3 Viele Autoren haben einen philosophischen wie wirtschaftswissenschaftlichen Hintergrund. Dazu zählen u. a. Georges Enderle (Enderle 1993), Peter Koslowski (Koslowski 1988), Birger P. Priddat (Priddat 1994), Horst Steinmann (Steinmann und Löhr 1994), Albrecht Löhr (Löhr 1991) und Andreas G. Scherer (Scherer 2003).
4 Vgl. dazu Franz Furger (Furger 1992), Friedhelm Hengsbach (Hengsbach 1991) und Arthur Rich (Rich 1984-1990).
5 Vgl. dazu Homann und Blome-Drees 1992, Homann und Lütge 2005 und Homann und Suchanek 2005.
6 Vgl. dazu Ulrich und Wieland 1998, Ulrich 2001 und Ulrich 2010.
7 Vgl. dazu Wieland 1996, Wieland 1999 und Küng et al. 2010.
8 Vgl. dazu Küpper 2005, Küpper und Schreck 2009 sowie Küpper 2011.
9 Einen guten historischen wie inhaltlichen Überblick zum Themengebiet der Business Ethics erhält man bei Alexei Marcoux (Marcoux 2008) sowie Richard De George (De George, Richard T. 1990).
10 Vgl. dazu Statista 2018: „Anzahl der Unternehmen in Deutschland nach Beschäftigtengrößenklassen im Jahr 2017“.
11 Vgl. dazu den Artikel der Europäische Union: „What is an SME?“. Die mitarbeiterstärkste Firma im Jahre 2017/2018 war der amerikanische Konzern Walmart mit rund 2,3 Millionen Angestellten weltweit. Vgl. dazu die Auflistung der zehn größten Firmen in Hartmann 2018: „Die 10 größten Arbeitgeber der Welt“.
12 Der Grundgedanke (und damit auch das Ziel) des Arbeitsrechts lässt sich wie folgt formulieren: „Das Arbeitsrecht dient der Herstellung sozialer Gerechtigkeit bei freiheitsrechtlicher Gestaltung der Arbeitsbedingungen. Die wechselseitige Abhängigkeit in der modernen Industriegesellschaft schließt eine autonome Existenz des einzelnen aus. Daher ist es Aufgabe der Rechtsordnung, den Gedanken der Freiheit und Gleichheit unter den Funktionsvoraussetzungen arbeitsteiliger Produktionsweise zu verwirklichen“ (Arbeitsgesetze 2017, XVIf.).
13 Arbeitsgesetze 2017, XIIIf.; Hervorh. im Original.
14 Als Begründer dieser Theorie gilt Ronald Coase mit seinem 1937 erschienenen Aufsatz „The Nature of the Firm“ (Coase 1937). Ein weiterer bekannter Vertreter dieser Position ist der Wirtschaftswissenschaftler Oliver E. Williamson (Williamson 1975; Williamson 1985).
15 Zum Verhältnis von Recht und Moral siehe Abschnitt 2.1.1.
16 Nida-Rümelin 2018, S. 28.
17 Vgl. dazu Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2016: „Arbeitsrecht“.
1. Voraussetzungen
Die eingangs entwickelte Fragestellung zählt in den Bereich der Wirtschaftsethik. Nach einer kurzen Klärung der Begriffe Ethik, Moral, Ökonomie und Ökonomik erfolgt die systematische Einordnung der Thematik, die auch einen knappen geschichtlichen Überblick beinhaltet. Dazu werden die Voraussetzungen erörtert, auf dessen Fundament diese Arbeit aufbaut. Die erste Annahme besteht darin, dass der Markt keine moralfreie Zone ist, sondern dass Ethik und Ökonomie sich als gleichwertige Partner in einer gemeinsamen Lebenswelt anerkennen müssen (1.1). Die zweite Voraussetzung bezieht sich auf das zugrunde liegende Konzept praktischer Vernunft (1.2). Zuletzt wird dargelegt, inwiefern Unternehmen den Status von moralischen Akteuren einnehmen (1.3).
1.1 Moralität im Markt
Die thematische Trennung von Ethik und Ökonomik mag in mancher Hinsicht in der Tat sinnvoll erscheinen, da sich durch den allgemeinen wissenschaftlichen Fortschritt in beiden Bereichen unterschiedliche Zielsetzungen sowie Methoden ausgebildet haben. Vereinfacht ausgedrückt bemüht sich die Ethik um die (normative) Begründung und die Ökonomik um die Vorhersage menschlichen Verhaltens. Dennoch erscheint mir eine absolute Trennung dieser Bereiche nicht durchführbar zu sein, da letztlich beide Gebiete Teil einer gemeinsamen Lebenswelt sind. Denn angesichts der vielen spezifischen Fragen, welche sich seit einigen Jahrzehnten durch den enormen Fortschritt und die Weiterentwicklung der Wirtschaft unter der zunehmenden Globalisierung und deren Auswirkungen stellen, wie z. B. die Steigerung der Marktmacht der oftmals global agierenden Konzerne gegenüber ihren Stakeholdern (Mitarbeitern, Lieferanten, Gesellschaft) sowie die anhaltende Umweltzerstörung zugunsten der Profitmaximierung, ist auch das Bedürfnis gestiegen, ethische Komponenten (wieder) in ökonomische Überlegungen mit einzubeziehen. Prägnant formuliert wird der „Ruf nach Ethik“ in Bezug auf die wirtschaftlichen Verhältnisse unaufhörlich lauter.
Hinsichtlich des Verhältnisses von Ethik und Ökonomik sowie der anzuwendenden Methoden existieren jedoch unterschiedliche Ansichten. Ist dabei die erstgenannte Disziplin der zweiten vorgeordnet oder besteht doch ein Vorrang der ökonomischen Fragestellungen, auf die erst im Nachgang aus ethischer Perspektive reagiert werden kann? Ist die Anwendung ethischer Kategorien im wirtschaftlichen Kontext überhaupt möglich oder gelten dort allein die ökonomistischen Paradigmen der Effizienz und Gewinnmaximierung, durch welche die moralisch handelnden Akteure unter Wettbewerbsbedingungen zumeist das Nachsehen haben und aus dem Markt18 ausscheiden? In diesem Kapitel soll daher zum einen dafür argumentiert werden, dass Ethik und Ökonomie keine voneinander unabhängigen Bereiche, sondern Teil einer gemeinsamen Lebenswelt sind; und zum anderen, dass dementsprechend auch dem Markt moralische Komponenten innewohnen, die es aufzudecken gilt. Ich möchte damit lediglich meinen Standpunkt skizzieren und keinen zusätzlichen Beitrag zu der bereits sehr umfassenden Diskussion leisten.
1.1.1 Thematische und historische Einordnung
Bevor diese Arbeit in den thematischen und historischen Kontext eingeordnet werden kann, sind zunächst kurz die relevanten Begrifflichkeiten zu klären: Ethik, Moral, Wirtschaft, Ökonomik sowie Wirtschaftsethik.
a) Begriffsklärung: Ethik, Moral, Ökonomie und Ökonomik
Diese Arbeit gehört, wie bereits eingangs erwähnt, in den Bereich der Wirtschaftsethik. Dieser setzt sich offensichtlich aus zwei Komponenten zusammen, die erst seit kurzem wieder verstärkt in Verbindung miteinander gebracht werden: Wirtschaft und Ethik. Letztgenanntes bezeichnet dabei ein Teilgebiet der Praktischen Philosophie und umfasst alle Bereiche, die sich unter die von Kant prägnant formulierte Frage „Was soll ich tun?“ subsummieren lassen. Im Fokus ethischer Betrachtungen stehen demnach die Voraussetzungen und die Bewertung des menschlichen Handelns. Ziel ist die Begründung von richtigen im Sinne von angemessenen und wohlbegründeten Verhaltensweisen.
Die zur Beurteilung angewandten Prinzipien und Normen, also ob beispielsweise entweder die Intentionen oder aber die Folgen einer Handlung das entscheidende Kriterium darstellen, wurden in der Philosophiegeschichte stets heftig diskutiert. Seit der Begründung der Ethik als eigenständiger Disziplin durch Aristoteles ist mit dieser zudem sehr eng die Frage nach dem guten Leben sowie dem höchsten Gut verbunden.19 Diese Frage betrifft sowohl den Einzelnen als auch die Gesellschaft, da es für ein gutes und gerechtes Zusammenleben gewisser Gesetze und Normen bedarf. In diesem Zusammenhang wird oftmals auch der Begriff der Moral verwendet. Dieser kann in zweifacher Weise verstanden werden:20 Zum einen deskriptiv, insofern er spezifische Verhaltensregeln betrifft, die von einem Individuum oder einer Gruppe akzeptiert und umgesetzt werden; zum anderen normativ, insofern er sich auf einen allgemeinen sowie universell gültigen Katalog von Verhaltensregeln bezieht, gegen den keine guten Gründe vorgebracht werden können. Die Bewertung und Begründung moralischer Normen erfolgt im Rahmen der Ethik, weshalb die Moral auch als Gegenstandsbereich der Ethik bezeichnet werden kann.
Unter Wirtschaft bzw. Ökonomie ist laut Duden die „Gesamtheit der Einrichtungen und Maßnahmen, die sich auf Produktion und Konsum von Wirtschaftsgütern beziehen“ zu verstehen. Zu den Einrichtungen zählen dabei Unternehmen sowie private und öffentliche Haushalte. Die Maßnahmen beinhalten die Herstellung, den (Ver-)Kauf, die Distribution und die Entsorgung von Gütern. Im Zuge dessen werden auch Angebot und Nachfrage generiert wie reguliert. Ökonomik bezeichnet dabei zunächst die Wissenschaft, deren Gegenstandsbereich die Wirtschaft ist, also die Wirtschaftswissenschaft.
Die Wirtschaftsphilosophie schließlich bemüht sich um eine Verbindung der beiden eben genannten Fachgebiete Ethik und Ökonomik. Dabei existieren verschieden Ansätze hinsichtlich des Verhältnisses untereinander sowie unterschiedlicher Synthesemöglichkeiten, worauf ich später nochmals genauer eingehen werde. Grundsätzlich lässt sich die Wirtschaftsphilosophie analog zu den Handlungsebenen in drei Bereiche gliedern: die Makroebene (Wirtschaftssystem als Ganzes), die Mesoebene (Organisation) und die Mikroebene (Individuum).21
Die Wirtschaftsethik befasst sich somit auf der Makroebene insbesondere mit den Rahmenbedingungen der Wirtschaft und dem (nicht) funktionierenden Zusammenspiel der verschiedenen Akteure. Außerdem geht es um die Etablierung von wirtschaftsunabhängigen Institutionen und deren politischer und faktischer Durchsetzung anhand von Gesetzen und Regelungen. Der Bereich der Unternehmensethik entspricht der Mesoebene und umfasst sämtliche Beziehungen zwischen der Organisation und ihren Stakeholdern, d. h. ihren Anspruchsträgern. Zu den unternehmensinternen Stakeholdern zählen beispielsweise die Mitarbeiter oder Manager einer Firma; zu den unternehmensexternen hingegen Lieferanten, Kunden, die Gesellschaft usw. Aufgrund der verschiedenen und oftmals entgegengesetzten Interessen der vielen Anspruchsgruppen entstehen in einem Unternehmen zwangsläufig Zielkonflikte. Einige Beispiele für solche Konflikte – insbesondere zwischen Unternehmen und ihren Mitarbeitern – finden sich in der vorliegenden Arbeit. Abschließend ist noch die Mikroebene zu nennen. Im Fokus steht dabei der Einzelne innerhalb seiner Funktion, welche er im wirtschaftlichen Kontext ausfüllt. Oftmals wird dabei das Thema der Führungsethik diskutiert, also nach welchen Maßstäben beispielsweise ein Manager in Bezug auf seine Mitarbeiter handeln sollte. In diesen Bereich zählen jedoch auch Fragen nach dem angemessenen Verhalten von Kollegen untereinander oder auch das Gebiet der Konsumentenethik.
b) Geschichtlicher Hintergrund
Auch wenn der Themenkomplex Wirtschaftethik in seiner heutigen Form im Vergleich zu anderen ethischen Teildisziplinen „jung“ erscheint, so sehen sich die Menschen mit wirtschaftlichen Fragen konfrontiert seitdem sie in sozialen Verbänden leben. Bernd Noll rekonstruiert in seinem Werk die geschichtlichen Entwicklungen der Wirtschaftsethik, angefangen bei der Steinzeit, über die Antike und das Mittelalter bis hin zur Globalisierungsproblematik der Gegenwart.22 Damit bietet er einen kompakten, aber differenzierten Überblick hinsichtlich des historischen, ideengeschichtlichen sowie dogmatischen Entstehungshintergrundes der Wirtschaftsethik. Insofern prägen Ressourcenknappheit sowie die Frage nach dem gerechten Preis und der gerechten Verteilung der in der Gruppe erwirtschafteten Güter seit der Prähistorie das gemeinschaftliche Zusammenleben der Individuen – seien diese in Stammesgesellschaften, Stadtstaaten oder Nationalstaaten organisiert.
Da die wirtschaftlichen Handlungen nicht isoliert, sondern als Teil der gesamten gesellschaftlichen Interaktionszusammenhängen betrachtet wurden, galten Wirtschaft und Ethik bis weit in das 18. Jahrhundert hinein nicht als eigenständige Fachbereiche, sondern wurden gemeinsam innerhalb der Politischen Ökonomie behandelt. Als entscheidender Denker dieser Zeit gilt Adam Smith23, der sowohl als Moralphilosoph und Aufklärer bekannt ist, als auch als Begründer der klassischen Nationalökonomie gilt. In seinen Werken zeigt sich daher einerseits die einheitliche Betrachtungsweise der Politischen Ökonomie, andererseits aber auch die Emanzipation der Ökonomik als eigenständige Disziplin.
Im Zuge des von der Aufklärung angetriebenen Rationalisierungs- sowie Transformationsprozesses, der u. a. von Max Weber, Georg Simmel und Werner Sombart weiter vorangetrieben wurde, kam es letztlich zu einer Trennung von Ethik und Ökonomik, womit auch das von der utilitaristisch geprägten Neoklassik verfolgte Ziel – die Etablierung einer „reinen“ Ökonomik – erreicht war.24 Die reine Ökonomik impliziert dabei die Entfernung aller zuvor vorhandenen ethischen Kategorien, wie Menschenbild oder höchstes Prinzip, und beschränkt sich auf den Ansatz des methodologischen Individualismus, der auch in vielen anderen Wissenschaften wie beispielsweise der Psychologie oder Soziologie Anwendung findet. Dieser besagt, „dass sich soziale Phänomene letztlich nur vom Denken und Handeln der Individuen her erklären bzw. verstehen lassen“25.
In Bezug auf die Ökonomie wird den Individuen dabei eine gewisse Form der Rationalität unterstellt. Diese ökonomische Rationalität beinhaltet, dass die Individuen sich lediglich an ihren Präferenzen oder an entsprechenden Anreizen orientieren und strikt eigennutzmaximierend handeln, sich also wie homines oeconomici verhalten. Dieses theoretische Konstrukt stellt jedoch „nur ein nützliches Werkzeug [dar], weil mit diesem Modell auf Basis möglichst einfacher Annahmen Aussagen über wirtschaftliche Zusammenhänge formuliert werden können“26. So weist Homann mehrfach darauf hin, dass das Modell des homo oeconomicus nicht die gesamte Natur des Menschen widerspiegelt, sondern lediglich Minimalanforderungen in Bezug auf den Menschen beinhaltet. Diese seien notwendig, um Aussagen über entsprechende Verhaltensweisen innerhalb von spezifischen Theoriemodellen tätigen zu können, ohne diese übermäßig komplex zu gestalten. Dieser Ansatz ist nicht unumstritten, worauf ich jedoch im folgenden Abschnitt genauer eingehen werde.
1.1.2 Das Verhältnis von Ethik und Ökonomik
In der reinen Ökonomie sei gemäß Ulrich durch die Entstehung der modernen Marktwirtschaft das erwerbswirtschaftliche Prinzip oder Gewinnprinzip zum höchsten Gut avanciert. Dadurch habe sich für alle Marktteilnehmer der anonyme Zwang entwickelt, wettbewerbsfähig zu sein bzw. zu bleiben, weshalb für ethische Überlegungen kein Platz mehr vorhanden gewesen sei. Damit wurde die Trennung von Ethik und Ökonomik als zwei voneinander unabhängige Bereiche weiter zementiert, weshalb Ulrich auch von einer „Zwei-Welten-Konzeption“27 spricht.
In der zeitgenössischen Debatte existieren verschiedene Ansätze in Bezug auf die Möglichkeit und die Bedingungen, wie diese Aufteilung dennoch überwunden werden könnte, also ob und inwiefern Moralität im Markt vorhanden ist. Im deutschsprachigen Raum haben sich hinsichtlich der wirtschaftsethischen Theoriebildung insbesondere drei Herangehensweisen etabliert: Wirtschaftsethik verstanden als angewandte Ethik, als normative Ökonomik oder als integratives Konzept.28 Erstgenanntes suggeriert, dass Wirtschaft bislang frei von jeglicher Moral sei und diese erst in die Ökonomie „hineingetragen“ werden müsse. Die normative Ökonomik bemüht sich um die Unabhängigkeit von ethischen Kategorien, was ihr jedoch lediglich in Teilen gelingt. Die Moral ist dabei nicht im Markt, sondern in den Rahmenbedingungen verortet. Das letztgenannte Konzept schließlich argumentiert für Moralität im Markt, insofern als die Ökonomie bereits auf einem normativen Fundament aufbaut und es lediglich gelte dieses aufzudecken. Im Folgenden werde ich in kompakter Form die Grundzüge der ersten beiden Ideen sowie deren Kritikpunkte darstellen. In Abgrenzung dazu wird sich der dritte Ansatz als Basis für diese Arbeit erweisen.
1.1.2.1 Angewandte Ethik
Der unternehmensethische Ansatz von Horst Steinmann und Kollegen wird im Folgenden exemplarisch für die Konzeption einer Wirtschafsethik als angewandter Ethik erläutert.29 Laut Steinmann und Löhr bezieht sich Ethik auf jegliche zwischenmenschlichen Handlungssituationen, in welchen Konflikte auftreten können – sei dies in einem familiären, politischen oder eben auch wirtschaftlichen Umfeld. Die Unternehmensethik beansprucht daher „für den spezifischen Handlungszusammenhang der Unternehmung noch einmal eine Orientierungshilfe zur friedlichen Lösung von Konflikten bieten zu können“30. Zudem entspricht dieser Ansatz einer vernunftethischen Konzeption, d. h. der Fokus liegt nicht auf der Generierung von inhaltlichen oder materiellen Normen, sondern darauf, durch ein dialogorientiertes Verfahren zu einer von allen Beteiligten akzeptierten Lösung zu gelangen. Daher kann es nur um „solche Normen gehen, für die gute Gründe geltend gemacht wurden oder zumindest bei genauerer Nachfrage geltend gemacht werden könnten“31.
Gemäß Steinmann wird in der Wirtschaftsethik vorausgesetzt, dass das Gewinnprinzip – d. h. Liquidität und Rentabilität – einem Formalziel entspricht, dessen Einhaltung „in der Wettbewerbswirtschaft Bedingung für die Existenz jeder Unternehmung ist“32. Allerdings handelt es sich hierbei lediglich um eine Richtigkeitsvermutung. Dies bedeutet, dass durch die Festlegung auf die derzeit vorherrschende kapitalistische Wirtschaftsordnung allgemein unterstellt werden kann, dass das Gewinnprinzip als Formalziel gilt. Jedoch ist die Legitimität dessen nicht in jedem einzelnen Fall gegeben. So kann ein Unternehmen denselben Gewinn auf zwei verschiedene Arten generieren – auf ethische oder unethische Weise. Obwohl beide Strategien dem Gewinnprinzip entsprechen, ist klar, dass ein unethisches Vorgehen nicht legitimiert werden könnte. Daher sollte die Unternehmensleitung sich für die angemessene, d. h. die ethisch begründbare, Strategie entscheiden.
Da in der Zukunft nicht alle Situationen antizipiert und gesetzlich geregelt werden können, werden sich daraus stets Handlungsspielräume ergeben. Der Umgang mit denselben ist dann Gegenstand der Unternehmensethik. Also immer genau dann, wenn das Gewinnprinzip zu unethischen oder unmoralischen Konsequenzen führen würde, ist es notwendig dieses Prinzip bzw. die Konsequenzen zu hinterfragen und einen Begründungsdiskurs zu führen. Entsprechend sollen „Begründungen konkreter unternehmensethischer Normen (…) nur über eine dialogische Verständigung durch Argumentation gewonnen werden“33. So bauen sowohl Steinmann als auch Ulrich jeweils ihre Ansätze auf der Diskursethik auf, wobei sie daraus jedoch unterschiedliche Schlüsse ziehen. Einer der Unterschiede besteht beispielsweise darin, dass Steinmann das unternehmerische Gewinnprinzip als gegeben annimmt, während Ulrich dieses bzw. die dahinter stehende ökonomische Rationalität umfassend kritisiert. Auf den ersten Teil dieser Kritik34 werde ich im folgenden Abschnitt eingehen.
Kritik: Sachzwangthese und ökonomischer Determinimus
Wie bereits erwähnt setzen Steinmann und Löhr in ihrem wirtschaftsethischen Ansatz das Gewinnprinzip grundsätzlich voraus. Da somit die ökonomische Logik selbst nicht hinterfragt wird, kritisiert Ulrich dies als Reflexionsstopp, den die Wettbewerbsteilnehmer vor den vorgefundenen empirischen Bedingungen vornehmen. Dass dadurch die ökonomische Rationalität grundsätzlich nicht hinterfragt werden kann, stellt für Ulrich die Hauptproblematik dar. Dazu formuliert er in seiner Ökonomismuskritik zwei Argumentationsmuster, die er zum einen als Sachzwangthese („Der Markt zwingt uns zu...“) und zum anderen als Gemeinwohlthese („...aber es dient letztlich dem Wohl aller“) bezeichnet. Unter Ökonomismus versteht Ulrich dabei den „Glaube[n] der ökonomischen Rationalität an nichts als an sich selbst“35. Zunächst werde ich auf die Sachzwangthese36 eingehen, der zweite Einwand wird in Abschnitt 1.1.2.2 genauer betrachtet.
In der Konzeption von Steinmann und Löhr zeigt sich, dass die Zwei-Welten-Konzeption weiterhin aufrecht erhalten wird, indem der Versuch unternommen wird, die Ethik von außen über die Ökonomik zu stülpen. Angewandte Ethik bedeutet demnach die Begrenzung der Ökonomik durch die Ethik oder anders ausgedrückt ist die „systematische Rolle einer so ansetzenden korrektiven Wirtschaftethik die eines «Gegengifts» gegen zuviel ökonomische Rationalität“37. Gegen eine solche restriktive Forderung lässt sich generell nichts einwenden, allerdings wird die ökonomische Logik nicht hinterfragt, wodurch der bereits genannte Reflexionsstopp vor den vorgefundenen Bedingungen entsteht.
Die Sachzwangthese betrifft also die Frage, inwiefern Ethik unter Marktbedingungen überhaupt möglich ist. Der ökonomische Determinismus geht dabei von der Unmöglichkeit einer Wirtschaftsethik aus – wegen „des vom Wettbewerb ausgeübten Zwangs zur strikten ökonomischen Rationalität“38. Unter der Annahme der eigennutzoptimierenden Individuen sowie vollständiger Konkurrenz würde sich die bestmögliche, weil effiziente, Ressourcenallokation ergeben. Somit würde Ethik überflüssig werden bzw. wäre gar nicht erst vorgesehen. Ulrich merkt jedoch an, dass es nicht sinnvoll sei, den ökonomischen Determinismus als empirische Hypothese zu verstehen. Denn dieser könne sich einerseits nur scheinbar auf die unparteiliche, reine ökonomische Rationalität stützen, hinter der sich allerdings die persönlichen Interessen der Wirtschaftssubjekte verbergen; andererseits sei der Markt faktisch nicht perfekt, woraus (ethisch nutzbar zu machende) Handlungsspielräume entstehen, die jedoch von den empirisch vorgefundenen Handlungsbedingungen begrenzt würden. Daraus folgt laut Ulrich:





























