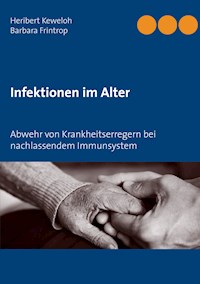
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Zahlreiche Infektionskrankheiten treten bei älteren Menschen häufiger auf oder verlaufen wesentlich drastischer: COVID-19, Influenza, Pneumokokken-Infektionen, Legionellen-Infektionen, Gürtelrose, FSME, Listeriose, Norovirus-Gastroenteritis, Campylobakteriose, Salmonellose, EHEC- und Clostridium difficile-Infektionen. Dieses Buch soll wichtige Fragen zur Entstehung, Bekämpfung und Verhinderung von Infektionskrankheiten sowie zur Bedeutung des Immunsystems für die Gesundheit älterer Menschen beantworten. Das Buch richtet sich an alle, die beruflich in der Gesundheitserhaltung und Pflege älterer Menschen engagiert sind. Es bietet darüber hinaus allen Interessierten besonders Senioren fundamentale und verständliche Informationen. Was sind Infektionen und wie werden sie von unserem Körper verhindert und bekämpft? Welche Rolle spielen Bakterien, Viren und andere Mikroorganismen für unsere Gesundheit? Wie funktioniert unsere Immunabwehr und wie verändert sie sich im Alter? Welche Auswirkungen haben die Veränderungen für Autoimmunerkrankungen, Krebserkrankungen und die chronischen Alterskrankheiten? Welche Erreger sind für Lebensmittelinfektionen verantwortlich? Wie genau kommt es zu solchen Erkrankungen und wie können wir sie verhindern? Worauf müssen die Älteren und ihre Mitmenschen achten, um gesund zu bleiben? Welche Rolle spielen Ernährung und Hygienemaßnahmen? Wie können wir das Risiko der Übertragung von Krankheitserregern verringern?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 340
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Autoren
Priv. Doz. Dr. Heribert Keweloh, Mikrobiologe, Tätigkeiten in Forschung und Lehre an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und der Fachhochschule Münster in Mikrobiologie, Ökotrophologie und Gesundheitswesen
Barbara Frintrop, Pädagogin mit den Schwerpunkten Biologie, Gesundheitswesen, berufliche Ausbildung im Gesundheits- und Pflegebereich, Oberhausen
Unter Mitarbeit von Marlen Braam, Lebensmittelchemikerin, Oberhausen, Kolektorat und Zeichnungen
Dr. Heribert Keweloh, Forststr. 129, 46147 Oberhausen
Alle Angaben in diesem Buch wurden sorgfältig geprüft, es kann jedoch keine Gewähr für deren Richtigkeit übernommen werden.
Die Pluralform von Personengruppen (z. B. die Ärzte) bezieht sich selbstverständlich auf weibliche und männliche Personen.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Kap. 1 Körperliche Veränderungen im Alter
Ursachen
Alterungsprozesse der Körperorgane
Organschädigungen durch Corona- und Grippeviren
Kap. 2 Infektionen
Was ist eine Infektion?
Epidemien und Pandemien
Eintrittspforten und Übertragungswege
Tiere und Zoonosen
Krankheitserreger, Meldepflicht und Dunkelziffer
Infektanfälligkeit und Risikogruppen
Infektionssymptome
Diagnostik
Kap. 3 Mikroorganismen
Bakterien
Pilze
Protozoen
Viren
Der Vermehrungszyklus der Viren
Gruppen der Viren
RNA- und DNA-Viren
Mikroorganismen und der Mensch
Das Mikrobiom: Der Mensch als Symbiose
Die Darmflora und die Bedeutung der Artenvielfalt
Die Entwicklung der Darmflora im Laufe des Lebens
Opportunistische Krankheitserreger
Probiotische Bakterien
Kap. 4 Infektionskrankheiten älterer Menschen
Influenzaviren und die ständig wiederkehrende Grippe
Coronaviren und die COVID-19-Pandemie
Noroviren und Rotaviren rufen Darmerkrankungen hervor
FSME-Viren, die von Zecken übertragenen Erreger
Gürtelrose und schlummernde Herpesviren
Campylobakteriose, die unbekannte Seuche
Enterobakterien, die Durchfallerreger
Listerien und Listeriose
Lungenentzündungen: Pneumokokken und Legionellen
Clostridium difficile
-Infektionen
Harnwegsinfekte - Blasenentzündungen
Kap. 5 Das Abwehrsystem des Körpers
Verhaltensmuster
Physikalisch-chemische und mikrobiologische Barrieren
Haut
Atemwege
Verdauungstrakt
Das angeborene Immunsystem
Elemente des angeborenen Immunsystems
Erkennung von Mikroorganismen
Ablauf der Immunreaktionen
Das erworbene Immunsystem
Antikörper
T-Lymphozyten
B-Lymphozyten
Organe und Abläufe des Immunsystems
Lymphatische Organe
Das Immunsystem des Darms
Kap. 6 Die Immunabwehr im Alter
Immunoseneszenz
Die natürlichen Körperbarrieren
Modifikationen im Immunsystem
Inflammaging
- Entzündungsaltern
Autoimmunerkrankungen
Krebserkrankungen
Chronische Entzündungserkrankungen des Alters
Kap. 7 Medikamente und Therapien
Immunsuppressive Medikamente
Kortison und kortisonähnliche Medikamente
Calcineurinhemmer
Zellteilungshemmer(Zytostatika)
Monoklonale Antikörper
Infektionsbegünstigende Medikamente wie Protonenpumpenhemmer
Immunsuppressive Therapien
Therapie von Autoimmunerkrankungen
Organtransplantationen
Behandlung von Krebserkrankungen
Allergien und Asthma
Kap. 8 Einwirkungen auf die Infektionsabwehr
Hormone und Stress
Psychosoziale Belastungen im Alter
Jahreszeiten und Geschlecht
Sport, körperliche Aktivität und Übergewicht
Schlaf und zirkadiane Rhythmen
Krankheiten, die das Immunsystem dämpfen
Vorerkrankungen
Kap. 9 Antibiotika, die erlahmende Wunderwaffe
Antibiotika, die Entdeckung einzigartiger Wirkstoffe
Antibiotikaresistenzen
Antibiotikaeinsatz und Altenpflegeeinrichtungen
Kap. 10 Ernährung und Infektionsabwehr
Mangelernährung und Altersanorexie
Nährstoffmangel
Alkohol und Rauchen
Risikolebensmittel
Milch und Milchprodukte
Fleisch und Fleischprodukte
Fisch- und Meerestierprodukte
Roheiprodukte
Gemüse/Obst
Kap. 11 Infektionsvermeidung durch hygienisches Verhalten
Gutes Hygieneverhalten
Händehygiene
Barriere- und Isolierungsmaßnahmen
Haushalts- und Wäschehygiene
Wundschutz
Vermeidung von Lebensmittelerkrankungen
Körperhygiene bei der Speisezubereitung
Einkaufen und Aufbewahren von Lebensmitteln
Zubereitung in der Küche
Küchenwerkzeuge und Reinigung in der Küche
Selbstbedienungseinrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung und Gastronomie und Grillfeste
Vermeidung von Erkrankungen der Atemwege
Das Wichtigste – in Kürze
Literatur – Quellen
Glossar
Einleitung
Unser Immunsystem verändert sich im Alter. Es kann uns nicht mehr so gut vor Viren, Bakterien und anderen Keimen schützen.
Wie kommt es zu dieser Entwicklung?
Was bedeutet das für unser Leben im Alter?
Worauf müssen wir achten?
Kleinkinder leiden an zahlreichen Infektionskrankheiten und Impfungen schützen sie vor den früher gefürchteten Kinderkrankheiten. Das Immunsystem ist noch unreif und die Erregerabwehr unterentwickelt. Im weiteren Leben werden Infektionskrankheiten in der Regel immer seltener, da durch häufige Kontakte mit Erregern ein Immunschutz aufgebaut wird. Ab dem 60. Lebensjahr häufen sich Infektionen wieder und vor allen Dingen können einige Infektionskrankheiten auch zum Tod führen.
Da das Immunsystem nicht mehr angemessen auf Krankheitserreger reagiert, werden Infektionen entsprechend dem Alter zunehmend bedrohlicher. Nicht nur die Häufigkeit, auch der Schweregrad der Erkrankungen und die Sterblichkeit steigen; je älter der Mensch, desto größer das Problem. Bekannte Beispiele: Coronaviren-Infektionen (COVID-19) und Influenzaviren-Erkrankungen (Grippe) schrecken ältere Menschen und bedrohen ihr Leben. Deshalb wird eine jährliche Grippeimpfung ab dem 60. Lebensjahr empfohlen. Dies senkt die Sterblichkeit der Grippeerkrankungen um 25%.
Demenz-, Krebs- und Kreislaufkrankheiten, Diabetes mellitus (Typ II), Osteoporose, Arthrose und Parkinson, diese Krankheiten haben im Alter eine große Bedeutung und sind gefürchtet. Aber die Lungenentzündung (Pneumonie), die fast immer auf eine Infektion zurückgeht, ist bei uns der häufigste Anlass, dass Menschen ins Krankenhaus eingewiesen werden.
Jährlich erkranken allein in Deutschland geschätzt 500.000 Menschen daran. Bakterien wie die Pneumokokken sowie Viren, wie z. B. Corona- oder Influenza-Viren, können eine Lungenentzündung hervorrufen. Treten Bakterien und Viren gemeinsam auf, steigt die Lebensgefahr deutlich an. Eine Lungenentzündung, aber auch eine Wundinfektion können in eine oft tödliche Blutvergiftung (Sepsis) übergehen. Besonders ältere Menschen sind davon betroffen und damit ein großer Teil unserer Bevölkerung.
In unserer Gesellschaft nimmt die Lebenserwartung stetig zu. Während die durchschnittliche Lebenserwartung in den Jahren 1871 bis 1881 bei der Geburt nur etwa 37 Jahre betrug, haben Männer mittlerweile (2020) eine Lebenserwartung von 78 Jahren und Frauen von 83 Jahren.
Die Zahl der Menschen im Alter ab 67 Jahren stieg deshalb in Deutschland deutlich an, zwischen 1990 und 2018 von 10,4 Millionen auf 15,9 Millionen. In den nächsten 20 Jahren werden wahrscheinlich weitere 5 bis 6 Millionen Menschen dieses Alter erreichen. Die Gruppe der Menschen ab 80 Jahren wird bereits bis 2022 auf 6,2 Millionen anwachsen. Damit kommt der Abwandlung des Abwehrsystems im Alter eine große Bedeutung zu.
Wie können wir „gesund“ altern?
Kap. 1 Körperliche Veränderungen im Alter
Die Abwärtsentwicklung der Immunabwehr ist ein Prozess, der schon früh einsetzt und vielfältige Konsequenzen hat. Die Veränderungen des Immunsystems können jedoch nicht isoliert betrachtet werden. Auch andere Systeme und wahrscheinlich die meisten Organe, Gewebe und Zellen des menschlichen Körpers sind einem Alterungsprozess unterworfen und wandeln sich stetig um.
Was das Altern letztendlich verursacht, konnte bisher noch nicht überzeugend dargelegt oder eindeutig geklärt werden. Die Frage, warum wir überhaupt altern, kennt noch keine Antwort.
Ursachen
Als mögliche Ursachen der Alterungsvorgänge werden verschiedene zelluläre und molekulare Prozesse erörtert, deren Bedeutung erst in Ansätzen bekannt ist. Zur Erklärung des Alterungsprozesses werden vor allem folgende körperliche Erscheinungen herangezogen.
Antioxidative Schutzmechanismen
Im Stoffwechsel der Zellen entstehen ständig im Zusammenhang mit Sauerstoffreaktionen der Zellatmung hochreaktive Verbindungen, sogenannte Sauerstoffradikale. Sie schädigen in höheren Konzentrationen wichtige Funktionen und Zellstrukturen (oxidativer Stress). Innerhalb der Zellen existieren deshalb zahlreiche antioxidative Schutzmechanismen, z. B. Enzyme, die eine Anreicherung dieser Stoffe verhindern. Die Wirkung dieser Schutzmechanismen lässt im Alter nach. Ein Beispiel für einen antioxidativen Stoff im menschlichen Körper ist das Vitamin C (Kap. 10).
Zellregeneration
Mit dem Alter nimmt die Fähigkeit der Zellen zur Regeneration ab, wobei sich im Laufe des Lebens immer höhere Zellverluste einstellen. Zellregeneration ist die körpereigene Fähigkeit, irreparable Zellen auszusondern und beschädigtes Gewebe mithilfe von neu produzierten Zellen zu heilen. Dieser Prozess findet über Zellteilungen statt.
Für bestimmte Gewebearten und Organe gibt es dazu die Stammzellen, unbegrenzt teilungsfähige und nicht differenzierte Zellen. Im Alter werden die verbrauchten seneszenten Zellen nicht mehr genügend vom Immunsystem beseitigt. Diese Zellen setzen jedoch Substanzen frei, die Entzündungsreaktionen fördern (senescence-assosiated secretory phenotype). Zu den dadurch ausgelösten Erkrankungen gehören Diabetes Typ 2, Krebserkrankungen und Nierenschwäche.
Telomere
Bei jeder Zellteilung verkürzen sich die Endstücke der Chromosomen, die sogenannten Telomere. Sie enthalten Wiederholungssequenzen des Erbmaterials DNA. Das Enzym Telomerase gleicht in der Zelle die Verkürzung der Enden durch Neusynthese von DNA wieder aus. Im Alter ist die Aktivität dieses Enzyms rückläufig. In den meisten bösartigen Krebsgeschwülsten (maligne Tumore) ist eine hohe Telomerase-Aktivität zu finden, was für ein hohes Wachstumspotenzial der Zellen notwendig zu sein scheint. In den umgebenden gesunden Geweben lässt sich viel weniger aktive Telomerase nachweisen.
Proteinschäden
In älteren Zellen entstehen vermehrt falsch synthetisierte und schadhafte Proteine, die ihre Funktion nicht ausüben können. Fehlerhafte Proteine können ihre normal gefaltete Struktur verlieren. Sie wirken wie ein Kristallisationskeim für andere Eiweiße und so entstehen große Aggregate von Proteinen. Es kann zu massiven Verklumpungen kommen, die in den Zellen Schäden verursachen und zum Zelltod führen können. Dies ist z. B. bei den neurodegenerativen Erkrankungen, wie Alzheimer und Parkinson, der Fall. Aber auch die Alterungsprozesse der Zellen können durch diese Aggregatbildung erklärt werden. Falten sich Proteine um, werden außerdem Bereiche nach außen gestülpt, die normalerweise verhüllt sind und zu gefährlichen Immunreaktionen führen können.
Mutationen
Es kommt im Genom zur Anreicherung von Mutationen, die auch wesentlich bei der Entstehung von Tumoren beteiligt sind. Eine Studie aus dem Jahr 2014 wies beispielsweise nach, dass bei 5 Prozent aller über 70jährigen Studienteilnehmer Mutationen in den Genen ihrer Blutzellen vorhanden waren, die eine Leukämie oder ein Lymphom auslösen können. Die wenigsten der Teilnehmer erkrankten jedoch aufgrund dieser Mutationen; nicht immer führen die im Alter häufigen Genfehler auch zu gesundheitlichen Folgen.
Hormone
Hormonelle Veränderungen wie die Abnahme der Konzentration von Sexualhormonen, Insulin oder Wachstumshormonen führen zur Einbuße von Muskelkraft und Knochendichte sowie zu Veränderungen des Stoffwechsels (Kap. 6). Beispielsweise werden in der Thymusdrüse nicht nur die Abwehrzellen trainiert, sondern auch Hormone produziert, die an der Prägung der Immunzellen beteiligt sind. Schon im Jugendalter beginnt jedoch die Drüse zu verkümmern und kleiner zu werden und die angehäuften Reserven der Immunzellen reichen im Alter nicht mehr aus.
Alterungsprozesse der Körperorgane
Alle Organe des Körpers sind von Alterungsprozessen betroffen, die mit dem Nachlassen der Organfunktionen einhergehen. Nicht immer wirken sich diese Prozesse unmittelbar auf die Leistungsfähigkeit des jeweiligen Organs aus. So hat der Körper zunächst Möglichkeiten, Veränderungen auszugleichen oder abzufangen, bevor sich der Alterungsprozess nach außen hin deutlich manifestiert. Herz und Lunge weisen auch im Alter zumeist eine große Funktionsreserve auf, da die Funktionen von Herz und Lunge normalerweise nicht leistungsbegrenzend sind. Dies ist eher die periphere Muskulatur, die im Alter vom Abbau der Muskelmasse begleitet ist.
Darüber hinaus wirkt sich auch die Lebensweise, vor allem regelmäßige Bewegung und der jeweilige Trainingszustand, auf die Funktionsfähigkeit der Organe aus.
Die altersbedingten körperlichen Veränderungen treffen in hohem Maße das Immunsystem, was als Immunoseneszenz bezeichnet wird. Davon abgesehen können weitere Organveränderungen im Alter dazu führen, dass Infektionen gehäuft auftreten oder einen schwereren Verlauf haben.
• Herz und Gefäße
Die bei älteren Menschen häufige Arteriosklerose, die „Verkalkung“ der Blutgefäße, ist eine weit verbreitete Grunderkrankung, die u. a. zu einem Herzinfarkt führen kann. Neben der Einlagerung von Fetten, wie z. B. Cholesterin, kommt es in der Gefäßwand auch zu Änderungen in der Muskulatur, die den Gefäßen die richtige Spannung verleiht. Besonders strukturelle Schädigungen an den glatten Gefäßmuskelzellen sind eine wichtige Ursache für die Arteriosklerose. Die Auswirkungen auf das Herz bringen eine verminderte körperlicher Belastbarkeit mit, die bei Infektionen im Alter von großem Nachteil sein kann.
• Lunge
Auch die allgemeinen Lungenfunktionen nehmen bei fortschreitendem Alter stetig ab. Die Zahl der Lungenbläschen, der Alveolen, und die der kleinen Blutgefäße geht zurück, und die Menge an elastischen Fasern nimmt ab. Als Folge kann sich die Lunge nicht mehr so gut ausdehnen und zusammenziehen. Der Gasaustausch ist behindert und es kommt zur Abnahme der maximalen Ventilationsleistung. Darüber hinaus sind die Abwehrmechanismen der Lunge wie die mukoziliäre Clearance (Kap. 5) verschlechtert.
Die Gefahr einer Aspiration (Eindringen von Stoffen, z. B. durch Erbrechen, in die Luftröhre und den unteren Atemtrakt) ist aufgrund des abgeschwächten Hustenreflexes alter Menschen erhöht. Dies erleichtert die Entstehung von Infektionen und Lungenentzündungen.
• Leber und Niere
Die altersbedingten Veränderungen der Leber und der Nieren sind zwar für das Infektionsrisiko unwesentlich, sie müssen aber bei medikamentösen Behandlungen von Infektionen berücksichtigt werden.
Die Leber produziert nicht nur viele wichtige Eiweiße wie z. B. die Gerinnungsfaktoren sowie das C-reaktive Protein (CRP), das eine wichtige Rolle bei Entzündungen im Körper spielt. Die Leber bildet außerdem Enzyme, die zum Abbau von Medikamenten und giftigen Substanzen essentiell sind. Die Fähigkeit der Leber, gewisse Substanzen abzubauen, nimmt mit dem Älterwerden ab. So werden manche Arzneimittel bei älteren Personen nicht mehr so schnell inaktiviert wie bei Jüngeren. Daher muss die Dosierung von Arzneimitteln bei älteren Personen oft gesenkt werden.
Wasserlösliche Abbauprodukte der Medikamente werden von der Leber ins Blut abgegeben. Sie gelangen mit dem Blutstrom zu den Nieren und werden über den Urin aus dem Körper ausgeschieden. Mit voranschreitendem Alter verlieren die Nieren an Gewicht und die Nierenfunktion wird allmählich geringer. Schon nach dem 40. Lebensjahr nimmt bei den meisten Menschen die Rate ab, mit der die Nieren das Blut filtern. Damit sinkt die Fähigkeit der Nieren, Stoffwechselabbauprodukte und zahlreiche Medikamente zügig auszuscheiden.
Erschwerend kommt hinzu, dass Personen, die über 65 Jahre alt sind, im Durchschnitt fünfmal so viele Medikamente wie jüngere Menschen einnehmen. Die geringere Stoffwechselaktivität der Leber und die Funktionseinschränkung der Nieren müssen unbedingt bei der Gabe von Medikamenten beachtet werden.
Organschädigungen durch Corona- und Grippeviren
Die Organveränderungen im Alter können dazu führen, dass Infektionen, die diese Organe betreffen, schwerwiegender ausfallen. Auf der anderen Seite können auch Infektionskrankheiten und deren Therapie Körperorgane langfristig und hochgradig schädigen. Besonders Viren wie Influenzaviren und SARS-CoV-2-Viren sind dafür bekannt, dass sie sich des Öfteren nicht auf ihr primäres Zielorgan, die Atemwege, beschränken, sondern sich im ganzen Körper ausbreiten.
Insbesondere die Erreger von COVID-19 (Kap. 4) können Organe wie die Lunge, die Nieren, das Herz, das zentrale Nervensystem und die Gefäße angreifen und Spätfolgen hervorrufen. Obgleich sich die allermeisten Genesenen auch vollständig erholen, kann es in einigen Fällen zu bleibenden Organschäden kommen. Folgeschäden werden allerdings manchmal auch bei Menschen beobachtet, die nicht schwer an COVID-19 erkrankt waren.
Bei heftigen Verläufen der COVID-19-Infektionen (Kap. 4) treten öfters Lungenschädigungen als Komplikation auf und einige Erkrankte haben als Spätfolge eine verringerte Lungenfunktion. Die Folgen der Organschädigung können Atemstörungen, Atemnot und Reizhusten sein und die körperliche Leistungsfähigkeit nimmt ab.
Strittig ist, ob die Schädigungen der Lunge mehr durch die invasive Beatmung verursacht werden, direkt durch das SARS-CoV-2-Virus entstehen oder auch durch überschießende Reaktionen des Immunsystems verursacht werden.
Nach dem Atemtrakt können vor allem auch die Nieren von den Viren lädiert werden. So kommt es zu einer relativ hohen Rate an akuten Nierenversagen bei COVID-19-Infektionen. In den allermeisten Fällen erholt sich die Niere und kann ihre Funktion wieder aufnehmen. Es besteht auch die Möglichkeit, dass die Coronaviren oder – was wahrscheinlicher ist - die von der Infektion ausgelösten Immunreaktionen eine Schädigung des Herzens bewirken.
Die Grippeerreger, die Influenzaviren (Kap. 4), befallen ebenfalls gelegentlich wichtige Körperorgane. Auf häufigsten wird die Lunge geschädigt und Lungenentzündungen treten auf. Menschen mit chronischen Lungenleiden müssen nach einer Grippe mit einer Verschlimmerung ihrer Krankheit rechnen. Prinzipiell können Influenzaviren aber jedes Organ im menschlichen Körper angreifen und schädigen. So werden Übergriffe der Viren auf das Herz-Kreislauf-System, den Magen-Darmtrakt und das zentrale Nervensystem beobachtet.
Greift die Infektion auf das Herz über, entwickelt sich bisweilen eine Herzmuskelentzündung. Auch Herzrhythmusstörungen sowie eine Herzschwäche (Herzinsuffizienz) mit verminderter Pumpleistung können zu den Folgen einer Influenza gehören. Aufgrund der Herzschwäche kann es zu einem Lungenödem kommen, einer Ansammlung von Flüssigkeit in der Lunge.
Auch eine Entzündung des Gehirns (Enzephalitis) oder eine Hirnhautentzündung (Meningitis) kann als Folge einer Influenza auftreten. Grippeinfektionen stehen zudem im Verdacht, neurologische Erkrankungen wie die Alzheimer-Krankheit und Depressionen zu fördern, wenn nicht sogar auszulösen.
Die Skelettmuskulatur kann ebenfalls bei einer Grippeinfektion geschädigt werden. Die möglichen Auswirkungen sind eine Entzündung (Myositis) oder ein Zerfall der Muskelfasern (Rhabdomyolyse).
Kap. 2 Infektionen
Vor dem Ausbruch der Coronavirus-Infektion COVID-19 in Europa war hierzulande nur wenigen Menschen bewusst, dass Infektionskrankheiten die größte Bedrohung der menschlichen Gesundheit darstellen. Genau dies belegten allerdings die Statistiken der Weltgesundheitsorganisation WHO schon seit Jahren. Allein fünf der häufigsten Todesursachen weltweit beruhen immer noch auf Infektionserkrankungen:
Infektionen der Atemwege, z. B. Influenza und COVID-19
Durchfallerkrankungen, hervorgerufen durch mit Keimen verunreinigte Lebensmittel oder verseuchtes Wasser
die Immunschwächekrankheit AIDS (
Acquired Immune Deficiency Syndrome
)
Tuberkulose (früher Schwindsucht genannt, kurz Tb oder Tbc)
Infektionen von Neugeborenen
An der Erkrankung AIDS, die auf der Infektion mit Humanen Immundefizienz-Viren (HIV) beruht, sowie an Tuberkulose und Malaria sterben jedes Jahr fast fünf Millionen Menschen. Weltweit starben 2019 etwa 2 Millionen Neugeborene an Infektionen und 1,5 Millionen an Durchfallerkrankungen.
Im Jahr 2020 gab es weltweit 1,8 Millionen Tote, die den Coronaviren (COVID-19) zugerechnet werden, und jedes Jahr sterben nach Schätzungen eines internationalen Forschernetzwerks zwischen 300.000 und 650.000 Menschen infolge einer Influenza-Infektion.
Diese erschreckend hohen Zahlen relativieren sich allerdings, wenn die momentan (2020) aktuelle Gesamtweltbevölkerung von 7,8 Milliarden zugrunde gelegt wird. Dann entsprechen 1,8 Millionen Corona-Tote gerade einmal 0,023 Prozent der Weltbevölkerung. Da auf der Erde insgesamt jährlich ca. 50 bis 60 Mio. Menschen sterben, ist der Anteil der Menschen, die 2020 an oder mit den Coronaviren gestorben sind, etwa 3 Prozent groß.
Auch in Deutschland und anderen westlichen Ländern sind viele Infektionskrankheiten in keiner Weise überwunden, selbst wenn einige nach der Entdeckung der Antibiotika ihren Schrecken verloren haben. In Deutschland sterben laut Statistischem Bundesamt jährlich ca. 22.000 Menschen allein an Lungenentzündungen.
Infektionen, die im Krankenhaus erworben werden (nosokomiale Infektionen), sind besonders gefährlich, da sie oft von multiresistenten Erregern (Kap. 9) hervorgerufen werden. Diese Krankenhaus-Infektionen kosten in Deutschland wahrscheinlich bis zu 20.000 Menschen das Leben, wie das Bundesministerium für Bildung und Forschung angibt.
In den letzten Jahrzehnten, seit dem Siegeszug der Antibiotika, wurden Infektionskrankheiten als behandelbar und vernachlässigbar angesehen. Jedoch wird die Therapie mit Antibiotika aufgrund der Bildung von Resistenzen immer schwieriger und neue Bedrohungen wie die Erreger der COVID-19-Infektion tauchen auf. Besser ist es, wenn es gar nicht erst zu einer Infektionserkrankung kommt. Der Prävention von Infektionen kommt sowohl bei jungen Menschen, aber besonders bei Senioren eine immer größere Rolle zu.
In großen Teilen der Bevölkerung ist das Wissen nicht vorhanden, wie es zu Infektionen kommt, welche Erreger es gibt, wie die Ansteckungswege verlaufen, welche Lebensmittel ein hohes Infektionsrisiko darstellen und wie man sich durch hygienische Maßnahmen schützen kann. Hierzu müssen verstärkt Kenntnisse vermittelt werden.
Was ist eine Infektion?
Was ist eigentlich eine Infektion? Unter einer Infektion versteht man das Eindringen von krankheitserregenden Mikroorganismen in den Körper, die Ansiedlung und die Vermehrung der Keime, die zu nachfolgenden Abwehrreaktionen des Körpers führen.
Eine Infektion muss nicht immer eine Erkrankung nach sich ziehen; sie kann symptomlos (asymptomatisch) verlaufen. Erst wenn körperliche Veränderungen sowie fühlbare Beschwerden auftreten, liegt eine Infektionskrankheit vor.
Abb. 1 Grundsätzlicher Verlauf einer Infektion
Das Infektions-Schutz-Gesetz (IfSG) definiert eine Infektion als „die Aufnahme eines Krankheitserregers und seine nachfolgende Entwicklung oder Vermehrung im menschlichen Organismus“. Bei dem Coronavirus SARS-CoV-2 wird mit einem molekularbiologischen Test festgestellt, ob wahrscheinlich eine Infektion vorliegt. Zur Analyse der Probe wird das Verfahren der Polymerase-Kettenreaktion (PCR) eingesetzt. Damit kann ein Teil des Erbmaterials der Viren im Labor so stark vervielfältigt werden, dass es als ein virusspezifisches Molekül nachgewiesen werden kann, auch wenn die Viren in der Probe nur in geringen Mengen vorliegen.
Allerdings kann solch ein Test nur die Anwesenheit des viralen Erbmaterials oder von Bruchstücken aufzeigen. Er kann nicht direkt nachweisen, dass die Vermehrung oder Entwicklung des Virus stattfindet, eigentlich nach der Definition des IfSG die notwendige Voraussetzung zum Nachweis einer Infektion.
Ein wichtiges Kennzeichen von Infektionen ist die Ansteckungsfähigkeit. Dies bezeichnet den Zustand des infizierten Menschen, bei dem Erreger aktiv oder passiv nach außen gestreut werden. Die Ansteckungsfähigkeit ist typischerweise von Infektion zu Infektion sehr unterschiedlich. Sie kann gering oder hoch sein, ist abhängig von der Körperregion, in der sich die Mikroorganismen vermehren, und zeitweilig unabhängig davon, ob Krankheitssymptome vorliegen.
Krankheitsauslösende Mikroorganismen sind pathogen, d. h. sie haben grundsätzlich die Fähigkeit, den Organismus, in den sie eindringen, zu schädigen. Nur einige der auf der Erde vorhandenen Mikroorganismen besitzen diese Fähigkeit. Sie können in den Körper des Menschen (oder anderer Lebewesen) eindringen, sich dort lokal, d. h. an einem bestimmten Ort, oder systemisch, also im gesamten Körpersystem, vermehren und den Körper schädigen.
Die allermeisten Mikroorganismen können uns nicht krankmachen, da dazu genetisch verankerte Programme (Gene) gehören, die nicht in ihrem Erbgut enthalten sind. Diese Gene der Pathogenen beinhalten die Informationen zur Bildung sogenannter Virulenzfaktoren. Dies sind meist Proteine, die dem Erreger die Fähigkeiten verleihen, sich in Geweben des Wirts zu vermehren und im Körper auszubreiten. Einige der Proteine richten sich speziell gegen Komponenten des Immunsystems. Das Zusammenspiel der Virulenzfaktoren macht die Stärke der krankmachenden Wirkung aus, die Virulenz des Erregers.
Die Aufnahme geringer Mengen an Erregern in den Körper, beispielsweise über das Essen, muss nicht zur Ausbildung sichtbarer Krankheitszeichen führen. Erst eine gewisse Anzahl führt zur Infektion und zur Erkrankung. Die Anzahl an Keimen, die mindestens notwendig ist, um nach Aufnahme eine bestimmte Infektion auszulösen, wird minimale Infektionsdosis genannt. Diese Dosis schwankt von Erreger zu Erreger und hängt außerdem von Faktoren des Wirts ab, wie z. B. dem abtötenden Einfluss der Magensäure auf Keime in der Nahrung.
Damit eine Infektionskrankheit im Körper entsteht, müssen die Erreger die Abwehrbollwerke durchbrechen, insbesondere das zweigleisige Immunsystem (Kap. 5). Das Abwehrsystem wird von zahlreichen inneren Faktoren wie z. B. Hormonen reguliert und kann beispielsweise durch Lebensweise (Kap. 8) und Ernährung (Kap. 10) beeinflusst werden.
Epidemien und Pandemien
Das Auftreten von Infektionen durch bestimmte Erreger kann zu Epidemien führen, die oft auch Seuchen genannt werden. Von einer Epidemie spricht man, wenn eine Infektionskrankheit in einer Region zu einer bestimmten Zeit gehäuft ausbricht, das weltweite Auftreten wird als Pandemie bezeichnet. Diese Ereignisse geschehen, wenn die Erreger schnell von Mensch zu Mensch übergehen können.
Weltweit epidemisch oder pandemisch auftretende Krankheiten waren oder sind Cholera, Typhus, Pest, Kinderlähmung sowie die Grippe (Influenza). In jüngster Zeit haben die Coronaviren SARS-CoV-2 zu einer weltweiten Ausbreitung geführt.
Epidemien entstehen zumeist aus zwei Gründen. Neue, dem menschlichen Körper unbekannte Infektionserreger tauchen auf, z. B. wenn Bakterien oder Viren den Wirt wechseln und von einem Tier, dass sie normalerweise besiedeln, auf den Menschen überspringen.
Mutationen, also Veränderungen der genetischen Informationen der Mikroorganismen, sind dazu zwangsläufig notwendig, da die Erreger im neuen Wirt mit anderen zellulären Eigenschaften und Abwehrfaktoren konfrontiert werden. Die veränderten Erreger müssen nicht nur an den neuen Wirt z. B. den Menschen gut angepasst sein, sie müssen auch leicht auf neue Individuen überspringen und sie infizieren können.
Im zweiten Fall haben sich die Krankheitserreger in ihren Oberflächenmerkmalen geändert, wie das Jahr für Jahr bei den Grippeviren der Fall ist. Schon kleine Veränderungen im Erbmaterial können bewirken, dass die Erreger vom Abwehrsystem des Körpers, z. B. von den Antikörpern, nicht mehr richtig erkannt werden. Die Immunabwehr gegen solche Krankheitserreger fällt nur schwach aus, sodass es zu einer Erkrankung kommt, obgleich eine Infektion durch diese Viren schon einmal stattgefunden hat.
Fast jährlich treten in den Wintermonaten in Deutschland Grippe-Epidemien auf. Sie entstehen, da sich die Influenzaviren des Menschen in seinen Erkennungsmerkmalen ständig verändern. Bei den alljährlich auftretenden Influenza-Epidemien können sich bis zu 20 Prozent der Bevölkerung mit Grippeviren infizieren.
Diese Ereignisse sind fast immer mit einem deutlichen Anstieg an Todesfällen verbunden. Jährlich werden in Deutschland ca. 7.000 bis 15.000 Sterbefälle auf Influenza oder ihre Komplikationen zurückgeführt. Dies sind etwa doppelt so viele wie die Personen, die bei uns im Straßenverkehr tödlich verunglücken. Es gibt außerdem in einige Tieren wie den Vögeln und den Schweinen Influenzaviren, denen gelegentlich der Übertritt in eine neue Spezies, den Menschen, gelingt. Dabei kann ein besonders gefährliches Erkrankungspotenzial entstehen.
Viele Infektionskrankheiten wie Cholera, Typhus, Pest oder Kinderlähmung, die früher zu Epidemien und Pandemien geführt haben, haben jedoch bei uns ihren Schrecken verloren. Dazu war es wichtig, die Auslöser der Infektionen, die Mikroorganismen, kennen zu lernen und wirkungsvolle Abwehrmaßnahmen zu etablieren. Generell können vier biologische Gruppen der Mikroorganismen unterschieden werden, die eine großer Bedeutung für die menschliche Gesundheit haben.
Bakterien und Viren spielen eine herausragende Rolle als Verursacher von Infektionskrankheiten (Kap. 3). Daneben können auch Pilze und Protozoen (tierische Einzeller) Auslöser solcher Erkrankungen sein. Infektionen durch Pilze werden fast nur bei Menschen mit stark eingeschränktem Immunsystem beobachtet. Protozoen werden in tropischen und warmen Ländern oft durch Insektenbisse oder -stiche übertragen. Hierzulande können einige pathogene Protozoen über Nahrungsmittel und Trinkwasser auf den Menschen gelangen und ihn krank machen.
Vor allem drei Prozesse haben in der Neuzeit zu einem Sieg über die klassischen Infektionskrankheiten geführt:
Gute Hygiene bei Trinkwasser und Lebensmitteln, sowie in anderen Bereichen
Impfungen zur Aktivierung des Immunsystems
Antibiotika zur Bekämpfung von bakteriellen Erregern
In Ländern mit schlechten hygienischen Verhältnissen und eingeschränktem Zugang zu sauberem Trinkwasser fordern Infektionen des Magen-Darm-Traktes immer noch zahlreiche Menschenleben. Darüber hinaus sind einige Tropenkrankheiten wie z. B. Malaria auch heutzutage noch weit verbreitet, für die Insekten als Überträger und Protozoen als Krankheitserreger verantwortlich sind.
In der heutigen Zeit sind viele früher gefürchtete Infektionskrankheiten zumindest in den Industriestaaten gebannt oder wie im Falle der Pockenviren sogar ausgelöscht. Die erfolgreiche Ausrottung der Pocken durch weitreichende Impfungen wurde am 8.5.1980 durch die Weltgesundheitsorganisation WHO verkündet. Dies führte zu Voraussagen einiger Infektionsforscher, dass mit der Ausrottung weiterer Seuchen und letztlich mit dem Ende der Infektionskrankheiten insgesamt zu rechnen sei.
Weit gefehlt! Die Ausrottung der Pocken war eher nur ein besonderer Glücksfall, der auf günstige Umstände beruhte. Denn das Pockenvirus tritt im Gegensatz zu zahlreichen anderen Krankheitserregern ausschließlich bei Menschen auf. Die Erkrankung hinterlässt einen lebenslangen Schutz, die sogenannte Immunität, und auch die Impfung ist hochwirksam. All dies ist bei vielen anderen Erregern nicht der Fall.
Infektionskrankheiten müssen auch in Zukunft sehr ernst genommen werden. In Zeiten von Globalisierung und Massentourismus wächst beispielsweise die Gefahr der Einschleppung von gefährlichen Krankheitserregern durch Geschäftsreisende und Touristen.
Die Coronaviren-Pandemie im Jahr 2020 zeigt, dass sich Erreger jederzeit so stark verändern können, dass die Bevölkerung keinen Immunschutz besitzt und dass innerhalb weniger Tage die Erreger per Flugzeug in die gesamte Welt reisen können.
Grundsätzlich sind Krankheitserreger, besonders Viren und Bakterien, in ihrer genetischen Ausstattung und in ihren Eigenschaften höchst flexibel. Die Evolution zwingt sie, sich ständig zu verändern und an neue Umweltbedingungen anzupassen. So werden auch in Zukunft ständig neue Erreger auftreten, die uns und unser Immunsystem herausfordern werden.
Es gibt nur Etappensiege, die Mikroorganismen lassen sich wohl nie vollständig und endgültig bezwingen. Schon Louis Pasteur, der große französische Pionier der Mikrobiologie prophezeite: „Die Mikroorganismen werden immer das letzte Wort haben.“
Eintrittspforten und Übertragungswege
Den Krankheitserregern stehen unterschiedliche Wege offen, von den Erregerreservoiren, in denen sie sich vor der Infektion befinden, in den menschlichen Körper zu gelangen. Je nach der Herkunft der Erreger wird zwischen endogener und exogener Infektion unterschieden.
Bei einer endogenen Infektion stammen die Mikroorganismen aus der körpereigenen Bakterienflora und nutzen eine Schwächung des Immunsystems aus. Solche Keime, Opportunisten genannt, können eine Person mit intakter Immunabwehr nicht behelligen. Jedoch bei Versagen oder einer eklatanten Schwäche des Immunsystems rufen sie eine Entzündung oder andere Erkrankung hervor.
Bei einer exogenen Infektion kommen die Krankheitserreger aus der Umwelt, von anderen Menschen, von Tieren oder von kontaminierten Gegenständen, auf denen sich krankheitserregende Keime aufhalten. Es handelt sich zumeist, aber nicht immer, um obligate, also zwingend krankmachende Krankheitserreger, die auch Menschen mit intaktem Immunsystem erfolgreich infizieren können.
Wie ansteckend ein Erreger ist, hängt von dem Weg bzw. dem Mechanismus der Übertragung ab. Die pathogenen Keime gelangen über bestimmte Stellen in das Innere des Körpers, die Eintrittsorte der Keime (Abb. 2). Diese sogenannten Eintrittspforten gehören entweder zu den Schleimhäuten des Körpers oder sind Störungen der intakten Hautstruktur. Von den Eintrittspforten aus erreichen die Erreger leicht weitere Gewebe oder Organe des Körpers.
Abb. 2 Eintrittspforten in den Körper für Infektionserreger
Pathogene Erreger von Durchfallerkrankungen können über den Darm in den Organismus eindringen. Der gesamte Verdauungstrakt, vom Mund bis zum Dickdarm, wird als eine Körperhöhle betrachtet, die nicht zum „eigentlichen“ Körper gehört. Der Trakt stellt wie die Atemwege eigentlich Außenwelt dar und ist von Keimen der Umwelt leicht zu erreichen.
Einigen Pathogenen wie z. B. Cholerabakterien reicht es, in den Darm einzudringen; sie bilden dort Toxine, also Gifte, die das Darmgewebe schädigen und heftigen Durchfall verursachen. Andere Bakterien dringen in die Darmzellen ein und bewegen sich von dort weiter, teils aktiv, teil passiv z. B. innerhalb von im Körper zirkulierenden Immunzellen. Eintrittsstellen für viele Erreger sind außerdem die Atemwege, Geschlechtsorgane, Wunden in Haut und Schleimhäuten sowie Stiche und Bisse von Tieren. Aufgrund der Eintrittspforten der Keime, ihren Zielgeweben und der Art und Weise, wie sie an den Körper herankommen, besitzen Krankheitserreger unterschiedliche Übertragungswege:
1. Direkte Kontaktinfektion
Bei der direkten Kontaktinfektion werden die Erreger durch Körperberührung, wie z. B. beim Händeschütteln, übertragen. Durch Handschuhe, Händewaschen oder Handdesinfektion kann das Risiko der Erregerübertragung reduziert werden (Kap. 11). Lippenherpes entsteht beispielsweise bei direktem Kontakt mit Herpes simplex-Viren. Eintrittspforten sind hier in der Regel kleine Verletzungen in der Haut oder in der Schleimhaut.
Durch direkten Kontakt können zahlreiche Erreger übertragen werden, auch wenn dieser Weg oft nicht die größte Bedeutung hat und andere Infektionswege vorwiegen. Bei der Übertragung von Krankheitserregern über ein Transportmittel wie ein Lebensmittel, Wasser oder über kontaminierte Gegenstände spricht man von einer indirekten Infektion.
2. Schmierinfektion, fäkal-orale Übertragung
Eine Schmierinfektion ist eine indirekte Kontaktinfektion. Sie kann erfolgen, wenn ein Gegenstand angefasst wird, der mit infektiösem Material verunreinigt ist. Anschließend gelangen die Erreger über Eintrittspforten meist der Schleimhäute in den Körper. Schmierinfektionen geschehen häufig über den fäkal-oralen Weg, wenn fäkal, d. h. mit dem Darminhalt ausgeschiedene Erreger, oral, d. h. mit dem Mund, aufgenommen werden. Die Aufnahme erfolgt oft beim Nahrungsverzehr.
Neben Kot können andere Körperflüssigkeiten, wie der keimreiche Eiter infizierter Wunden, zu einer Schmierinfektion führen. Viele Bakterien wie Salmonellen und einige Viren wie Polio- und Hepatitis-A-Viren sind in der Lage, diesen Infektionsweg einzuschlagen. Dazu müssen die Erreger relativ robust sein, um längere Zeit außerhalb des Körpers überleben zu können.
3. Tröpfchen- und Aerosolinfektion (aerogene Übertragung)
Krankheiten wie Windpocken oder Masern sind Infektionen, die durch Aerosole sogar über eine große Entfernung luftgetragen verbreitet werden. Nicht nur Viren werden durch Flüssigkeitspartikel übertragen. Die bakterielle Erkrankungen Tuberkulose und Keuchhusten werden durch keimhaltige Hustentröpfchen in der Luft verbreitet. Fast alle Erreger im Luftraum sind dort empfindlich gegenüber Austrocknung und UV-Strahlung und nach einiger Zeit nicht mehr infektionsfähig. Dies ist von der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit abhängig, im Sommer ist das Infektionsrisiko deshalb im Allgemeinen geringer.
4. Übertragung durch Blut und andere Körperflüssigkeiten
Zahlreiche Keime wie die AIDS verursachenden Viren, sowie Hepatitis-Bund -C-Viren befinden sich im Blut oder in Blutzellen und sterben in anderen Medien schnell ab. Sie werden deshalb über die Körperflüssigkeiten als Überträgermedium direkt von Mensch zu Mensch übertragen. Solche Körperflüssigkeiten können je nach Erreger Blut, Sperma, Speichel, Schweiß oder Muttermilch sein. Sollte die Aufnahme dieser Sekrete zu einer Infektion führen, müssen die Krankheitserreger in genügend hoher Konzentration in den jeweiligen Flüssigkeiten vorhanden sein.
Die Eintrittspforten für die Mikroben sind meist kleine Wunden oder kaum sichtbare Einrisse der Schleimhäute.
5. Übertragung durch Zecken, Insekten und andere Tiere
Viele Krankheitserreger gelangen mit Hilfe von Tieren in den Körper des Menschen; die Tiere dienen als Vektoren (Träger). Verschiedene Insekten und Zecken durchstechen oder durchbohren die menschliche Haut, um Blut zu saugen, wobei Keime ins Blutsystem gelangen können. In Deutschland werden beispielsweise durch Stiche bzw. Bisse von Zecken Krankheiten wie FSME und Borreliose übertragen.
Die Erreger zahlreicher wichtiger Tropenkrankheiten werden durch Insekten übertragen. So wird Malaria durch die Anopheles-Mücke, die Protozoenkrankheit Leishmaniose durch Sandmücken, die Schlafkrankheit durch Tsetse-Fliegen und die Chagas-Krankeit durch Wanzen verbreitet. Das Zikavirus, das bei einer Infektion von Schwangeren auf das Kind übergehen und dieses schwer schädigen kann, wird hauptsächlich durch den Stich infizierter Stechmücken übertragen. Darüber hinaus können Tollwutviren zum Menschen gelangen, wenn sie von tollwutinfizierten Säugetieren gebissen werden.
Eine große Anzahl der in Deutschland auftretenden Infektionskrankheiten wird durch Lebensmittel übertragen. Als Auslöser spielen Viren wie Noro- und Rotaviren, Bakterien wie Campylobacter, Salmonellen und Listerien sowie einige Protozoen wie Giardien (Lamblien) und Kryptosporidien eine Rolle. Die Lebensmittelinfektionen führen zum großen Teil zu Durchfallerkrankungen.
Einige der über den Darmtrakt in den Körper eindringenden Bakterien und Viren können allerdings den Darmbereich verlassen und im restlichen Körper sich ansiedeln und zu sehr schwerwiegenden systemischen Erkrankungen wie die Listeriose oder Hepatitis führen. Hier können vor allem Verbesserungen der Küchen- und Lebensmittelhygiene ein wirksamer Infektionsschutz sein (Kap. 11).
Tiere und Zoonosen
Tiere spielen bei Infektionen nicht nur als Vektoren für zahlreiche Krankheitserreger eine große Rolle, sondern auch als sogenannte Reservoire. Darunter versteht man Tiere, bei denen sich die für Menschen gefährlichen Mikroorganismen vermehren können, oftmals im Darmtrakt und oft, ohne diese selber krank zu machen.
Natürlich ist nicht nur der Darm von Menschen von unzähligen Mikrobenarten dicht besiedelt. Dies ist auch für Säugetiere, Vögel, Reptilien und alle anderen Tiere, die einen Verdauungstrakt besitzen, der Fall. Einige der Bakterien sind nur bei einigen oder sogar einer einzigen Tierart zu finden, andere wie z. B. die Salmonellen und die bekannten E. coli-Bakterien finden sich fast überall. Gerade Keime, die sich im Laufe der Evolution an die Bedingungen von Säugetieren und Vögeln, wie z. B. die hohe konstante Körpertemperatur, angepasst haben, können eventuell beim Übergang auf den Menschen diesen schädigen.
Nicht nur viele Bakterien können leicht ihre Wirtsspezies austauschen, auch zahlreiche Viren sind dafür bekannt. Die Coronaviren, die COVID-19 verursachen, haben wahrscheinlich ihren Ursprung in Wildtieren wie z. B. Fledermäusen. Einige Wissenschaftler gehen davon aus, dass SARS-CoV-2 von einer Fledermaus wie der Hufeisennase über ein weiteres Tier als Zwischenwirt auf den Menschen übertragen wurde. Molekularbiologische Untersuchungen zeigen, dass die neuartigen Coronaviren eng verwandt mit Viren sind, die in Fledermäusen vorkommen; die DNA-Sequenzen der Virusgenome stimmen zum großen Teil überein.
Beim Verzehr von Fleisch und Fleischprodukten ist folglich immer Vorsicht geboten. Zahlreiche durch Lebensmittel verursachte Infektionen stammen von Erregern, die in oder an unseren Nutztieren leben. In der Regel geraten die gefährlichen Keime auf das Fleisch, wenn es beim oder nach dem Schlachten mit Darminhalten verunreinigt (kontaminiert) wird. Aber auch pflanzliche Lebensmittel können mit Darmbakterien bzw. Fäkalkeimen kontaminiert sein.
Bei der Bearbeitung in den Betrieben oder schon auf dem Feld, z. B. bei der Düngung mit Gülle, können die Keime die Pflanzen verunreinigen und sogar besiedeln.
Infektionskrankheiten, die von einem Tier auf den Menschen übertragen werden, sei es über den Verzehr von Lebensmitteln, über Vektoren oder durch direkten Kontakt im Streichelzoo, werden Zoonosen genannt. Durchaus ist auch der umgekehrte Weg möglich, vom Menschen auf das Tier.
Zu den bekannten Zoonosen zählen Tollwut, Borreliose, Salmonellose und Malaria. Campylobacter ist ein bei Nutztieren häufig vorhandenes Bakterium, das oft auf den Menschen übertragen wird und dort Erkrankungen hervorruft. Influenzaviren, die Grippeerreger, sind dafür bekannt, dass sie in Tierpopulationen zirkulieren und nach einer Anpassungsphase (Adaptation) auf den Menschen übergehen können. Die Bezeichnungen Vogelgrippe und Schweinegrippe verraten die Reservoire dieser Viren.
Die Pest ist eigentlich eine Infektionskrankheit bei Tieren. Der Erreger Yersinia pestis befällt Nagetiere wie Mäuse und Ratten sowie andere Säugetiere. Eher in Ausnahmefällen wird der Pesterreger auf den Menschen übertragen. In der Regel sind es dann Flöhe als Vektoren, die die gefährlichen Bakterien in die Blutbahn des Menschen übertragen. Das Bakterium kann allerdings bei engem Kontakt der Menschen auch über Tröpfchen in der Luft weitergegeben werden; so kann schnell eine Epidemie ausbrechen. Die Pesterreger sind an ihren eigentlichen Wirt, die Nager, angepasst. Sie schädigen ihn nicht so stark, dass er stirbt, denn in einem toten Körper sind sie auch zum Untergang verurteilt. In anderen Tieren oder dem Menschen greifen diese Anpassungsmechanismen nicht.
Die Infektion durch die Pesterreger hatte in den Zeiten, als Antibiotika noch nicht bekannt waren, meist einen tödlichen Ausgang. Pestepidemien haben Millionen Menschen dahingerafft und große Bevölkerungsteile ausgelöscht. Während der Epidemien starben aber nicht alle Betroffenen, einige wurden gar nicht krank, was wahrscheinlich in ihrer Genausstattung begründet war.
Folgte einige Jahre später eine zweite Infektionswelle, wurden viele Menschen nicht mehr krank, sie waren immun, ihr Immunsystem hatte sich auf die Erreger eingestellt.
Krankheitserreger, Meldepflicht und Dunkelziffer
Die Vermeidung von Infektionen ist besser, als darauf zu vertrauen, dass der Körper mit seiner Immunabwehr es schon hinbekommt, die Krankheitserreger erfolgreich zu bekämpfen. Durch Maßnahmen hygienischer Art kann das Risiko gesenkt werden, sich überhaupt zu infizieren. Hierzu ist es wichtig zu wissen, welche Krankheitserreger hierzulande verbreitet sind, da sich diese beispielsweise durch die Art der Übertragung auf den Menschen unterscheiden. Es stellt sich die Frage, welche Erreger bzw. Infektionskrankheiten bei uns in der heutigen Zeit eine dominierende Rolle spielen.
In Deutschland sind akute, insbesondere ansteckende Infektionen meldepflichtig. Das Infektions-Schutzgesetz legt fest, dass Meldungen über Infektionskrankheiten und Krankheitserreger vom Robert Koch-Institut erfasst werden, der zentralen Einrichtung auf dem Gebiet der Krankheitsüberwachung und -prävention. Wesentlich dafür ist eine Meldepflicht der Labore für den mikrobiologischen oder molekulargenetischen Nachweis von insgesamt fast 50 verschiedenen Krankheitserregern. Darüber hinaus müssen einige eher seltene Infektionskrankheiten wie Masern, Pest und Typhus vom behandelnden Arzt gemeldet werde, dies sogar schon beim Verdacht. Die Meldepflicht dient zur Überwachung der Infektionskrankheiten, um das Auftreten von Infektionsgefahren zu erkennen und ihre Ausbreitung einzudämmen.
Von den Erregern, die gemeldet werden müssen, sind einige Jahr für Jahr sehr selten oder werden gar nicht nachgewiesen; sie stellen deshalb keine große Gefahr dar. So wurden im Jahr 2018 in Deutschland weder Erreger der Tollwut noch Cholera-verursachende Bakterien nachgewiesen.
Andere Infektionserreger sind sehr häufig und deshalb von großem öffentlichen Interesse. Jährlich werden circa 200.000 Erkrankungsfälle gemeldet, die mutmaßlich über Lebensmittel übertragen worden sind. Die dem Robert Koch-Institut von den Gesundheitsämtern gemeldeten Zahlen sind für viele Erkrankungen nur die Spitze des Eisbergs.
Denn zahlreiche Erkrankte lassen sich gar nicht in medizinischen Einrichtungen behandeln, besonders wenn die Infektion weniger schwer ausfällt. Auch befassen sich die behandelnden Ärzte oft nur mit der Symptomatik der Erkrankung. Sie lassen keine Diagnostik der vorliegenden Krankheitserreger im Labor durchführen, sodass die beteiligten Erreger nicht erkannt werden. Deshalb rechnen Experten mit einer hohen Dunkelziffer, bei bakteriellen Erkrankungen ist die wirkliche Zahl der Fälle wahrscheinlich um das Zehnfache höher als die der gemeldeten.
Abb. 3 Anzahl meldepflichtiger Einzelerkrankungen (Infektionskrankheiten) in Deutschland, 2019, RKI
Abb. 3 zeigt, welche Infektionskrankheiten, die dem Robert Koch-Institut gemeldet wurden, vor dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie die häufigsten waren. Die Daten beziehen sich auf das Jahr 2019, ändern sich aber zumindest in der Größenordnung von Jahr zu Jahr wenig.
Die Grippe oder Influenza (Kap. 4) führt mit ca. 194.000 gemeldeten Fällen diese Statistik an. Die Zahlen beschreiben aber nach einer starken Grippesaison im Vorjahr mit über 270.000 Erkrankten einen eher moderaten Verlauf im Jahr 2019.
Tabelle 1 Die in Deutschland häufigsten Erreger und Infektionskrankheiten, RKI 2019
Erreger
Krankheit
Gemeldete Fallzahlen
Übertragung
Influenzaviren
Grippe
193.897
Tröpfchen in der Luft, belastete Gegenstände oder Hände
Noroviren
Gastroenteritis
78.665
Tröpfchen in der Luft, Lebensmittel, Wasser, belastete Gegenstände/Hände
Campylobacter
- Bakterien
Campylobakteriose Gastroenteritis
61.526
Lebensmittel, Wasser
Rotaviren
Gastroenteritis
36.874
belastete Gegenstände oder Hände, Lebensmittel, Wasser
Varizella-Zos- ter- Viren
Windpocken
22.676
Tröpfchen in der Luft
Salmonella
- Bakterien
Salmonellose - Gastroenteritis
13.690
Lebensmittel, Wasser
Bordetella pertussis
- Bakterien
Keuchhusten
10.302
Tröpfchen in der Luft
Es folgen Durchfallerkrankungen wie die von Noroviren hervorgerufene Gastroenteritis (Magen-Darmentzündung), die zweithäufigste Infektionskrankheit. Noroviren zeichnen sich durch eine leichte Übertragbarkeit aus. Die Viren werden von Erkrankten massenhaft mit dem Stuhl und dem Erbrochenen ausgeschieden. In kleinsten Spuren von Stuhlresten oder Erbrochenem können sie über die Hände weitergegeben werden und leicht in den Mund gelangen. Sehr ansteckend sind auch kleine Tröpfchen von Sekreten in der Luft, die während des Erbrechens entstehen. Nahrungsmittel können ebenfalls mit Noroviren belastet sein und zur Infektion führen.
An dritter Stelle der gemeldeten Erkrankungen steht eine Durchfallerkrankung, die Campylobakteriose, die eigentlich nur über Essen oder Trinken übertragen wird. Trotz ihrer weiten Verbreitung und hohen Fallzahlen Jahr für Jahr ist sie erstaunlicherweise nur wenigen Leuten bekannt. Im Gegensatz zu Salmonellen, die ein Großteil der Bevölkerung als Verursacher von Lebensmittelinfektionen kennt, sind nur etwa jedem fünften Verbraucher Campylobacter-Keime ein Begriff. Dies dürfte mehrere Gründe haben. Die die Infektionen auslösenden Bakterien waren noch vor wenigen Jahrzehnten so gut wie unbekannt, da sie im Labor schwer zu züchten waren.
Außerdem waren die Bakterien eventuell früher weniger verbreitet und haben erst durch geänderte Gewohnheiten der Lebensmittelherstellung und des Verzehrs eine dominierende Stellung in den Industriestaaten erobert.
Die Zahl der Salmonellen-Erkrankungen hat hingegen in den letzten zwanzig Jahren deutlich abgenommen. Die Gründe dafür sind sicherlich die zunehmende Bedeutung der Lebensmittelhygiene vor allem in Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung, aber auch Salmonellenschutzimpfungen von Geflügelbeständen. Salmonellosen, die in den 1990er Jahren in Deutschland zu den häufigsten Infektionskrankheiten zählten, werden aktuell nicht mehr so häufig dem Robert Koch-Institut gemeldet, noch seltener als eine andere Durchfallerkrankung, die Rotaviren-Infektion.
Trotz der Möglichkeit, sich impfen zu lassen, gehören die Windpocken immer noch zu den häufigsten Infektionskrankheiten. Die Ansteckung durch Varizella-Zoster-Viren geschieht meist in der Kindheit und zeigt sich durch Fieber und juckenden Hautausschlag. Ist die Krankheit überstanden, verbleiben die Viren im Körper und können Jahre später, besonders im Alter, wieder aktiv werden und eine Gürtelrose (Kap. 4) verursachen.
Neben der Grippe ist Keuchhusten eine weitere in Deutschland häufige Atemwegserkrankung, die auch auf dem Luftweg übertragen wird. Da in Deutschland die Mehrheit der Kinder gegen Keuchhusten geimpft ist, der Impfschutz aber nicht lebenslang anhält, sind auch Erwachsene von der Krankheit betroffen.





























