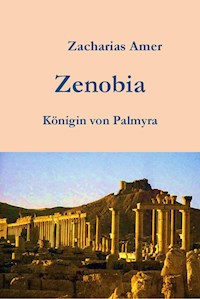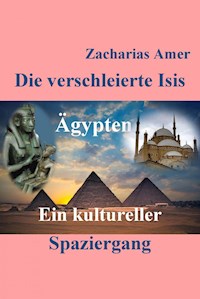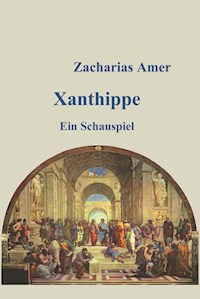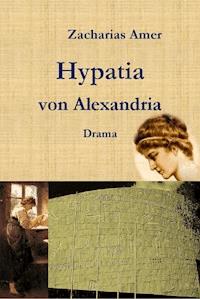Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In den Kurzgeschichten wird das Heilige entheiligt und auf den Boden der Realität hinabgezerrt. So haben "Chalil", "Antonius" und der rückkehrende Sohn in "Heimkehr" nur noch wenig gemein mit dem heiligen Schein, der ihnen zugeschrieben wird. Die Protagonisten der Geschichten befinden sich in einer ausweglosen Situation, die zweimal tragisch endet. Eine harmlose "Fahrt", die die Hoffnung auf einen Theaterbesuch weckt, erweist sich als ein Alptraum, der in Kannibalismus ausartet. Wünsche gehen nicht in Erfüllung, es sei denn, die Pforte des Himmels öffnet sich in einer gesegneten Nacht, wobei der Protagonist nicht so richtig weiß, ob er nicht das Ganze nur geträumt hat. In "Inferno" bleibt dem Protagonisten, dem großes Leid zugefügt wurde, die Hoffnung auf Gerechtigkeit versagt, er gerät sogar in den Verdacht, dieses Leid selbst verursacht oder zumindest provoziert zu haben. Die Hölle auf Erden setzt sich im Jenseits fort.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 193
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zacharias Amer
Inferno
und
andere Geschichten
epubli
Impressum
© 2015 Zacharias Amer
Druck und Verlag: epubli GmbH, Berlin, www.epubli.de
ISBN 978-3-7375-7759-5
Printed in Germany
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhalt
Chalil, der Schafhirt
Antonius oder die Macht der Dämonen
Inferno
Die Nacht des Schicksals
Die Fahrt
Heimkehr
Chalil, der Schafhirt
Als Jesreel die Straße entlanglief, tauchte plötzlich ein alter Mann vor ihm auf und sprach ihn an: „Wohin des Weges, junger Freund?“ Jesreel drehte sich um und sann nach „den Mann kenne ich doch, den habe ich schon mal mit meinem Vater gesehen, peinlich, dass sein Name mir nicht einfällt.“
„Anscheinend überlegst du, wer ich bin?“
„Ja, in der Tat, verzeihen Sie bitte.“
„Lassen wir das doch mit diesem ‚Sie‘. Ich bin Hanafi, ein sehr alter Bekannter deiner Familie. Ich kann sagen, ich habe dein Heranwachsen vom ersten Tag an begleitet, dann war ich für längere Zeit verreist; nun sehe ich, wie du zu einem Mann herangereift bist...“
„Für meinen Vater bin immer noch ein kleines Kind“, sagte Jesreel lächelnd.
„Das wirst du auch immer bleiben. Der Zeitabstand bleibt nämlich immer gleich, also wirst du auch mit achtzig noch Kind bleiben, aber nur für deine Eltern, versteht sich. Wie geht es deiner Mutter?“
„Immer fleißig bei der Arbeit. Von früh bis zum Abend ist sie hinter dem Gesinde her. Lamentiert, gibt Befehle und man kann ihr eigentlich nichts recht machen. Ich wundere mich, wo sie all die Energie herhat, bedenkt man das hohe Alter, vor allem dieses Arsenal an Schimpfworten, die sie parat hat und jedem Unliebsamen an den Kopf wirft. Manchmal tun mir die Leute, die vom Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang schuften müssen, richtig leid.“
„Ein einfühlsames Herz hast du, mein Freund, das erfreut mich, aber lass uns doch ein Stückchen zusammengehen, uns eine ruhige Ecke suchen, wo uns keiner stört. Ich habe nämlich einiges mit dir zu bereden. Natürlich nur wenn ich dich von keiner Arbeit abhalte.“
„Nein, nein. Ich habe weder Arbeit noch ein richtiges Ziel. Viel Lust, auch so ein Schafhirt zu werden wie mein Vater, habe ich eigentlich nicht. Andererseits weiß ich nicht, was aus mir werden soll. Mir juckt es richtig in den Fingern, gern würde ich eine handwerkliche Tätigkeit erlernen, wo nach getaner Arbeit das Ergebnis vor mir steht und darauf wartet, bewundert zu werden, so etwas, was mein Großvater tat, leider war mir nicht vergönnt, ihn kennenzulernen. Ich kam ja auch viel zu spät auf die Welt. Von ihm hörte ich viel. Vater redet aber nicht so gern von ihm, ich weiß nicht warum.“
„Vielleicht kann ich da ein wenig helfen“, sagte Hanafi. Inzwischen waren die beiden ein Stück weit vom Dorf entfernt. Schnell fanden sie einen gemütlichen Platz mit einem herrlichen Blick auf die entfernt liegenden Berge. Sie setzten sich einander gegenüber und Hanafi dachte, wahrlich ein Prachtbursche, der hätte auch mein Sohn sein können, wenn nicht die dumme Gans... Er unterbrach seine Gedanken und fuhr fort: „Dein Großvater war ein Künstler, ein Steinmetz, der Figuren angefertigt und sie verkauft hat. Das Geschäft lief gut und mit der Zeit entstand ein kleines Vermögen, das die Grundlage für euren Familienreichtum bildete. Chalil, dein Vater, hatte dagegen für Kunst nicht viel übrig. Als wir einmal beisammensaßen, erzählte er uns, dass er zu seinem Vater ging und ihn gefragt hat, was diese Figuren zu bedeuten haben. Nichts, sagt der Vater, Hauptsache sie sind schön und die Menschen haben ihre Freude daran, und vergiss nicht, mein Kind, wir leben gut davon. Chalil murrte und fuhr seinen Vater an: ‚Aber die Menschen stellen sich so einen Stein hin und bilden sich ein, dies sei eine Gottheit, die Krankheiten heilt, und angebetet werden soll‘. Sein Vater, zuerst erschrocken über den schroffen Ton, den er von seinem Sohn nicht kannte, blieb ruhig und sagte: ‚Ach Unsinn, ein Stein ist und bleibt ein Stein, kann weder essen, noch reden, aber er kann auch etwas symbolisieren und warum nicht eine Gottheit. Wer weiß denn, wie eine Gottheit aussieht, du etwa, du Großmaul?‘ Verärgert wartete Chalil, bis sein Vater das Haus verließ, dann nahm er einen Hammer und zertrümmerte alle Figuren, außer der größten unter ihnen. Der Vater kehrte zurück, stand vor dem Trümmerhaufen und kochte innerlich vor Wut. Voller Entsetzen fragte er, wer das getan hat. Da erwiderte ihm Chalil; der da, er wies dabei mit der Hand auf die einzig verbliebene Figur. Frag ihn doch, warum er das getan hat. Willst du mich zum Narren halten, du Lausebengel, schrie der Vater und verpasste Chalil eine ordentliche Ohrfeige. Mir aus den Augen, du verfluchter Hundesohn, mit einer Rute jagte er Chalil aus dem Haus und brüllte ihm nach: lass dich hier nie wieder blicken, du elender Schurke. Es fehlte nicht viel und der Vater hätte ihm den Schädel eingeschlagen. Ja, er war sehr aufgebracht und wollte von Chalil nichts mehr wissen, ihn sogar enterben, wenn nicht die guten Leute herbeigeeilt wären, ihn beruhigten: der Junge würde niemals von allein auf so eine Idee kommen, da stecken bestimmt niederträchtige Personen dahinter, irgendwelche Bösewichter, die dem Vater schaden wollten, die müssen den unterbelichteten Sohn dazu verführt haben und so weiter..., was man halt in solchen Situationen so sagt. Mit Mühe und Not konnten sie den Vater von seinem Vorhaben abbringen. Chalil hat uns seine Version der Geschichte erzählt, die weder Schimpftiraden, noch eine Ohrfeige enthielt, vom Enterben ganz zu schweigen... Das war der Grund, warum er sich mit seinem Vater entzweit hat.“
„Du hast ihm anscheinend nicht geglaubt?“
„Keiner von uns hat ihm geglaubt; denn wir wussten, dass Chalil jede Geschichte in seinem Sinne verdreht und deutet. Was er erzählt, hat größtenteils mit den wahren Tatsachen nicht das Geringste zu tun. Wer ihn zum Beispiel über seine Auswanderung reden hört, warum er also seine Heimat verlassen musste, denkt, er habe auf einen höheren Befehl hin gehandelt. Dem ist aber nicht so. Chalil wanderte nicht freiwillig aus, sondern man hat ihn, diesen Hobby-Astrologen, schlicht und einfach hinausgeworfen.“
„In deinen Augen ist er nichts weiter als ein elender Lügner.“
„So würde ich das nicht nenne. Fakt ist, Chalil war zeit seines Lebens ein phantasiebegabter Junge. Wir wussten das und ließen uns seine Geschichten gefallen. Wir waren ja gewohnt, dass bei jeder Zusammenkunft dein Vater ein paar Geschichten zum Besten gab, vom Wein berauscht, amüsierten wir uns köstlich darüber. Manchmal hat mich seine Angeberei sehr gestört, mit zunehmender Dauer war sie mir sogar ein Dorn im Auge, aber ich wollte kein Spielverderber sein. Womit hätten wir uns sonst die Zeit vertreiben können, also ließen wir ihn reden und so sprang er von einer sagenhaften Geschichte zur anderen. Einmal erzählte er uns, seine Mutter habe ihn ganz allein in einer Höhle zur Welt gebracht, weil dem König, der damals herrschte, prophezeit wurde, ein Kind wird geboren, das ihm um ein Vielfaches überlegen sei. Der König brauste vor Wut und ließ, wie Könige so sind, alle Kinder umbringen. Chalils schwangere Mutter floh mit ihm in eine Grube, dort brachte sie ihn zur Welt, vermutlich ohne Hilfe. Fünfzehn lange Jahre lebten sie in der Einsamkeit, versorgt von einer unsichtbaren Hand, die in der Höhle erschien und aus jedem Finger träufelte etwas: Honig Wasser, Milch und weitere Gaumenfreuden. Gut genährt und wie ein Kalb gemästet, verließ er die Höhle, der böse König war ja längst tot.“
„Davon weiß ich gar nichts“, sagte Jesreel, der über das Gehörte fassungslos war.
„Warum sollte dein Vater dir so eine hirnverbrannte Geschichte erzählen? Er weiß doch besser als alle anderen, dass er sich alles ausgedacht hat, um uns, seine guten Freunde, zu unterhalten.“„Vielleicht ist was Wahres daran.“
„Mein lieber Freund, von einem König, der alle Babys umbringen ließ, hat nie jemand was gehört, hat irgendeiner etwas darüber berichtet. Glaubst du ernsthaft, ein Ereignis solchen Ausmaßes bekommt niemand mit, nur dein Vater einzig und allein! Wie gesagt, Chalil war von Natur aus ein Grübler. Alle möglichen Erscheinungen verwirrten ihn. Nachts plagten ihn Träume und Visionen und das Schlimme war, dass er daran geglaubt hat. Die Sterne, das waren für ihn die Augen Gottes. ‚Was! Ein Gott mit so vielen Augen!‘, fragten wir belustigt. ‚Ja‘, sagte Chalil und schien von den eigenen Worten überzeugt zu sein, ‚denn Gott muss ja seine Augen überall, alles unter Kontrolle haben, nichts darf ihm entgehen‘. ‚Das hieße ja, er beobachtet uns nur nachts; denn am Tage sind die vielen Augen nicht da. Ob das ausreicht!‘. Chalil grübelte nach, dann sagte er: ‚am Tage genügt schon ein Auge, ein ganz großes‘, er meinte die Sonne. ‚Deswegen wandert sie ja von Ost nach West, um alles in Augenschein zu nehmen‘. Wir krümmten uns vor Lachen und manche fürchteten, Chalil könnte eines Tages den Verstand verlieren. Wir fragten, aber was ist mit dem Mond, Chalil? Ist er auch so ein Auge Gottes? Darauf wusste er keine Antwort, er war irritiert und sichtlich verärgert, weil er den Mond nicht unterbringen konnte.
Einmal sprach ihn eine Stimme an, er soll hinaufschauen und die Sterne zählen. Das tat er auch, und wir gackerten vergnügt wie besoffene Hühner. Chalils Wesen wohnt das Unwegsame inne. Man kann sagen, er ist ein „sinnender und innerlich beunruhigter Mann“, was den Umgang mit ihm erheblich erschwert. Dagegen kam ich mit deinem frühverstorbenen Onkel Haran bestens aus. Zu ihm pflegte ich eine sehr gute Beziehung; denn der war ein Mann mit einem festen Charakter, ein aufrichtiger Mensch, der keine Flausen im Kopf hatte und den ja auch keine Stimmen von irgendwoher heimsuchten. Trotz des Altersunterschieds fanden wir Gefallen aneinander, tauschten alle unsere Geheimnisse aus und lästerten gemeinsam über den Bruder Chalil mit seinen wirren Geschichten und Absonderlichkeiten, mit denen er uns immer aufs Neue zu erheitern wusste. Von Haran war ich bestens informiert über alles, was in eurem Haus vor sich ging. Er brauchte jemanden, dem er alles anvertrauen konnte und wusste, dass ich schweigsam bin wie ein Grab. Als es um das Erbe des Vaters ging, vor der großen Wanderung, betrog Chalil ihn vorne und hinten. Habgierig wollte Chalil alles für sich haben und den jüngeren Bruder leer ausgehen lassen, am liebsten hätte er ihn hinausgejagt. Haran, dem es wenig um materielle Güter ging, ertrug die Launen des älteren Bruders geduldig und weinte sich bei mir aus. Doch muss es ihn sehr gekränkt haben, so behandelt zu werden. Er zog sich zurück, erkrankte und starb. Chalil war froh, den Rivalen um die Güter des Vaters losgeworden zu sein.“
„Hat mein Vater in deinen Augen überhaupt positive Eigenschaften? Ich sehe dich nur alle schlechten Eigenschaften über sein Haupt häufen.“
„Natürlich hat Chalil auch gute Eigenschaften, aber so ohne Fehl und Tadel, wie er sich gibt und wie du ihn gern hättest, ist er nicht. Das wollte ich damit sagen.
Diese ständige Unruhe, ja die Hast und Unausgewogenheit seines Wesens wirkten in der Tat beängstigend. Vielleicht hat das damit zu tun, dass er von weither kam. Er war ein Fremder, ein Getriebener, der sich in diesem Land nie heimisch fühlte. Die anderen verachteten ihn, schauten auf ihn, den Fremden, herab, das verletzte ihn zutiefst. Bald erfuhren sie, dass er nicht unvermögend sei, weil er viel geerbt hatte, schnell setzten sie die Willkommensmaske auf. Chalil fühlte sich unwillkommen und hat diese, wie soll ich sagen, Demütigung nie richtig überwunden. Sein Bemühen, das Besondere, das Auserwählte hervorzukehren, ist womöglich nur die Reaktion des Heimatlosen, die Rache des Zukurzgekommenen, Ausgegrenzten, der den anderen zeigen wollte, dass er nicht nur ebenbürtig, sondern ihnen gar überlegen sei. Daher ruhte sein Hirn nie. Ständig ließ er sich etwas einfallen, um diese seine Besonderheit unter Beweis zu stellen.
Chalil tauchte in dieser Gegend auf, nicht weil er als Schafhirte auf der Suche nach Weideland war, sondern weil eine Stimme ihm dies befahl: ‚Geh aus deinem Land und aus deiner Sippe und aus deinem Vaterhaus in ein Land, das ich dir zeigen werde,‘ befahl sie ihm und da nimmt man sofort seine sieben Sachen und geht. Die Stimme, erfreut über den Gehorsam, zeigte sich erkenntlich: „ich werde segnen, die dich segnen, und wer dich verflucht, den werde ich verfluchen“, flüsterte sie ihm ins Ohr. Ist doch nett, nicht wahr? Seitdem sind Chalil und seine Stimme ein Herz und eine Seele. Alles, was er uns auftischte, kam nicht von ihm, sondern von ihr. Es war eine Art Ausgeliefertsein, als ob er sagen wollte: was soll ich machen, Leute, ich muss. Chalil, mein Junge, sagte ich ihm einmal, das hast du alles hübsch erdichtet. Da war er beleidigt und wollte mit mir kein Wort mehr reden. Er baute diese Stimme auf, erschuf sie aus dem Nichts, stattete sie aus mit allen Eigenschaften, die ihm einfielen. Sie war ein allmächtiges Etwas, ein übermenschliches Wesen, zu dem Chalil ständig Kontakt hatte. So legte sich der Verstoßene eine Bedeutung zu und suchte nicht nach Verbündeten, sondern ersann sie. Aber wie konnte er eine Bedeutung erlangen, wenn er nicht einmal in der Lage war, ein Kind zu zeugen?“. Bei diesen Worten schaute Jesreel Hanafi entsetzt an, die Augen weiteten sich, der Mund blieb offen, aus dem Gesicht verschwand jegliche Farbe. Hanafi, dem die Veränderungen nicht entgingen, ließ sich davon nicht beeindrucken und sprach weiter. „Die Schmach des Fremden, Abgesonderten, Unwillkommenen wurde noch von der Schmach des Kinderlosen übertroffen. Die besten Mannesjahre waren dahin und der erhoffte Stammhalter ließ sich nicht blicken, obwohl Chalil sich rastlos bemühte und mit Mara, deiner Mutter, sooft er konnte, schlief. Er war sich im Klaren darüber, dass dieser Zustand mit allen Mitteln geändert werden müsse, so teilte er Mara mit, dass er sich von ihr zu trennen gedenke oder eine zweite Frau nehmen müsse. Mara kam auf die Idee, er könne doch den heißersehnten Stammhalter mit einer Sklavin zeugen, die Schande wäre überwunden. Mara, die nicht verstoßen werden wollte, tat es verständlicherweise zähneknirschend und Chalil willigte sofort ein. Es währte nicht lange und er fand Gefallen an der jungen, hübschen Sklavin, mit der er deinen Halbbruder Samcan zeugte. Du weißt doch, dass du einen Halbbruder hast?“
„Ja“, sagte Jesreel, dem die Bejahung schwerfiel.
„Er ist im Haus kein Tabuthema“.
„Natürlich nicht, wie kommst du darauf?“
„Und dass er der Sohn einer Sklavin ist, das...“
„Auch das weiß ich.“
„Natürlich hatte deine Mutter keine andere Wahl, als so zu handeln. Ausgestoßen zu werden ist das Schlimmste, was einer Frau passieren kann. Unsere Sitten und Gebräuche sind antiquiert, da brauchen wir uns nichts vorzumachen. In dieser Wüstengegend gilt der Umstand, keine Kinder zu haben, als die größte Schmach, sie gleicht einer Entehrung. Ist ein Mann impotent, dann hat das Leben für ihn gar keinen Sinn mehr, er kann sich getrost das Leben nehmen. Ist er obendrein ein einflussreicher Mann, dem angeblich prophezeit wurde, aus seinem Samen wachse eines Tages ein mächtiges Volk, dann ist dieser Tatbestand nicht ein Schlag ins Gesicht, sondern er kommt einem Todesurteil gleich.
Deine Mutter wusste das alles und ließ den Alten gewähren. Als sie aber sah, wie Chalil sich mit der jungen, attraktiven Sklavin vergnügte, fauchte sie wie eine verwundete Löwin und machte gute Miene zum bösen Spiel. Sie ertrug die Demütigungen und wartete auf eine Gelegenheit, sich zu rächen. Die Sklavin wurde schwanger und Mara wütete. Sie machte der Sklavin das Leben zur Hölle. Diese ertrug das elende Leben nicht länger, floh und kehrte, als sie keine Bleibe fand, bald zurück. Als sie ihr Kind zur Welt brachte, verlor Mara fast die Besinnung. Dann kamst du wie aus heiterem Himmel zur Welt, da sah Mara den Zeitpunkt gekommen, die Sklavin mit ihrem Kind loszuwerden. Sie war verbittert und wollte ihrer Rivalin, die anfing, die Nase über die alte, unfruchtbare Frau zu rümpfen, alles heimzahlen. Der wahre Grund aber war der, den Sohn mit seiner Mutter zu enterben und Chalils Hinterlassenschaft für dich allein aufzubewahren. So jagte sie die Sklavin hinaus, Mutter und Kind wurden in die wasserlose Wüste geschickt. Dass das für die beiden den sicheren Tod bedeuten könnte, schien Mara herzlich wenig zu kümmern. Auf der Suche nach Wasser rannte die arme Frau wie eine Wahnsinnige hin und her, denn sie sah, wie ihr Kind am Verdursten war. Durch ein Wunder fand sie Wasser und rettete sich und dem Kind das Leben.
Ich erinnere mich noch der Abschiedsszene, sie war rührend. Da stand Chalil da mit versteinertem Gesicht und blickte, wie es seine Art ist, ins Leere. In der Hand hielt er einen Korb mit Proviant und einem Wasserschlauch. Das war alles, was er den beiden Verstoßenen mit auf dem Weg gab. Seine Augen deuteten an, dass er zu diesem Schritt gezwungen wurde, Mara befahl und er gehorchte. Wohlwissend, dass Mutter und Sohn in den Tod geschickt werden, dass es eine Reise ohne Wiederkehr sein wird, unternahm er nichts und ließ seine Frau gewähren. Mara hätte die beiden am liebsten eigenhändig liquidiert, so bösartig und hasserfüllt war sie. Ich hätte deiner Mutter nie ein solches versteinertes Herz zugetraut. Die Zeit verging, von der Sklavin und ihrem Sohn hörten wir nie wieder, wer weiß, vielleicht sind sie längst gestorben, in der Wüste verreckt. Doch bevor es soweit war, wurde unser Land von einer bitteren Hungersnot heimgesucht, von der du sicherlich gehört hast. Ich fragte mich: ist das nicht die gerechte Strafe dafür, für das Unrecht, das der armen Frau angetan wurde? Chalil, war zu jener Zeit unser Dorfvorsteher, der viel auf seine verdrehten Geschichten hielt. Die Hungersnot machte ihm zu schaffen, kratzte an seinem Ansehen. Er wollte seine Pflicht erfüllen und die Not mildern, nicht weil die Not der anderen ihm so sehr am Herzen lag, sondern weil er um seine Macht fürchtete. So war ihm jedes Mittel recht. Alle Dorfbewohner schauten auf ihn, auf den reichen, angesehenen Mann. Die Hungersnot war seine erste Bewährungsprobe. Ihm blieb nichts anders übrig, als den schweren Gang über die Berge zu gehen, dorthin, jenseits des Flusses, gab es einen Herrscher, ein reicher Großgrundbesitzer, der über fruchtbare Ländereien verfügte. Er war der einzige, der in einer solchen Situation hatte helfen können, aber er tat nichts umsonst. Dieser Mensch hatte eine Schwäche für Frauen, er liebte sie über alles und konnte nicht genug von ihnen haben, man kann sagen, er war ein Schürzenjäger. So erteilte er seinem Gesinde den Befehl, jede schöne Frau, die gesichtet wird, bei ihm zu melden. Obwohl dein Vater dies wusste, marschierte er dorthin, um seine Sippe vor dem Verhungern zu retten. Die Reise war beschwerlich und dauerte viele Monate. So beschloss Chalil, deine Mutter mitzunehmen. Die Schönheit deiner Mutter war ja allgemein bekannt und dein Vater überlegte: erzähle ich dem Gesinde des Herrschers, sie sei meine Frau, so bringen sie mich kurzerhand um und schleppen meine Mara zu ihrem Herrscher, damit sei gar nichts gewonnen. Also wäre es doch besser zu sagen, sie sei meine Schwester. Dem Herrscher zugeführt wird sie ohnehin, aber so rette ich wenigstens mein Leben, erhalte, was ich brauche und erfülle meine Pflicht unserem Geschlecht gegenüber. Wie nicht anders zu erwarten war, wurde Mara sofort zum Herrscher geführt und es gab keinen Gott weit und breit, der sie aus dieser misslichen Lage hätte retten können. Es ist ja auch fraglich, ob sie hätte gerettet werden wollen. Von einem mächtigen Herrscher begehrt zu werden, befriedigt schließlich die Eitelkeit jeder Frau und sie war sich keiner Schuld bewusst. Hat nicht ihr Mann sie dem Verführer eigenhändig ausgeliefert?“
Dem Jesreel stockte der Atem, er glaubte bald zu ersticken und war der Ohnmacht nah. Anstatt den Alten anzuflehen, mit seiner Erzählung aufzuhören, stürzte er sich reflexartig auf ihn, um ihn zu erwürgen oder zumindest auf der Stelle zum Schweigen zu bringen: „Willst du…, willst du“, stammelte er „willst du damit sagen, meine Mutter war eine Hure und noch dazu mit Billigung und dem Segen meines Vaters? Willst du…, willst du…, du niederträchtiger Mensch, meinen Vater zu einem Zuhälter machen? Dafür werde ich dich auf der Stelle umbringen.“ Er legte seine, trotz seiner jungen Jahre, kräftigen Händen an die Gurgel des Mannes, der dabei war, ihm Schritt für Schritt das Leben zu ruinieren und drückte kräftig zu. Der Alte wehrte ihn leicht ab. Er spürte sofort, dass Jesreel gar keine Kraft hat; denn er zitterte am ganzen Körper. Mit seinem vernebelten Blick schien er eher den Alten um Erbarmen zu bitten. Der Alte schaute ihn mitleidig an, er drückte den Jesreel kräftig an sich und ließ ihn sich ausheulen. Nach einer Weile sagte er: „Ich bedauere zutiefst, dir all das erzählen zu müssen.“
„Wieso musst du das? Du musst es gar nicht, wer zwingt dich dazu?“
„Mein Gewissen.“
„Ach, ein Gewissen hast du auch!“
„Ich kann deinen Ärger vollkommen verstehen. An deiner Stelle wäre ich womöglich völlig ausgerastet, daher bewundere ich, trotz allem, deine Selbstbeherrschung. Dennoch kann ich mir nicht verkneifen zu sagen, dass Mara die Zeit mit dem jungen, gutaussehenden Herrscher genoss, ja sie kostete die Befriedigung, die ihr mit Chalil versagt war und hätte sie die Wahl gehabt, bliebe sie im Harem; denn sie lernte zum ersten Mal eine Art des kultivierten Lebens kennen, die ihr bis dahin völlig unbekannt war. Sie, die nur mit ungepflegten, grobschlächtigen Schafhirten Umgang hatte, fing an, sich zu schminken, genoss das Bad, das gute Essen, die nächtlichen Vergnügungen mit Tanz und Spiel. Es war eine völlig andere, eine neue Welt. Doch der junge Herrscher hatte bald genug von ihr, er zahlte seine Schulden und ließ sie mit ihrem angeblichen Bruder ziehen. Sie kehrte mit dessen Samen im Bauch, aus dem du wurdest, zurück. Von den Einzelheiten wussten damals nicht viele. Dein Vater war sehr bemüht, alles geheim zu halten, er gab seinen Sklaven den Befehl: nie ein Wort über die Begleitumstände dieser unerfreulichen Reise verlauten zu lassen und drohte jedem, ihn eigenhändig aufzuhängen, wenn er dem Befehl zuwiderhandelt. Aber ein Sklave bleibt ein Sklave und für eine Goldmünze ist er bereit, alles zu verraten. Jedoch bedurfte es gar nicht der Bestechung; denn wir wunderten uns sehr über zwei Umstände: erstens dass die Reise so überaus erfolgreich war und zweitens, dass der Bauch deiner Mutter sich allmählich zu runden begann. Dein Vater kehrte mit einer vollbeladenen Karawane zurück. Er bekam noch mehr als er verlangt hat, sämtliche Wünsche wurden ihm erfüllt, schwer beladen waren die Maultiere. Alle Knechte waren fröhlich und umarmten sich, nun war die Not besiegt, die Katastrophe überwunden. Nur dein Vater schaute grimmig vor sich hin. Von da an erstarb das Lächeln auf seinem Gesicht. Es war eine Wunde, die nie heilen wird, die ihn sein Leben lang begleiten wird.
Die Menschen, die dem Hungerstod entronnen waren, lobten ihn überschwänglich. Sie lobten seine Umsicht, seine Geschicklichkeit. Als aber ein paar Monate später die Schwangerschaft deiner Mutter nicht zu übersehen war, wunderten sich die Menschen noch mehr. Artig wie sie sind, spielten sie die Unwissenden und schrieben den Umstand der Frömmigkeit deines Vaters zu. Endlich hat der Allmächtige seine Gebete erhört und ihm den heißersehnten Wunsch nach einem Stammhalter erfüllt. Ist nicht der Allmächtige zu allem fähig? Belohnte er nicht stets die ihm Ergebenen? Sagten und fragten sie sich.“
„Du willst also behaupten, ich bin der Sohn von diesem ruchlosen Menschen?“ fragte Jesreel mit bebender Stimme.