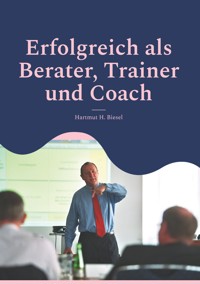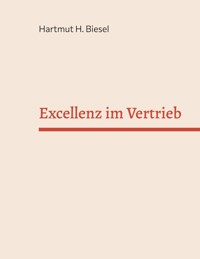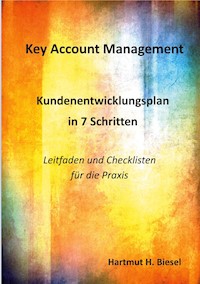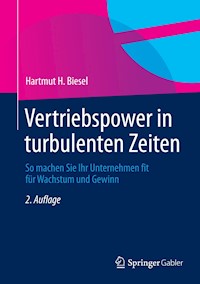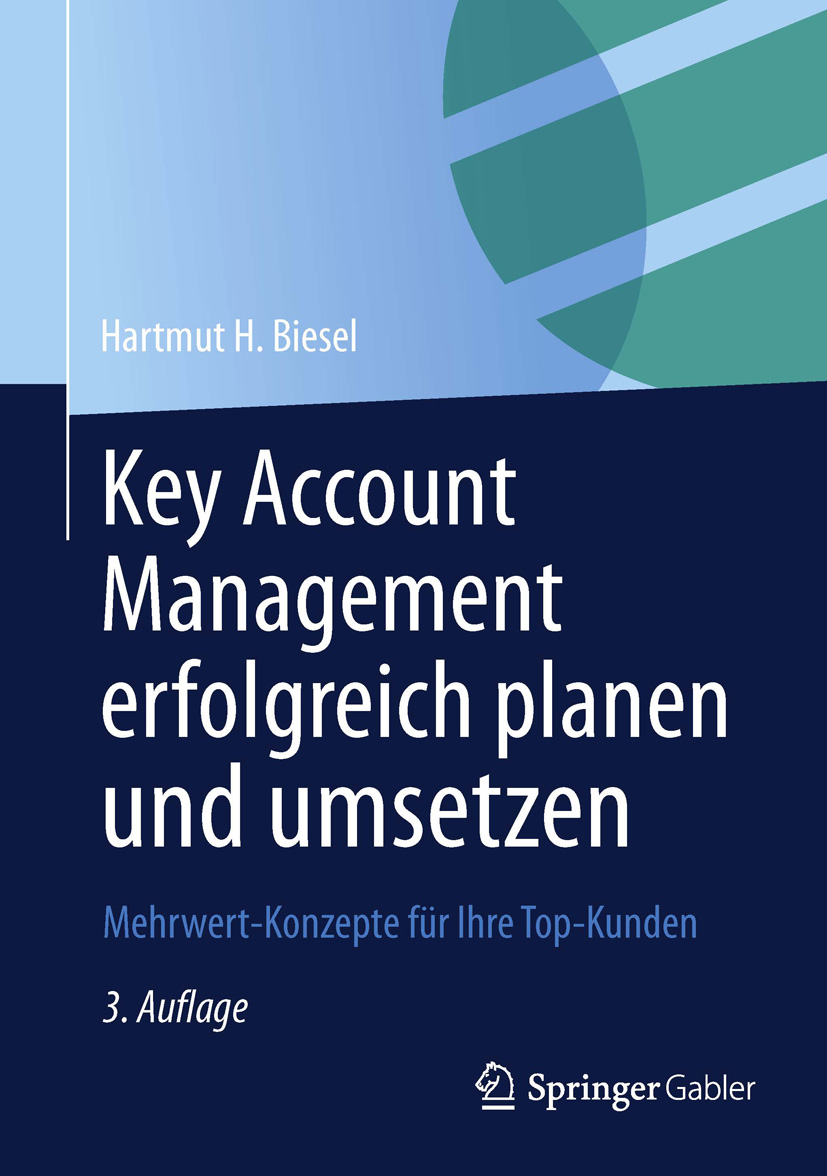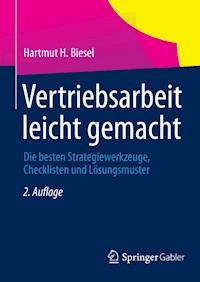Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Der verkaufsaktive Innendienst der Zukunft wird zu einem wichtigen und unverzichtbaren Baustein eines Multi-Channel-Vertriebs in einer digitalen Wirtschaft. Das Tätigkeitsspektrum eines Innendienstes 4.0 wird sich erheblich verändern und erfordert deshalb eine Neuausrichtung der internen Ablaufprozesse und Organisationsstrukturen. Ein Innendienst 4.0 ist nicht mehr der Unterstützer des Außendienstes oder Sachbearbeiter für interne Angelegenheiten, sondern erhält klare Kundenverantwortung. Hierfür benötigen die Mitarbeiter entsprechende Kompetenzen und Ressourcen. Die Auswahl geeigneter Mitarbeiter und deren zielorientierte Führung entscheidet über den Zukunftserfolg eines Innendienstes 4.0. Der Autor entwickelt in dem Buch einen Leitfaden zur Neuausrichtung eines verkaufsaktiven Innendienstes der Zukunft. Praxisnah für Praktiker, mit vielen Checklisten und Fallbeispielen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 217
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Ziel des Buches
Vertrieb 4.0
Kundenmanagement in der digitalen Welt
Das veränderte Einkaufsverhalten der Kunden
Neuausrichtung der Vertriebsorganisation
Die Festlegung strategischer Vertriebsziele
Der Reifegrad von Vertriebsorganisationen
Der kennzahlengesteuerte Vertrieb
Neuausrichtung der Innendienstorganisation
Grundsätze einer Organisationsänderung
Die Neuausrichtung des Innendienstes
Steuerung des Innendienstes
Die Festlegung von Führungsregeln
Grundlagen der situativen Führung
Das Prinzip „Minimale Führung“
Die Führungsaufgaben eines Innendienstleiters
Der Innendienstleiter als Coach
Der Coaching-Prozess
Mitarbeiter für die Zukunft fit machen
Mitarbeiter „gehirngerecht“ ansprechen
Ohne starke Ideen keine Veränderungen
Die Angst der Innendienstmitarbeiter vor Veränderungen
Die Phasen des Wandels
Analyseverfahren zur Persönlichkeitsbestimmung
Commitment statt Flohzirkus - Spielregeln für Innendienstteams
Vereinbarung von Maßnahmen
Die Entwicklung von Innendienstteams
Innendienstteams durch Zielvereinbarungen führen
Ziele realistisch vermitteln
Die Durchführung von Zielvereinbarungsgesprächen
Durch gezieltes Feedback Mitarbeiter emotional binden
Der konstruktive Umgang mit Konflikten
Incentives und variable Entlohnung im Innendienst Dynamo oder Dynamit
Variable Entlohnung – Zukunft oder Irrweg?
Optionen in der variablen Entlohnung
Variable Entlohnung von Teams
Regeln beim Einsatz von Anreizsystemen
Einführung eines variablen Anreizsystems
Innendienstressourcen gezielt einsetzen
Mitarbeiter für Tätigkeitsanalysen einvernehmlich gewinnen
Verlagerung von Außendienstaufgaben an den Innendienst
Automatisierung und Standardisierung von administrativen Tätigkeiten
Digitale Werkzeuge zur Steuerung der internen Prozesse im verkaufsaktiven Innendienst
Customer Relationship Management (CRM)
Dokumentenmanagement
Enterprise Content Management (ECM)
Dokumenten Management System (DMS)
Digitales Werkzeug zur Steuerung von Kundenbeziehungen im verkaufsaktiven Innendienst
Lead Management
Ziel eines Lead Management
Lead Management im Verkaufsprozess
Herausforderungen im Lead Management
Voraussetzungen für eine erfolgreiches Lead Management
Der Lead Managementprozess
Die Umsetzung entscheidet über den Erfolg, nicht die Theorie
Mitarbeiter in den Umsetzungsprozess einbinden
Ein Scheitern kann vermieden werden
Werkzeuge des Veränderungsprozesses
Durch Workshops die Neuorientierung unterstützen
Der verkaufsaktive Innendienst der Zukunft
Sind Trends immer zielführend?
Mut zu Veränderungen
Literaturhinweise
Ziel des Buches
Das Thema „Verkaufsaktiver Innendienst“ ist schon seit vielen Jahren auf dem Radar vieler Unternehmen und Manager. Doch hat sich in den letzten Jahren in den Unternehmen etwas Gravierendes verändert? In dieser Hinsicht ist meine Erfahrung sehr ambivalent. Es gibt Unternehmen, die ihre Vertriebsinnendienstorganisationen konsequent verändert haben, einige haben sich mit einem zweitägigen Telefontraining für die Innendienstmannschaft begnügt. Und in nicht wenigen Unternehmen blieb es beim Lippenbekenntnis. Das Thema hat durch die Entwicklung eines Vertriebs 4.0 an Brisanz zugenommen. Die Digitalisierung des Kundenmanagements wird in vielen Branchen und Unternehmen dazu führen, dass die Organisation des Kundenmanagements verändert werden muss. Es reicht nicht mehr aus sich damit zu beschäftigen, die Tagesaufgaben besser zu steuern oder den Support zu optimieren. Der Aufbau eines Vertriebs 4.0 verlangt nach einer grundsätzlichen Neuausrichtung, zum Beispiel dem Aufbau eines verkaufsaktiven Innendienstes, der seinem Anspruch auch gerecht wird. Der verkaufsaktive Innendienst der Zukunft ist ein wichtiger Baustein eines Multi-Channel-Vertriebs!
Der Innendienst ist in vielen Unternehmen heute immer noch ein Vertrieb zweiter Klasse, überwiegend mit Support-Aufgaben betraut. Er kämpft mit bürokratischen und administrativen Hindernissen mit der Folge, dass die Verkaufsaktivität zu kurz kommt. Trotz des Einsatzes digitaler Medien sind viele Innendienstler unsicher, welchen Beitrag sie zu strategischen Vertriebszielen leisten sollen, mit welchen Erfolgskennzahlen ihr Einsatz bewertet wird und für welche Aufgaben sie welche Verantwortlichkeiten oder Kompetenzen einfordern können. Informationen werden zwischen den unterschiedlichen Vertriebsbereichen nicht konsequent geteilt.
Der Freiraum für Mitarbeiter selbst zu entscheiden, wie und wann sie ihre Aufgaben im Sinne der Zielerfüllung erledigen, ist oftmals nicht ausreichend vorhanden. Sie können nicht immer auf unterstützende Werkzeuge, zum Beispiel IT-Systeme, zugreifen oder kämpfen in der Praxis mit deren Komplexität.
Wir haben meistens klare Vorstellungen über viele Aufgabengebiete einer Unternehmensorganisation, zum Beispiel über die Bereiche „Logistik“ oder „Verwaltung“. Doch wie steht es mit der Vorstellungskraft, wenn die Aufgaben eines Innendienstes hinterfragt werden? Da kommt schnell ein Sammelsurium von unterschiedlichsten Aufgabenzuordnungen zustande. Oftmals auch eine Auflistung all der Aufgaben, die durch andere Unternehmensbereiche nicht erledigt werden. Wertschätzung sieht anders aus!
Der verkaufsaktive Innendienst der Zukunft wird eine andere Position einnehmen. Er ist ein aktiver Teil eines Multi-Channel-Vertriebs mit klaren Verantwortlichkeiten und Kompetenzen. Deshalb ist es mein Anliegen in diesem Buch, die zukünftige Rolle des Innendienstes zu beleuchten und Ideen zu skizzieren, wie der Innendienst ausgerichtet werden kann. Natürlich kann ich Ihnen kein „Backrezept“ liefern, mit dem 1:1 der Wandel gelingen kann. Das Buch soll aber ein Leitfaden sein für mögliche Veränderungsansätze. Werkzeuge, Checklisten und Arbeitsblätter unterstützen Sie bei der Umsetzung.
Warum ist es wichtig, über den Einsatz eines verkaufsaktiven Innendienstes nachzudenken? Welche Strukturen und Organisationsformen eignen sich, die Vertriebsaktivität des Innendienstes zu verstärken? Wie können die Mitarbeiter des Innendienstes erfolgreich in einen Veränderungsprozess eingebunden werden? Wie muss sich die Führung verändern, um einvernehmlich die Kundenmanager im Innendienst zu steuern? Welche Werkzeuge und Vorgehensweisen benötigt der verkaufsaktive Innendienst, um verkaufsaktiv agieren zu können? Welche Mitarbeiterprofile und persönliche Fähigkeiten der Mitarbeiter sind erforderlich, um dem verkaufsaktiven Anspruch gerecht zu werden?
Wichtige Fragen, für die ich in diesem Buch versuche eine Antwort für Sie bereit zu stellen. Sollten Sie Fragen oder Anmerkungen haben, nehmen Sie Kontakt mit mir auf ([email protected]).
Ich wünsche Ihnen viel Spaß und hoffentlich neue Erkenntnisse bei der Lektüre dieses Buches.
Dortmund, November 2017
1. Vertrieb 4.0
Der Vertrieb hat sich gerade in der letzten Dekade durch den Einsatz digitaler Werkzeuge weltweit verändert, je nach Branche in unterschiedlicher Intensität und Schnelligkeit. Die Konsumgüterbranche beispielsweise muss sich schon seit Jahrzehnten mit einem harten Konzentrations- und Verdrängungswettbewerb auseinandersetzen. Jetzt herrschen auch in Branchen wie der pharmazeutischen Industrie oder der Energiewirtschaft veränderte Spielregeln. In den meisten Branchen liefen die Veränderungen nach folgendem Muster:
Boom
Umsatz- und Ertragsentwicklung kannten nur eine Richtung: nach oben. Führung und Mitarbeiter schrieben den Erfolg ihrem eigenen Handeln zu. Erinnern Sie sich noch an den Mobilfunk-Markt der neunziger Jahre? Die Mitarbeiter gingen schiefen Schritts – zu intensives Schulterklopfen erzeugt auf Dauer Schräglagen – durch den Markt. In vielen Unternehmen entwickelte sich ein unkontrolliertes Wachstum. Strategische Ansätze waren nicht unbedingt erforderlich, um Vertriebserfolge zu erzielen. Folgen dieser Wachstumsorientierung waren unter anderem: Es wurden hierarchische Strukturen aufgebaut, die Zahl der Vertriebsmitarbeiter ständig erhöht, Ablaufprozesse wurden nicht kundenorientiert ausgerichtet, Wachstum wurde zu dem Maßstab.
Ausrichtung des Innendienstes: reaktives Handeln im Kundenmanagement.
Selektion
Das „Verteilen“ von Produkten und Dienstleistungen reicht nicht mehr aus, um im harten Wettbewerb zu bestehen. Durch Konzentrationsprozesse haben sich die globalen Wettbewerbsbedingungen verändert, Unternehmen befinden sich in einem Selektionsprozess und trennen die Spreu vom Weizen. Kunden trennen sich zunehmend von C-Lieferanten, Produktzyklen werden immer kürzer, Leistungen und Produktangebote von Anbietern immer vergleichbarer. Die Folgen sind unter anderem: quantitatives Wachstum ist oftmals nur noch durch Verdrängungswettbewerb möglich, die Balance zwischen quantitativem und qualitativem Wachstum wird immer wichtiger, um den Erhalt von Unternehmen zu sichern. Unternehmen starten Fitness-Kuren und überprüfen die vorhandene Effektivität und Effizienz der Vertriebsprozesse und konzentrieren sich auf die Aktivitäten und Mitarbeiter, die nachhaltig zur Wertschöpfung beitragen können.
Ausrichtung des Innendienstes: Reduktion der administrativen Ausrichtung und Stärkung des verkaufsaktiven Parts.
Vertrieb 4.0
Vertrieb 4.0 ist ein kontinuierlicher Prozess mit einem wichtigen Ziel: Die Vernetzung von Maschinen, Menschen, Unternehmen et cetera. In rasantem Tempo verändern sich die Formen, wie Kunden sich informieren, recherchieren und kaufen. Durch digitale Prozesse können aus einer Masse unstrukturierter Informationen in Echtzeit Informationen zur Verfügung gestellt und das steigende Transparenz- und Informationsbedürfnis von Kunden befriedigt werden. Die Folge: Geschäftsmodelle und Unternehmensstrukturen müssen angepasst und Veränderungsprozesse gestartet werden.
Das Internet der Dinge (Industrie 4.0) beispielsweise prägt die Innovationen der Zukunft. Nicht mehr die Entwicklung von Produkten oder Dienstleistungen stehen im Vordergrund, sondern die digitalisierte und automatisierte Erfassung und Analyse von Informationen, der gezielte Aufbau eines mobilen Internets, oder der Ausbau von digitalen Werkzeugen, zum Beispiel dem 3 D-Druck.
Das Vertriebsmanagement der Zukunft wird verstärkt über Plattformen abgewickelt werden, egal ob es sich um Dienstleistungen, Services oder der Kundensteuerung handelt. In den USA nutzen zum Beispiel 90 % der Unternehmen im Bereich B2B inzwischen den Internet - Auftritt als direktes Vertriebsinstrument. Es werden zunehmend schnelle und flexible Newcomer Markttrends setzen. Vertrieb 4.0 wird dazu führen, dass die Kundenorientierung in den Unternehmen einen bisher nicht bekannten Stellenwert erhält und Innovationskraft und Flexibilität in den Kundenmanagementprozessen zu den Erfolgsfaktoren werden.
Ausrichtung des Innendienstes: der verkaufsaktive Innendienst wird zu einem wichtigen und gleichwertigen Baustein innerhalb eines Multi-Channel-Vertriebs und übernimmt Aufgaben, die früher durch den Außendienst verantwortet wurden. Der Innendienst-Mitarbeiter wird zunehmend zu einem verkaufsaktiven Markt- und Kundenmanager, ausgestattet mit den notwendigen fachlichen Fähigkeiten und hierarchischen Kompetenzen.
Bei der Weiterentwicklung einer Vertriebsorganisation muss der „Reifegrad“ eines Unternehmens berücksichtigt werden.
1.1. Kundenmanagement in der digitalen Welt
Der Vertrieb ist aus meiner Sicht immer noch eine Blackbox. Einem rechnerischen Vertriebsaufwand, der oftmals durch zweifelhafte Gemeinkosten be- oder entlastet wird, steht ein rechnerischer Vertriebserfolg gegenüber, der ebenfalls durch interne Gemeinkosten beeinflusst wird. Durch die meist fehlende Prozesskostenrechnung ist die Leistung des Vertriebs in vielen Unternehmen nur bedingt messbar. Durch Gemeinkostenschlüssel werden Erfolgs- und Kostentreiber nicht ausreichend identifiziert mit der Folge, dass der Erfolg eines Vertriebsmitarbeiters oder der Ertrag mit einem einzelnen Kunden nur unzureichend herausgefiltert werden kann.
In der Vergangenheit hatte der Außendienst die Deutungshoheit im Umgang mit den Kunden, one face to the customer war die Ausrichtung des Vertriebsmanagements. Diese Zeiten sind vorbei! In der digitalen Welt mit stetig steigender Komplexität ist one team to the customer die einzige Alternative. Meine These:
Vertrieb ist das gesamte Unternehmen, vom Azubi bis zum Management!
Jeder Mitarbeiter eines Unternehmens trägt zum Geschäftserfolg bei. Wenn die Entwicklung keine kundenorientierten Ideen marktfähig macht, ist dies Vertrieb, ebenso wenn die Logistik die Einkaufsabläufe der Kunden bei den eigenen Logistikangeboten nicht berücksichtigt. Leider negativer Vertrieb.
Sinkende Markteintrittsbarrieren und Konzentrationsprozesse werden die Wettbewerbslandschaft in den kommenden Jahren erheblich verändern. Neue Vertriebsformen, vor allem digitaler Art, werden den Kunden erweiterte Möglichkeiten bezüglich Lieferantenauswahl bieten. Diese Entwicklungen werden sich auf den Deckungsbeitrag auswirken. Der Ist-Umsatz eines Kunden bestimmt heute immer noch häufig den Wert eines Kunden. Die Kundenbeziehungskosten je Kunde werden kaum erfasst. Doch was nützt ein Kunde, mit dem zwar ein guter Umsatz getätigt wird, aber Erlösschmälerungen, Herstellkosten und Kundenbeziehungskosten den Ertrag bis zur Null-Linie schmälern.
Der Außendienst steuerte in der Vergangenheit die Art der Marktbearbeitung, die Verteilung von Aufgaben innerhalb der Vertriebsprozesse oder die Entscheidung über das Herangehen an potenzielle Neukunden. Der Verkaufsinnendienst war überwiegend ein Vertrieb zweiter Klasse, mehr „Stapelbearbeiter“ als aktive Verkaufseinheit. Vier Faktoren werden in Zukunft das Management in vielen Branchen dazu zwingen, sich mit der Neuausrichtung der Vertriebsorganisation zu beschäftigen.
Prozesskosten
Die Bestimmung des Kundenwerts wird für die Unternehmen immer wichtiger. Angebotskosten, Betreuungskosten, Werbung und Verkaufsunterstützung, Kosten für Produktmodifikationen oder Sonderentwicklungen beeinflussen die Entwicklung des Deckungsbeitrags. Total cost of ownership gewinnt an Bedeutung. Alle Kosten einer Kundenbeziehung gehören auf den Prüfstand bezüglich Produktivität und Kundenorientierung.
Zeit
Die Kunden wünschen sich einfache Einkaufsprozesse. In einer Zeit von Omni-Channel wollen die Kunden selbst bestimmen, in welcher Form sie mit Anbietern in Kontakt treten wollen. Die Kunden verlangen bei Fragen, Reklamationen oder Erstinformationen zügige Beratungsleistungen durch fachkompetente Mitarbeiter oder informative Online-Angebote. Damit wird es immer wichtiger, Kundenwünsche zu erfragen und die internen Prozesse auf Kompatibilität hin zu überprüfen. Basisvertriebsprozesse müssen – wo immer möglich und von den definierten Kunden gewünscht – standardisiert und automatisiert werden.
Geld
Der Verdrängungswettbewerb führt zu veränderten Deckungsbeiträgen. Bei Besuchskosten des Außendienstes von 150 – 250 Euro je Besuch ist eine Pflege von C-Kunden unter Kundenertragsgesichtspunkten durch den Außendienst in vielen Fällen unrentabel. Die Gewinnung von Neukunden ohne vorherige Kundenpotenzialanalysen ist nicht mehr zeitgemäß. Denn der Außendienst ist in vielen Unternehmen die teuerste Ressource und sollte deshalb überwiegend für Zukunftsprojekte und Investitionskunden eingesetzt werden. Ein Vertriebseinsatz nach dem »Gießkannenprinzip« ist weder sinnvoll noch unter Produktivitätsgesichtspunkten bezahlbar.
Komplexität
Kunden werden durch Konzentrationsprozesse, Internationalisierung, Kundenstrukturen oder unterschiedliche Kundenerwartungen immer komplexer. Eine höhere Kundenkomplexität erfordert aber eine stärkere Verzahnung zwischen Kunden und eigenem Unternehmen. Deshalb muss das Informationsmanagement zwischen den einzelnen Vertriebsaktivitäten verstärkt werden. Die Individualisierung des Kundenmanagements erfordert eine Optimierung eines strategisch ausgerichteten Vertriebseinsatzes.
Was sind Gründe für unbefriedigende Vertriebsergebnisse? Ein wesentlicher Grund ist sicherlich, dass die Vertriebsstrategie und / oder Vertriebsorganisation nicht auf die veränderten Rahmenbedingungen ausgerichtet sind. Die Ausrichtung der Vertriebsstrategie auf die Kundenbedürfnisse ist nicht immer optimal, der Fokus liegt zu stark auf die Erzielung kurzfristiger Erfolge. Die Kundenzentrierung im Vertrieb ist oftmals immer noch Wunschdenken!
Time to market erfordert eine hohe Professionalität in verschiedenen Bausteinen.
Die Leistungsangebote sind aus Kundensicht „unbefriedigend“, weil Kundenbedürfnisse nicht ausreichend berücksichtigt werden. Das liegt unter anderem an den fehlenden Kundeninformationen im Kundenmanagement, über das Geschäft und die Kundenbedürfnisse und den Nutzenbeitrag der eigenen Leistungen aus Kundensicht. Die Kunden wünschen sich Beratungskompetenz (Lösungen statt Produkte) von den Anbietern. Notwendig in den Unternehmen sind eine höhere Professionalität, um Kundenbedürfnisse zu erkennen und zu verstehen und eine höhere Geschwindigkeit und Flexibilität bei der Umsetzung von Entscheidungen. Erforderlich ist eine
Kundenmehrwertorientierte Dienstleistungsbereitschaft!
1.2. Das veränderte Einkaufsverhalten der Kunden
Die Kundenerwartungen an die Lieferanten verändern sich gravierend, unabhängig von B2C oder B2B. Nicht die Anbieter bestimmen die Spielregeln der Beschaffung, die Nachfrager entscheiden! Wer sich als Anbieter nicht auf diese veränderten Spielregeln einlässt, wird zu Verlierern der Zukunft gehören. Was wünschen sich die Kunden zum Beispiel?
Erwartung der Kunden im B2C
Die Kunden möchten für sie wichtige Informationen unkompliziert und zeitnah erhalten, zum Beispiel Produktinformationen, Produktverfügbarkeit, Ladenöffnungszeiten et cetera. Persönlich oder digital im Netz. Sie wünschen sich eine qualifizierte Beratung, ebenso Offline oder Online. Und ein weiterer Trend setzt sich immer stärker durch: Sie möchten die Leistungen nutzen statt sie zu kaufen. Dies verlangt seitens der Unternehmen eine gezielte Vernetzung von Online und Offline und eine Individualisierung der Produkte und Dienstleistungen.
Erwartung der Kunden im B2B
In der Vergangenheit lag der Fokus des Einkaufs auf operativen Tätigkeiten und er wurde nur bedingt durch die IT unterstützt. Heute ist der Einkaufserfolg ein wichtiger Strategiebaustein in der Steuerung von Unternehmen. Einkauf ist inzwischen das gesamte Unternehmen geworden, jeder Unternehmensbereich ist aufgefordert, strategische Wertschöpfungspotenziale zu identifizieren und zu generieren. Der Einkauf ist bei der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle beteiligt und deshalb daran interessiert, den Aufbau von Partnerschaften mit ausgesuchten Lieferanten zu verstärken (Preis ist nicht alles!) und sie in die eigene Wertschöpfungskette einzubinden (Total Cost of Ownership).
Der Einkauf wird unterstützt durch Cross-funktionale Experten. Damit steigt die Komplexität in den Einkaufsprozessen. Der Vertrieb muss sich mit einem Mix aus Zentraleinkauf und dezentralem Einkauf auseinandersetzen. Die Anzahl der Beteiligten im Entscheidungsprozess steigt, bei 50 % der Entscheidungen sind inzwischen Ø drei Mitarbeiter beteiligt, bei 38 % der Entscheidungen Ø vier bis sieben Mitarbeiter, und immer häufiger klinkt sich das Management in Einkaufsprozesse ein.
Professionelle Einkäufer intensivieren die Suche nach Lieferanten und investieren Zeit in die Lieferantenauswahl. Dabei nutzen sie verschiedenste Informationsquellen und Analysetechniken, zum Beispiel Lieferantensegmentierung, um detaillierte Wirtschaftlichkeitsanalysen durchzuführen und Entscheidungszyklen festzulegen. Die Anforderungen an den Einkauf im Bereich B2B sind unter anderem:
Sicherung von Bezugsquellen.
Bestandsreduzierung und reduzierte Kapitalbindung.
Reduktion der Qualitätskosten.
Zeitgemäße Innovationen.
Sicherung von Alleinstellungsmerkmalen.
Durchsetzen von Regressansprüchen wegen Qualitätsmängeln.
Reduzierung der Verwaltungskosten durch schlanke Einkaufsprozesse.
Reduzierung der Fehlmengenkosten.
Reduktion der Lieferantenzahl.
Bedarfsbündelung.
Abschluss von Rahmenverträgen.
Vereinfachung von Bestellverfahren.
Ein Vertrieb, der nicht die Prozesse der wichtigen Kunden im Blick hat läuft Gefahr, ihnen nicht „auf Augenhöhe“ zu begegnen!
1.3. Die Neuausrichtung der Vertriebsorganisationen
Vertrieb 4.0 verlangt nach organisatorischen Veränderungen im Kundenmanagement. Die Anzahl der Vertriebsmitarbeiter ist nicht mehr entscheidend für den Vertriebserfolg, sondern die Mitarbeiterqualität. Klasse statt Masse! Gerade in einer digitalen Welt wird der Mensch immer wichtiger. Vertrieb bleibt People Business. Aber: Unternehmen müssen in Zukunft verstärkt entscheiden, ob sie in digitale Prozesse oder in Mitarbeiter investiert. Alle immer wiederkehrenden Prozesse werden zunehmend digitalisiert, standardisiert und automatisiert. Es ist damit zu rechnen, dass die Anzahl der Mitarbeiter im Vertrieb in den kommenden Jahren in vielen Branchen oder Unternehmen eher ab- als zunehmen werde. Dies ist der Digitalisierung geschuldet. Und gerade der administrative Innendienst ist aus meiner Sicht auf der Liste der „gefährdeten Arten“.
Notwendig ist eine Verlagerung von Außendienst-Aufgaben an den verkaufsaktiven Innendienst. Schnittstellen zwischen Außen- und Innendienst müssen überprüft und Aufgaben gebündelt werden. Der Verwaltungsaufwand im Vertrieb ist oftmals zu hoch und muss reduziert werden. Unternehmen müssen sich mit dem Markt und seinen Kunden beschäftigen und nicht mit sich selbst.
Die Vertriebsaktivitäten müssen ganzheitlich über einen Multi-Channel-Vertrieb gesteuert werden mit klaren Vertriebszielen für alle kundennahen Bereiche. Innen- und Außendienst werden zu Profit-Centern (auch persönlich) und müssen ihren Mehrwert für das eigene Unternehmen und die Kunden täglich unter Beweis stellen. Erforderlich ist natürlich eine gezielte Entwicklung der Mitarbeiter, fachlich und mental.
Es wird eine interessante Zeit in den kommenden Jahren und jedes Unternehmen hat es selbst in der Hand, ob es zu Gewinnern oder Verlierern gehören wird.
2. Die Festlegung strategischer Vertriebsziele
Ich stelle immer wieder fest, dass die Vertriebsmitarbeiter nicht wissen, für welche Ziele sie sich einsetzen sollen. Dies ist aber unabdingbar bei der Neuausrichtung einer Vertriebsorganisation. Ein verkaufsaktiver Innendienst muss beispielsweise wissen, welchen Beitrag er zur Erreichung der strategischen Vertriebsziele leisten kann oder soll. Es muss bei der Festlegung strategischer Vertriebsziele unter anderem geklärt werden:
Vertriebsziele in den kommenden Jahren.
Aufgaben und Anforderung an das Vertriebsmanagement.
Organisation des Außen- und Innendienstes.
Erforderlichen Mitarbeiterfähigkeiten in der Zukunft.
Bereitstellung notwendiger Ressourcen.
Vernetzungsgrad innerhalb des eigenen Unternehmens und mit den Kunden.
NLP, Visionsdenken und totale Begeisterung werden immer noch zu einem intellektuellen Brei vermengt und sind in vielen Fällen Placebo-Methoden. Gemeinsam erarbeitete Visionen und Werte sind grundsätzlich nicht negativ in einer auseinander driftenden Wertewelt, in der Egoismus das WIR zunehmend ersetzt. Ich habe aber Zweifel, dass Visionen und Wertediskussionen für eine vertriebsstrategische Ausrichtung im harten Wettbewerb ausreichen. In erster Linie geht es immer um die erfolgreiche, konkrete und stets zu optimierende Auseinandersetzung mit dem Wettbewerb bei kritischer Begutachtung durch die Kunden. Vertriebsziele legen die Route und Meilensteine fest, an denen die Ist-Situation überprüft und bei Änderungen der Rahmenbedingungen Justierungen vorgenommen werden.
Jede Organisation unterliegt einem Reifezyklus – von der Idee einer Unternehmensgründung bis zur Aufgabe der Geschäftstätigkeit. Vertrieb 4.0 erfordert ein ausgeprägtes Veränderungsmanagement unter Berücksichtigung des „Reifegrades“ einer Organisation. Nicht selten kommt es zu Diskrepanzen zwischen den Wunschvorstellungen des Managements und der Umsetzung in der Organisation. Beispiele:
Der Innendienst soll eigenverantwortlich definierte Kundengruppen bearbeiten. Der Außendienst ist allerdings nicht bereit, sich Entscheidungen aus der Hand nehmen zu lassen. Wenn das Management keine klaren Spielregeln für die Marktbearbeitung aufstellt, sind die Spannungen innerhalb der internen Organisation vorprogrammiert.
Der Innendienst erstickt seit vielen Jahren an Regelungen und Vorgaben. Um die Flexibilität im Innendienst zu erhöhen, werden die Kompetenzen neu geregelt. Der Innendienst hat aber nicht gelernt, Eigenverantwortung zu übernehmen und lehnt dies auch aus Bequemlichkeitsgründen ab. Wenn jetzt nicht ein Weg gefunden wird, das Team auf dem Weg zu mehr Eigensteuerung mitzunehmen und das Unternehmen bereit ist, sich von nicht änderungswilligen Mitarbeitern zu trennen, sind dauerhafte Grundsatzdiskussionen vorprogrammiert.
Um sich als Unternehmen weiterhin erfolgreich am Markt zu behaupten wurde entschieden, eine Aufgabenverteilung zwischen Innen- und Außendienst vorzunehmen. Wenn das Vertriebsteam nicht bereit ist, den Veränderungsprozess zu akzeptieren, wird es versuchen, diesen mit Argumenten und trickreichen Spielchen zu umgehen und ein Kampf zwischen Innen- und Außendienst beginnt.
2.1. Der Reifegrad von Vertriebsorganisationen
Ob ein Unternehmen sich in einer Wachstums- oder Alterungsphase befindet, kann unter anderem an zwei Parametern festgemacht werden:
Flexibilität und Dynamik des Unternehmens.
Regeln und Strukturen des Unternehmens.
Typisches Verhalten in Wachstumsphasen
Vertriebsteams in Wachstumsphasen zeichnen sich durch ein hohes Maß an Dynamik aus, sie passen sich den Kunden und Märkten schnell und unkonventionell an. Die Umsetzung von Ideen steht im Vordergrund. Nachteil: Die Regeln in der Organisation werden situativ gehandhabt, gehandelt wird auf dem „kleinem Dienstweg“, Regeln und Strukturen werden eher als ›Bedrohung‹ empfunden. Die Folge dieser Vorgehensweise sind unstrukturiertes Handeln und Aktionismus, unter dem langfristig die Flexibilität und Dynamik leidet. Erforderlich ist in Wachstumsphasen die konsequente Einführung von Spielregeln und Strukturen, um die limitierten Ressourcen optimal zu nutzen
Eigenarten in Alterungsphasen
Vertriebsteams in Alterungsphasen arbeiten in zu umfassenden Strukturen, alles ist durchgeplant und bürokratisiert. Die Meeting-Kultur ist sehr ausgeprägt, für jeden Prozess werden Regeln aufgestellt und protokolliert. Die Unternehmen beschäftigen sich zu viel mit sich selbst und zu wenig mit dem Markt und den Kunden. In der Alterungsphase stehen die Strukturen im Vordergrund, die Bestimmung und Einhaltung der Ablaufprozesse bestimmen den Alltag, alles soll möglichst reproduzierbar sein.
Die Balance zwischen „Struktur“ und „Flexibilität“
In Wachstums- oder Alterungsphasen sind bestimmte „Probleme“ typisch. Die mit dem Wandel verbundenen „Probleme“ gehören zur Entwicklung einer Vertriebsorganisation. Erst wenn Unternehmen einen Veränderungsprozess nicht in den Griff bekommen, haben sie k.o.-Probleme, die eine Weiterentwicklung blockieren oder behindern. Das Ziel einer jeden Vertriebsorganisation muss es sein, die Flexibilität und Dynamik zu erhöhen und gleichzeitig adäquate Strukturen und Regeln zu schaffen. In Wachstumsphasen sind Regeln und Strukturen eher unterentwickelt, Flexibilität und Dynamik beherrschen den Vertriebsalltag. In Alterungsphasen dominieren Strukturen und Regeln den Vertriebsalltag, darunter leiden dann Flexibilität und Dynamik. Das Motto muss lauten: Soviel Flexibilität und Dynamik wie möglich, soviel Strukturen und Regeln wie nötig.
Die Balance zu finden zwischen Flexibilität und Struktur zur Neuausrichtung des Innen- und Außendienstes ist eine hohe Kunst. Hilfreich ist die Professionalisierung in folgenden Bereichen:
Unternehmensstrategie:
Unternehmen erreichen oder sichern dann einen dauerhaften Erfolg, wenn sie eine klare Strategie formulieren und diese langfristig verfolgen.
Unternehmensstruktur:
Erfolgreiche Unternehmen bauen, wo immer möglich, Bürokratie ab, um ihre Mitarbeiter und Kunden nicht zu verprellen und den Fortschritt nicht zu behindern.
Unternehmenskultur:
Unternehmen arbeiten dann auf höchstem Niveau, wenn die Mitarbeiter klare Werte und Ziele kompromisslos verfolgen und nicht nach „Befehl und Kontrolle“ arbeiten.
Strategieumsetzung:
Gewinnerunternehmen setzen ihre Strategie durch den Einsatz professioneller Methoden und Werkzeuge unter Beachtung des Kundenwerts und eigener Ressourcen konsequent um.
Innovationen:
Innovative Unternehmen erkennen Trends frühzeitig, richten ihre gesamten Unternehmensleistungen darauf aus und konzentrieren sich ausschließlich auf Erfolg versprechende Bereiche.
Partnerschaften:
Gewinner nutzen gezielt Fusionen und Partnerschaften, um sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren.
Talentförderung:
Top-Unternehmen betreiben eine gezielte Mitarbeiterförderung und investieren langfristig in die Personalentwicklung.
Führungsstärke:
Erfolgreiche Unternehmen schaffen Freiräume für ihre Mitarbeiter und fördern die Kreativität zur Gestaltung neuer Ideen.
Legen Sie die folgenden Punkte fest:
Unternehmensstrategie
Mission:
Beschreiben Sie, welchen Mehrwert Sie grundsätzlich mit ihren Unternehmensleistungen - Produkte und Dienstleistungen - der Gesellschaft oder den Kunden bieten wollen.
Werte:
Legen Sie die Werte und ethischen Grundsätze fest, mit denen Ihr Unternehmen nach innen (Mitarbeiterführung et cetera) und außen (Compliance et cetera) handelt.
Langfristige strategische Unternehmensziele:
Formulieren Sie Ziele und Kennzahlen, um nach innen und außen die Stoßrichtung Ihres Unternehmens zu dokumentieren.
Vertriebsstrategie
Positionierung:
Leiten Sie die Positionierung aus der Unternehmensstrategie ab und beschreiben, was Ihr Unternehmen aus Kundensicht einzigartig macht gegenüber anderen Anbietern.
Wettbewerbsbestimmung:
Moderne Vertriebsorganisationen attackieren nicht den Wettbewerb, sondern weichen ihm aus. Durch Mehrwertkonzepte anders zu sein aus Kundensicht ist die Kunst der Zukunft.
Marktanalyse
Strategische Geschäftsfelder:
Bestimmen Sie die strategischen Geschäftsfelder, in denen sie sich aktiv bewegen und identifizieren gleichzeitig Geschäftsfelder, die sie zukünftig nicht mehr oder nur reaktiv bearbeiten werden.
Zielkunden:
Definieren Sie die potenziellen Zielkunden innerhalb der strategischen Geschäftsfelder.
Ressourcenprüfung
Personal:
Legen Sie fest, welche Personalressourcen Ihr Unternehmen grundsätzlich in Zukunft benötigt (Anzahl, Fähigkeiten et cetera).
IT:
Prüfen Sie, welche IT – Ressourcen sie zukünftig benötigen (Hardware, Software, Spezialisten etc.) und budgetieren diese Ressourcen.
Planung
Vertriebskanäle:
Bestimmen Sie die grundsätzlichen Vertriebskanäle, mit denen Sie in Zukunft die Kunden erreichen wollen.
Produkte / Leistungen:
Legen Sie die Produkte und Leistungen fest, mit denen Sie in Zukunft Mehrwert für die potenziellen Kunden bieten wollen.
Umsetzung
Multi Channel- Aktivitäten:
Clustern Sie die Vertriebsaktivitäten unter Berücksichtigung der Kundenanforderungen und des Kundenwerts und legen fest, wer innerhalb des Vertrieb und Marketings 4.0 für welche Aktivitäten / Kunden verantwortlich ist (Key Account Management, Außendienst, verkaufsaktiver Innendienst, Online - Vertrieb et cetera).
Leitfaden zur Entwicklung einer Vertriebsstrategie.
Ich habe Sie im vorherigen Text auf die Notwendigkeit hingewiesen, dass teilweise die Geschäftsmodelle überprüft und eventuell neu ausgerichtet werden müssen. Dies betrifft zum Beispiel die folgenden Bereiche:
Digitale Produkte und Services
Analyse der Kundenwünsche und Kundenbedürfnisse durch Small Data oder Big Data.
Überprüfung, ob eventuell für Bereitstellung der Leistungen Partner eingebunden werden müssen.
Entwicklung geeigneter digitaler Medien, zum Beispiel Apps, mit denen Kunden oder Interessenten Informationen über Produkte und Leistungen erhalten können.
Unterbreitung gezielter Angebote um Kunden und Interessenten zu gewinnen.
Digitale Bestellprozesse
Digitale Kundenerlebnisse.
Gewinnung und Analyse von Kundendaten.
Überprüfung, mit welchen digitalen Werkzeugen den Kunden und Interessenten die Kommunikation mit dem eigenen Unternehmen und die Nutzung der Produkte und Dienstleistungen vereinfacht werden können.
Entwicklung digitaler Angebote für „emotional“ aufgeladene Kundenbedürfnisse, zum Beispiel in den Bereichen Reklamationsmanagement, Feedback-Systeme oder problemlose Informationsgewinnung.
Einbindung der Kunden und Interessenten in die Weiterentwicklung digitaler Konzepte.
Digitale operative Exzellenz
Überprüfung, welche Aufgaben und Tätigkeiten im Unternehmen standardisiert und automatisiert werden können.
Analyse, welche Auswirkungen – Vorteile und Nachteile – die Digitalisierung von Prozessen für Kunden und Interessenten haben werden.
Festlegung geeigneter digitaler Werkzeuge, zum Beispiel EDI, Apps, Intranet und Extranet.
Regelmäßige Überprüfung, wie die Werkzeuge von den Kunden und Interessenten angenommen werden.
Der Erfolg eines Unternehmens wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst.
Wichtig ist neben der Festlegung eigenzentrierter strategischer Vertriebsziele die Entwicklung kundenmehrwertorientierter Vertriebsziele. Wie können Sie Ihre Kunden in deren individuellen Umfeld besser machen? Das ist der einzige Daseinszweck eines Unternehmens: Kunden „besser“ zu machen. Wenn dies nicht den potenziellen Kunden verdeutlicht werden kann, ist ein Unternehmen Commodity. Und Commodity-Unternehmen sind jederzeit ersetzbar!
2.2. Der kennzahlengesteuerte Vertrieb
Einen Grundsatz sollten Unternehmen immer beherzigen:
Kein Ziel ohne Kennzahl, keine Kennzahl ohne Ziel!
Das Vertriebscontrolling ist auf Wirtschaftlichkeitskontrolle und auf die Sicherstellung einer marktorientierten Vertriebsführung ausgerichtet. Die Aufgabe des Vertriebscontrollings ist die Steuerung von Lernprozessen und Professionalisierung im Vertrieb, zum Beispiel durch Benchmarking vergleichbarer Vertriebsprozesse und Steuerung der Marketing- und Vertriebsaktivitäten. Die Aufgabe des Vertriebscontrollings ist es, eine bessere Balance zwischen den Aktivitäten heute und dem Markt von morgen herzustellen und vernetzt Zukunftsentscheidungen mit periodenorientierten Kennzahlen zu treffen. Ein professionelles Vertriebscontrolling führt dazu, dass Unternehmen ihre Ziele und die zur Verfügung stehenden Ressourcen besser abstimmen können. Typische Fragen des Vertriebscontrollings sind:
Bestandsaufnahme:
Wo stehen wir?
Strategische Planung:
Wo wollen wir hin?
Taktische Planung:
Wie schaffen wir das?
Positionierung:
Produkte und Dienstleistungen, Kunden, Wettbewerb et cetera.
Kritische Erfolgsfaktoren:
Welche Aktivitäten gewährleisten Erfolg?
Marketingziele:
Veränderung der Positionierung?
Umsatz- und Ressourcenplanung / -prognose:
Budgetplanung, zukünftige Ressourcen, notwendige Prozesse?