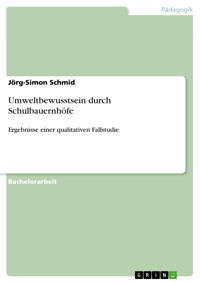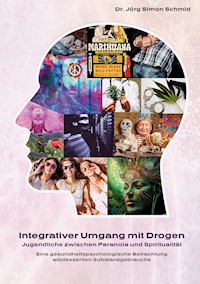
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In seiner Dissertation 'Integrativer Umgang mit Drogen - Jugendliche zwischen Paranoia und Spiritualität' untersucht Dr. Jörg-Simon Schmid die langfristigen Auswirkungen des Konsums legaler und illegaler psychoaktiver Substanzen auf die Gesundheit Jugendlicher und junger Erwachsener. Als Datengrundlage dienen biographische Interviews, die über einen Zeitraum von 8 Jahren innerhalb der RISA-Langzeitstudie erhoben wurden. Leitende Fragestellungen sind unter anderem: - Was sind die größten Herausforderungen, mit denen sich Jugendliche im Umgang mit psychoaktiven Substanzen konfrontiert sehen? - Welche Bewältigungs-Strategien entwickeln sie? - Und schließlich: Welchen langfristigen Sinn sehen die jungen Menschen in ihren Erfahrungen mit Substanzen? Die empirischen Ergebnisse eröffnen einen einzigartigen Einblick in einen der nach wie vor am stärksten tabuisierten Lebensbereiche unserer Gesellschaft: Jugendliche und Drogen ------------------------------ Rezensionen 'Eine beherzte und anspruchsvolle empirische Arbeit, in denen der Autor den adoleszenten Substanzgebrauch aus überraschend innovativen Perspektiven beleuchtet.' (Prof. Dr. Gundula Barsch: Hochschule Merseburg - Fachbereich Drogen und Soziale Arbeit) 'Ein Perspektivwechsel von einer pathologisierenden, defizitorientierten Betrachtungsweise des Substanzkonsums im Jugendalter hin zu einer Sichtweise, die einen verantwortungsbewussten, auf langfristigen Erhalt und Steigerung der Gesundheit angelegten Umgang mit psychoaktiven Substanzen in den Mittelpunkt stellt. Der Arbeit ist eine weite Verbreitung im Forschungsfeld zu wünschen.' (Prof. Dr. Nicolle Pfaff: Universität Duisburg-Essen - Fakultät für Bildungswissenschaften) 'Der Hauptvorteil des entwickelten Modells besteht darin, Drogengebrauch nicht von einem negativen klinischen Ende her zu denken, sondern die Möglichkeit zuzulassen, Drogengebrauch auch von seinem Gelingen her zu denken.' (Dr. Henrik Jungaberle: Leiter der RISA Studie)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 969
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
„Die globalisierte Wissensgesellschaft von morgen erfordert in zunehmendem Maße Forschungsbemühungen interdisziplinären Zuschnitts. Denn immer deutlicher wird, dass sich der Fortschritt in der Wissenschaft an den Grenzen beziehungsweise an den Schnittstellen zwischen den Disziplinen vollzieht.“ (DFG 2004)
„Wenn jemand Autofahren lernt, muss er sich zuerst einmal bewusst machen, was alles passieren kann; er muß alle die Gefahrensignale an seinem Armaturenbrett und auf der Straße hören, sehen und verstehen lernen. Aber er kann doch hoffen, daß er dieses Stadium des Lernens einmal überwunden haben und dann ganz bequem durch die Landschaft gleiten und die Aussicht genießen wird, im vollen Vertrauen darauf, dass er auf alle Anzeichen von Störung im Getriebe oder von Verkehrshindernissen automatisch und hinreichend rasch reagieren wird.“ (Erik H. Erikson 1973: 121)
Vorwort
Drogen integrativ denken. Dies ist ein wesentliches Anliegen vorliegender Arbeit. Mit Hilfe inter- und transdisziplinärer Perspektiven über den pathologischen Tellerrand hinauszudenken und den Umgang mit Drogen vom Gelingen und von seinen Möglichkeiten her zu denken. Denn: „Höher als die Wirklichkeit steht die Möglichkeit.“ (Heidegger - Sein und Zeit S.38)
Diese Erkenntnis zieht sich in Form des explorativen Forschungsstils wie ein roter Faden durch diese Arbeit. Sie ist in diesem Fall auch besonders dringlich notwendig. Denn die „Wirklichkeit“ ist seit Jahrzehnten durch pathologische und einseitig missbrauchsfixierte Perspektiven stark verzerrt. Ein authentischer Einblick in die drogenbezogene Lebenswelt Jugendlicher – d.h. Menschen zwischen 14 und 25 Jahren (UNPY 2017) - aufgrund damit verbundener Tabuisierung und Stigmatisierung bis heute nur schwer möglich.
Ich möchte sie daher einladen auf eine explorative Reise durch den unerforschten Dschungel des integrativen Umgangs mit Drogen bei Jugendlichen. Eine Reise die durch die Biografien 14 Jugendlicher führen wird. Durch die tiefen Täler unerwünschter Nebenwirkungen, die labyrinthartigen Pfade der Paranoia, die weit verzweigten Wälder der Bewusstseinserweiterung bis auf die sonnenüberfluteten Gipfel spiritueller Peak-Erfahrungen. Eine Reise voller Abenteuer und Gefahren, für mich als Autor, aber auch für die Jugendlichen als den heimlichen Helden, die diese Reise erst ermöglichten.
Die größte Gefahr für mich als Autor bestand vor allem darin, gesundheitsorientiert über einen der am stärksten tabuisierten Gesellschaftsbereiche zu schreiben - Drogen und Jugendliche. „Vielleicht sollte man wissenschaftlich nicht einmal mehr von ‚Drogen‘ sprechen, da dieser Begriff irrational aufgeladen scheint und normative Blindheit auslösen kann“, geben Jungaberle et al (2018: 6) zu bedenken. Gerade im Kontext von Jugendlichen dürfte dies vollumfänglich zutreffen. Es gleicht einem Drahtseilakt, diesen Themenkomplex einerseits von der Möglichkeit seines Gelingens her zu betrachten und andererseits nicht in einseitig positive Deutungsmuster zu verfallen, die sowohl der Sensibilität der Thematik nicht gerecht werden würden als auch unnötige „normative Blindheit“ provozieren könnten. Vor dem Hintergrund einer sicherlich überwiegend erwachsenen, akademisch gebildeten und an neuen Einsichten interessierten Leserschaft, lag es nahe, die paradigmatische Waagschale im Zweifel eher mit optimistischen und gelingenden Szenarien zu füllen, um sie so wieder etwas weiter in Richtung einer Balance zu bewegen. Oder wie Winston Churchill sagen würde: “A pessimist sees the difficulty in every opportunity; an optimist sees the opportunity in every difficulty.”
Wer bereit ist, sich auf dieses Abenteuer einzulassen, den erwarten vor allem im ausführlichen Ergebnisteil dieser Arbeit (+ Anhang) einzigartige und authentische Einblicke in die verborgene Lebenswelt Jugendlicher. Der Diskussionsteil überrascht darüber hinaus mit überwiegend konstruktiven und teilweise exotischen Perspektiven, die auf dem Theorieteil aufbauen und neben einer gewissen Offenheit auch eine Portion salutogenetischen Optimismus benötigen, um sie vom Gelingen her betrachten zu können. Seien es Verbindungen zwischen Werten, Persönlichkeitseigenschaften und chemischen Substanzen, Entwicklungsaufgaben und Grundbedürfnissen, Repression und Paranoia, oder Berauschung und Spiritualität.
Zusammen mit der Exploration von Möglichkeiten sind es gerade jene Verbindungen, die diese Arbeit charakterisieren und von Anfang an durchziehen. Was dies mit der im Titel erwähnten - und erst recht spät im Forschungsprozess „auftauchenden“ - Spiritualität zu tun haben könnte, mag eine Frage sein, die in Ihnen vielleicht das Interesse erweckt weiterzulesen.
Köln, im Dezember 2022 Jörg-Simon Schmid
Inhalt
Vorwort
Einleitung
1.1 Ziele der Arbeit
1.2 Aufbau der Arbeit
Theoretische Grundlagen der Konzeptualisierung des Integrativen Umgangs
2.1 Modell der Integration (Jung 2006)
2.2 Zum Begriff der Integration
2.2.1 Integration im allgemeinen Sprachgebrauch
2.2.2 Integration aus psychologischen Perspektiven (Jung 2006)
2.2.3 Integraler Ansatz
2.3 Bewusstsein
2.4 Drogen & Psychoaktive Substanzen (PAS)
2.5 Gesundheitspsychologische Ansätze
2.5.1 Health-Belief-Model
2.5.2 Salutogenese und Kohärenzgefühl nach Antonovsky
2.5.3 Grawes Konsistenztheorie
2.5.4 Synthese von Kohärenz- und Konsistenztheorie
2.6 (Sozial-)psychologische Ansätze
2.6.1 Theorie des sozialen Vergleichs
2.6.2 Theorie der kognitiven Dissonanz
2.6.3 Stress-Coping-Modell
2.6.4 Sozial-kognitive Lerntheorie/ Modell-Lernen
2.6.5 Selbstwahrnehmung vs. Fremdwahrnehmung
2.7 Entwicklungspsychologische und soziokulturelle Ansätze
2.7.1 Drug, Set und Setting
2.7.2
Maturing out/ Arranging with
- „Drogenkonsum im bürgerlichen Milieu“
2.7.3 Das Sozialisationsmodell
2.7.4 Biographieforschung
2.7.5 Drogen als Entwicklungsaufgabe & Typologie adoleszenter Haltungen zu Drogen
2.7.6 Der ökosystemische Ansatz (Bronfenbrenner)
2.8 Persönlichkeit & Identität
2.8.1 Persönlichkeit
2.8.2 Identität
2.8.3 Reflexion, Synthese & „erweitertes Drogenpostulat“
2.9 Werte – Funktionen und Bedingungen ihrer Entstehung
2.9.1 Definitionen und Funktionen von Werten
2.9.2 Das sozialwissenschaftliche Wertemodell von Schwartz
2.9.3 Integrales Werteverständnis (Ken Wilber und Spiral Dynamics)
2.9.4 Akzeptanz und Commitment Therapie (ACT)
2.9.5 Entstehung von Werten
2.9.6 Zusammenfassung
2.9.7 Reflexion & Synthese
2.10 Spiritualität – Ein besonderer Wert
2.11 Rausch und Ekstase
2.12 Sucht, biopsychosoziales Modell & Akzeptanzansatz
2.13 Zusammenfassung und Synthese im erweiterten Modell der Integration
Methodenteil
3.1 Methodologie
3.2 Allgemeine Gütekriterien qualitativer Forschung
3.3 Erschließung des Forschungsfeldes
3.4 Erhebungsmethoden
3.5 Auswertungsmethoden
3.6 Synthese der Methoden und ihre Anwendung
Ergebnisse
4.1 Auslösende Bedingungen
4.1.1 Auslösende Bedingungen auf personaler Ebene
4.1.2 Auslösende Bedingungen auf der Mikro-Ebene
4.1.3 Auslösende Bedingungen auf der Exo-Ebene
4.1.4 Auslösende Bedingungen auf der Makro-Ebene
4.2 Integrationsarbeit
4.2.1 Integrationsarbeit auf personaler Ebene
4.2.2 Integrationsarbeit auf mikrosystemischer Ebene
4.2.3 Integrationsarbeit auf exosystemischer Ebene
4.2.4 Integrationsarbeit auf makrosystemischer Ebene
4.3 Unterstützende Bedingungen
4.3.1 Personale Ressourcen
4.3.2 Ressourcen auf der Mikro-Ebene
4.3.3 Ressourcen auf der Exo-Ebene
4.3.4 Ressourcen auf der Makro-Ebene
4.4 Bewertung des Integrationsniveaus
4.4.1 Bewertungen auf personaler Ebene
4.4.2 Bewertungen auf der Mikro-Ebene
4.4.3 Bewertungen auf der Exo- und Makroebene
4.5 Substanzspezifische Zusammenfassung
4.6 Zusammenfassung der Ergebnisse im Modell der Integration
Diskussion 1: Methode und Modell der Integration
5.1 Diskussion des Integrationsmodells und seiner Anwendung
5.2 Diskussion der entwickelten Methoden
Diskussion 2: Integration als Prozess und Zustand
6.1 Biographisch relevante Integrationsanforderungen und der Umgang damit
6.1.1 Personale Ebene und interne Konsistenz
6.1.2 Mikro-, Exo- und Makroebene & externe Konsistenz
6.2 Unterstützende Bedingungen/ Ressourcen
6.2.1 Personale Ressourcen
6.2.2 Ressourcen auf der Mikro-, Exo-, & Makroebene
6.3 Integration 1: Langfristige Instrumentalisierung kurzfr. Substanzwirkungen
6.3.1 Instrumentalisierung im Kontext menschlicher Bedürfnisse
6.3.2 Instrumentalisierung im entwicklungspsychologischen Kontext
6.3.3 Metaphern: Drei beispielhafte integrative Bezugsrahmen
6.4 Integration 2: Substanzunabhängige Integration von veränderten Bewusstseinszuständen
6.4.1 Integration in Form von Werten und Einstellungen
6.4.2 Integration in Form von Wissen, Fähigkeiten und Kompetenzen
6.4.3 Soziale Integration/ Enculturation
6.5 Integration in Form eines „Grundgefühls“?
6.5.1 Identität als konstruktiv erarbeitete und „integrierte Lebensgeschichte“
6.5.2 Das Grundbedürfnis nach Kontrolle und (lustvollem) Kontrollverlust
6.5.3 Spiritualität – Die verbindende Komponente des Grundgefühls
6.5.4 Zusammenfassung und kritische Reflexion
6.6 Desintegrativer Umgang
6.6.1 Sucht und Abhängigkeit
6.6.2 Repression, Kriminalisierung und Stigmatisierung
6.6.3 Identitätsdiffusion und mangelnde integrative Bezugsrahmen
6.6.4 Die (erfolglose) Suche nach Integration
6.7 Fallbezogene Explikation
6.7.1 „Robert“ - Integrativer Umgang auf personaler Ebene
6.7.2 „Judith“ - Integrativer Umgang auf Mikro/ Makro Ebene (akko)
6.7.3 „Anna“ - Integrativer Umgang auf Mikro/ Makro Ebene (assimilativ)
6.7.4 Integrativer Umgang ohne Substanzen
6.8 Zusammenfassung: Integration als Prozess und Zustand
6.8.1 Biographisch relevante Integrationsanforderungen und der Umgang damit
6.8.2 Unterstützende Bedingungen/ Ressourcen
6.8.3 Langfristige Instrumentalisierung kurzfristiger Substanzwirkungen
6.8.4 Substanzunabhängige Integration
6.8.5 Desintegrativer Umgang
Implikationen für Forschung, Praxis und Politik
7.1 Forschung
7.2 Jugendliche & Erwachsene: Entwicklungspsychologische Implikationen
7.3 Praxis (Pädagogik und Therapie)
7.4 Politik
Fazit
8.1 Definition des Integrativen Umgangs
8.2 Grenzen der Arbeit
Zusammenfassung
Persönliche Schlussbemerkung und Danksagung
Quellen
Anhang
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1 Forschungsdesign
Abbildung 2 Modell der Integration (Jung 2006)
Abbildung 3 Integration durch Assimilation und Akkommodation (Jung 2006)
Abbildung 4 Aufeinander aufbauende Entwicklungsebenen (Weinreich 2018)
Abbildung 5 Bewusstseinsebenen und Spiral Dynamics - Bsp. Mensch (Weinreich 2018)
Abbildung 6 Wilber Combs Matrix und Entwicklungsrichtungen (Weinreich 2018)
Abbildung 7 Vier Quadranten und Acht Perspektiven (Weinreich 2018)
Abbildung 8 Tetraevolution (Weinreich 2018)
Abbildung 9 Entwicklungslinien (Weinreich 2018)
Abbildung 10 Typen (Weinreich 2018)
Abbildung 11 Die Bewusstseinszustände in den Quadranten (Weinreich 2018)
Abbildung 12 Ebenen, Quadranten, Zustände, Typen & Linien (Weinreich 2018)
Abbildung 13 Ökosystemische Dimensionen & Quadranten (Weinreich 2018)
Abbildung 14 Übersicht und Klassifikation psychoaktiver Substanzen (McCandless 2010)
Abbildung 15 Cannabis Funktionsspektrum (DHS 2014)
Abbildung 16 Auszug des Begleitprospekts von LSD-25 (Hofmann 1993)
Abbildung 17 Medizinische Indikationen von Psilocybin und LSD (von Heyden 2018)
Abbildung 18 Strategien effektiver Risikominderung (Prepeliczay 2016)
Abbildung 19 Das Health-Belief-Model (Knoll et al. 2005)
Abbildung 20 Synthese von Kohärenz- und Konsistenztheorie
Abbildung 21 Voraussetzungen für kognitive Dissonanz (Herkner 1991)
Abbildung 22 Modell der Selbstwirksamkeit (Knoll et al. 2005)
Abbildung 23 Zusammenhang zwischen Set, Setting und Integration (Jung 2006)
Abbildung 24 Soziale und personale Ressourcen im Kindes- und Jugendalter (Blanz et al. 2010)
Abbildung 25 Das Sozialisationsmodell (Hurrelmann 2010)
Abbildung 26 Desintegrative vs. Integrative Konsummuster (Jung 2006)
Abbildung 27 Entwicklungsaufgaben und Funktionen des Substanzgebrauchs (Silbereisen 2001)
Abbildung 28: Modell der adoleszenten Haltung zu Drogen (Gingelmaier 2008)
Abbildung 29 Ökosystem des Menschen nach Bronfenbrenner
Abbildung 30 Erweiterung der Settingstruktur durch den ökosystemischen Ansatz (Kemmesies 2004)
Abbildung 31 Persönlichkeit & Identität
Abbildung 32 Persönlichkeitsmerkmale und PAS
Abbildung 33: Die zehn Wertetypen und ihre vier übergeordneten Standardtypen (Mohler et al 2005)
Abbildung 34 Werte Entwicklung Gruppe/Individuum (Lutterbeck 2011)
Abbildung 35 Strukturmodell des Wohlbefindens (Becker 1999)
Abbildung 36 2 Systeme: Intuitiv & reflexiv (Stanovich & West 1999)
Abbildung 37 Verbindung von Werten und Bedürfnissen)
Abbildung 38: Mean harm scores for 20 substances (Nutt et al. 2007)
Abbildung 39 Modell für die Entstehung der Drogenabhängigkeit (Feuerlein 2005)
Abbildung 40 Auf individueller Bewertungsebene ausdifferenziertes Modell der Integration
Abbildung 41 Auf Bewertungsebene überarbeitetes Modell der Integration
Abbildung 42 Ausdifferenzierung der „Ressourcen“ und „Bilanzierungen“
Abbildung 43 Erweitertes Modell der Integration – finale Version
Abbildung 44 Beispiel für den konfrontierenden Konsumverlauf von ID 343 (T1-T10)
Abbildung 45: Transkriptionsregeln für die computergestützte Auswertung (Kuckartz 2007)
Abbildung 46: Kodierparadigma nach Strauss (Strauss 1994)
Abbildung 47 Allgemeines inhaltsanalytisches Ablaufmodell (Mayring 2010)
Abbildung 48: Allgemeines Ablaufmodell strukturierender Inhaltsanalyse (Mayring 2010)
Abbildung 49 Ablaufmodell explizierender Inhaltsanalyse (Mayring 2010)
Abbildung 50 Ablaufmodell der typisierenden Inhaltsanalyse (Mayring 2010)
Abbildung 51 Ur-Kategoriensystem anhand des (fast) originalen Modells der Integration (Jung 2006)
Abbildung 52 Modifiziertes und erweitertes Kategoriensystem
Abbildung 53 Synthese der „Techniken der Analyse“
Abbildung 54 Aufbau des Auswertungsteils
Abbildung 55 Zusammenfassung der Empirie im MDI
Abbildung 56 Interne und externe Ressourcen (Ulrich Kleinmanns 2008 / Schmid 2018)
Abbildung 57 Grundbedürfnisse und kurzfristige Substanzwirkungen
Abbildung 58 Langfr. Einfluss von PAS auf das Selbst- und Weltbild
Abbildung 59 Bewusstseinsebenen, Zustände & PAS Wirkrichtungen (Weinreich 2005/ 2006/ 2017)
Abbildung 60 Prozess der Entstehung von Grenzen
Abbildung 61-63 Metaphern
Abbildung 64 Wirkrichtungen von PAS (Weinreich 2006)
Abbildung 65 Konsistenz Substanz, Set & Setting
Abbildung 66: Indikatoren für Flow-Erlebnisse
Abbildung 67 Spiritualität als Verbundenheit und Selbsttranszendenz (Bucher 2014)
Abbildung 68 Selbstbildungs-/Selbsttranszendenz Kontinuum
Abbildung 69 Entstehung des "positiven Grundgefühls"
Abbildung 70 Identitätsdiffusion im Rahmen (private Quelle)
Abbildung 71 Drug Science mit ihren verschiedenen Teildisziplinen (Jungaberle et al 2018)
Abbildung 72 Integrale Praxis (Weinreich 2005)
Abbildung 73 Phasen des integrativen Umgangs
Abbildung 74 Integration als Prozess und Zustand
Abbildung 75 Konsistentes Zusammenspiel von Droge, Set & Setting
Abbildung 76 Umweltbewusstsein (Schmid & Schmid 2009)
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1 Medicinal Uses of Marijuana and Cannabinoids (Grotenhermen et al. 2017)
Tabelle 2: Werte nach Rokeach (1973 in Oesterdiekhoff et al 2001)
Tabelle 3 Synthese Schwartz Value Inventory & Spiral Dynamics Farben
Tabelle 4 Theoretische Grundlagen des erweiterten Modells der Integration
Tabelle 5 Stufen des Grounded Theory Forschungsprozesses
Tabelle 6 Hintergrundinformationen der TeilnehmerInnen
Tabelle 7 Methoden zur Aktivierung körpereigener Drogen (Zehentbauer 2013)
Tabelle 8 Konzepte und Begriffe positiv konnotierter Konsumformen (Jungaberle et al 2018)
Tabelle 9 Drogenbezogene Fähigkeiten und funktionale Äquivalente
Tabelle 10 Altersabhängige Entwicklungsaufgaben
Tabelle 11 Entwicklungsaufgaben und PAS Integration
Abkürzungsverzeichnis
DFG
Deutsche Forschungsgemeinschaft
ID
Identifikationsnummer der StudienteilnehmerInnen
PAS
Psychoaktive Substanz Psychoaktive Substanzen
RISA
Längsschnittuntersuchung (Beginn 2002) mit dem Titel „Ritualdynamik und Salutogenese beim Gebrauch und Missbrauch im Umgang mit PAS“
SFB
Sonderforschungsbereich der DFG
T1-T14
Erhebungszeitpunkt 1-14 (2003-2012)
Glossar
Bilanzierungen
Bewertungen im Sinne einer Kosten/Nutzen Abwägung
Biographische Relevanz
Alle Tätigkeiten, Verhaltensweisen und Einstellungen, die im Zusammenhang mit PAS stehen und für die persönliche Entwicklung eine wichtige Bedeutung haben/ hatten
Integration
lateinischen
integrare
(ergänzen,[geistig] erneuern) und
integer
(Ganz, Unversehrt)
Jugendliche
Junge Menschen zwischen 14 und 25 Jahren
Konsistenz
Vereinbarkeit gleichzeitig bestehender Bedürfnisse und Prozesse (physisch, psychisch, sozial)
Kohärenzgefühl
Subjektives Vorhandensein von
Verständnis
,
Handhabbarkeit
/Kontrolle und
Sinn
des Lebens.
Lebenswelt
Subjektive Wahrnehmung der Lebenslage
Modell der Integration
Salutogenetisch orientiertes Modell zur Beschreibung des Integrations- und Bewältigungsprozesses bzgl. PAS das im Rahmen einer Diplomarbeit (Jung 2006) innerhalb des RISA-Projektes entstand
Psychoaktive Substanz (PAS)
Jeder von außen zugeführte Stoff, der Veränderungen der Psyche und des Bewusstseins eines Menschen zur Folge hat
Salutogenese
Gesundheitsentstehung. Gegenteil von Pathogenese
Sinnzuschreibungen
Alle Bewertungen, die im Zusammenhang mit PAS stehen und denen ein persönlicher oder sozialer Nutzen zugesprochen wird
Umgang mit Drogen
Alle Tätigkeiten, Verhaltensweisen und Einstellungen, die im Zusammenhang mit Drogen stehen
1. Einleitung
In den letzten Jahren weisen Untersuchungen in Deutschland auf hohe Steigerungsraten beim Konsum legaler und illegaler Suchtmittel durch Kinder, Jugendliche und Erwachsene hin. Junge Menschen geraten immer früher mit Suchtmitteln in Kontakt, das Einstiegsalter sinkt (Möller 2009: 9). Knapp 35% der jungen Erwachsenen und über 10% der Jugendlichen gaben an, bereits Erfahrungen mit illegalen Drogen wie Cannabis, Amphetaminen, Ecstasy, LSD, Kokain, Crack oder Heroin gemacht zu haben (Lebenszeitprävalenz). Im Jahr 2015 wurden insgesamt 276.734 Rauschgiftdelikte erfasst und 1226 Menschen starben 2015 an illegalen Drogen (Reitox Bericht 2015: 4). Jugendliche trinken sich ins „Koma“ und insgesamt bis zu 200.000 Menschen starben an den Folgen des Missbrauchs der legalen Drogen Alkohol und Tabak1 (DSB 2016).
So oder so ähnlich klingen die meisten medialen Meldungen, die im Zusammenhang mit Drogenkonsum stehen. Sicherlich gibt es Probleme und sogar Todesfälle im Zusammenhang mit dem Konsum von Drogen. Diese Sichtweise, die den öffentlichen Diskurs2 bestimmt, ist jedoch einseitig pathologisch orientiert und bildet somit nur einen kleinen Ausschnitt - nämlich den eines „sozialen Problems“ (vgl. Hoffmann 2012) - der gesellschaftlichen Wirklichkeit ab.
Vor allem Jugendliche sind von dieser einseitigen pathologisierenden Entwicklung betroffen. Durch die damit zusammenhängende schrittweise erfolgte Illegalisierung (vgl. Holzer 2007) von Cannabis, Stimulanzien, Psychedelika und zahlreichen weiteren Substanzen, entwickelte sich Drogenkonsum zu einem Tabuthema. Vor allem der Konsum illegalisierter Substanzen3 fand und findet zunehmend „im Untergrund“ statt. In der Folge wurde die Möglichkeit zum sozialen (Erfahrungs-)Austausch im Familien- und Freundeskreis, aber auch eine an Aufklärung orientierte Wissensvermittlung in der Schule stark eingeschränkt. Doch nicht nur der formelle und informelle Austausch, welcher als eine Grundvoraussetzung für die Wissensaneignung der Menschen betrachtet werden kann, sondern auch der wissenschaftliche Zugang zu KonsumentInnen4 von Drogen wurde durch die Illegalisierung und Pathologisierung eingeschränkt - „Inhalt, Struktur und Erfahrungen der Sitzungen, Set und Setting Aspekte eines professionellen Substanzgebrauchs, inklusive Bedeutungszuschreibungen und Integrationsstrategien, waren einer wissenschaftlichen Öffentlichkeit kaum mehr zugänglich“ (Jungaberle et al. 2008: 318). Jugendliche und Erwachsene trauen sich häufig nicht über ihren Konsum zu sprechen, da sie biographische Nachteile in Form von Stigmatisierung und Kriminalisierung befürchten.
Seit dem Jahr 2002 widmete sich die RISA-Studie5 dieser herausfordernden Situation. Unter Einhaltung strenger Datenschutzbestimmungen versuchte sie über einen Zeitraum von ca. zehn Jahren den Drogenkonsum von Jugendlichen und Erwachsenen aus einer salutogenetischen Perspektive zu untersuchen. Durch diese Vorgehensweise wurden bis zum Auslaufen der Studie im Jahr 2013 langfristige Kontakte zu sozial integrierten DrogenkonsumentInnen aufgebaut, was im Ergebnis zu einem großen beiderseitigen Vertrauen führte und eine Vielzahl sehr offener und freier Interviews über ein Tabuthema ermöglichte. Im Rahmen einer dieser Untersuchungen wurde im Jahr 2006 das Modell der Integration6 entwickelt.
Dieses Modell der Integration entstand aus einem Anspruch heraus, die vorherrschenden pathologischen, klinisch-psychiatrischen und drogenpolitischen Paradigmen um eine gesundheitsorientierte Perspektive zu erweitern. Das Modell begreift legalen und illegalen Substanzkonsum als Entwicklungsaufgabe, betrachtet ihn ressourcenorientiert und schließt auch positive Einflüsse auf die KonsumentInnen nicht von vornherein aus. Diese grundlegend andere Herangehensweise an den Forschungsgegenstand erlaubt heuristisch neue Ergebnisse und Sichtweisen, da bewusst versucht wird, den Drogengebrauch (auch) vom Gelingen her zu denken. Entsprechend dem Salutogenese-Gedanken steht nicht die Frage „wie entstehen Sucht und Missbrauch“, sondern „wie entstehen gerade keine Sucht und Missbrauch“ im Fokus (vgl. Jungaberle 2007). Integration wird im Sinne des Modells als eine Leistung verstanden, die einen verantwortungsbewussten, auf langfristigen Erhalt und Steigerung der Gesundheit angelegten Umgang mit psychoaktiven Substanzen7 erlaubt.
Das Konzept des Integrationsmodells aufzugreifen und im Sinne einer salutogenetisch orientierten Erforschung des integrativen Umgangs mit Drogen bei Jugendlichen anzuwenden, ist das Ziel der vorliegenden Arbeit.
Welche Ziele diese Arbeit im Detail verfolgt und wie sie aufgebaut ist, wird Gegenstand der folgenden beiden Kapitel sein.
1.1 Ziele der Arbeit
Zum Abschluss der bereits angesprochenen RISA-Studie (Teilbereich8 adoleszenter Substanzkonsum) war geplant, den Umgang mit Drogen9 bei Jugendlichen unter Berücksichtigung des projektspezifischen salutogenetischen Ansatzes und unter Bezugnahme auf das neu entwickelte Modell der Integration (Jung 2006) qualitativ10 zu erforschen. Den Forschungsschwerpunkt sollte die Untersuchung von biographisch relevanten Faktoren und Prozessen in Verbindung mit der entwicklungspsychologisch betrachteten Integration des Umgangs mit Alkohol und anderen Drogen bei Jugendlichen einnehmen. Da es sich um den Abschluss der Studie handelte, galt zudem ein besonderes Interesse den selbst konstruierten und handlungsleitenden Sinnzuschreibungen und Bilanzierungen im Kontext des adoleszenten Substanzkonsums. Zudem sollte die Auswertung substanzspezifische Besonderheiten erfassen können, um weiterführende vergleichende Analysen zu ermöglichen. Auch eine Diskussion der Ergebnisse der Abschlusserhebung anhand entwicklungs- und gesundheitspsychologischer Perspektiven sowie eine Einbettung in den Kontext weiterer RISA-Forschungsarbeiten waren angestrebt.
Nach ersten Überlegungen innerhalb des RISA-Teams kamen wir zu der Übereinstimmung, dass das Modell der Integration (MDI) im Sinne der genannten Forschungsinteressen ein großes Potential in sich trägt und zum Abschluss der Studie nicht nur „am Rande“ Erwähnung finden, sondern - wenn möglich – sowohl während des Erhebungs- als auch des Auswertungsprozesses angewendet und bei Bedarf modifiziert werden sollte.
Sehr bald wurde deutlich, dass die geplante Studie aufgrund der bereits existierenden11 und noch zu erhebenden12 und auszuwertenden qualitativen Daten sehr aufwendig werden würde.
Mir wurde daher angeboten, ein Studiendesign zu entwickeln, welches ermöglicht, einen Teil der Studie – quasi als Vorstudie - zunächst in Form einer Masterarbeit zu verwirklichen.
Dies führte zunächst dazu, dem Forschungsgegenstand angemessene und das Modell der Integration berücksichtigende Erhebungs- und Auswertungsmethoden zu erarbeiten und das Modell der Integration exemplarisch auf die Erforschung des adoleszenten Umgangs mit den psychoaktiven Substanzen Alkohol und Cannabis13 anzuwenden. Diese erste Anwendung wurde methodisch und theoretisch reflektiert und führte zu ersten Modifikationen am Modell der Integration.
Nach erfolgreichem Abschluss der Arbeit galt es, das Modell für die Erforschung weiterer psychoaktiver Substanzen wie Tabak, Stimulanzien und Psychedelika anzuwenden um die Ergebnisse in einem anschließenden Schritt wieder zusammenzuführen und eine substanzübergreifende aber auch vergleichende Analyse biographisch relevanter Faktoren und Prozesse zu ermöglichen. Darüber hinaus war sowohl eine kontinuierliche Erweiterung theoretischer Zugänge als auch eine fortgeführte Modifikation des Integrationsmodells angestrebt.
Um alle Vorgaben des Gesamtprojektes erreichen zu können, wurden folgende - im Anschluss kurz erläuterte - Forschungsziele festgelegt:
1. Bestimmung/ Entwicklung einer geeigneten Erhebungsmethode für die qualitative Abschlusserhebung der RISA-Studie unter Berücksichtigung des MDI.
2. Bestimmung/ Entwicklung einer geeigneten Auswertungsmetode für die qualitative Abschlusserhebung der RISA-Studie unter Berücksichtigung des MDI.
3. Anwendung, Modifikation und theoretische Erweiterung des MDI.
4. Berücksichtigung substanzspezifischer sowie substanzübergreifender Besonderheiten durch die Anwendung des MDI am Beispiel von Tabak, Alkohol, Cannabis, Stimulanzien und Psychedelika.
5. Identifikation und Diskussion biographisch relevanter Faktoren und Prozesse, die für einen integrativen Umgang mit Drogen bei Jugendlichen zentral sind.
1.1.1 Bestimmung/ Entwicklung einer geeigneten Erhebungsmethode
Das zentrale Forschungsinteresse der Abschlusserhebung betrifft die Untersuchung biographisch relevanter Faktoren und Prozesse in Verbindung mit der entwicklungspsychologischen Integration des Umgangs mit Alkohol- und anderen Drogen bei Jugendlichen. Dem Kernkonzept des Modells der Integration folgend gilt es diesbezüglich zunächst auslösende, unterstützende und pathologische Bedingungen für biographische Integrationsspannungen und die folgende Integrations- und Identitätsarbeit (vgl. Jung 2006 & Gingelmaier 2008) im Kontext des Umgangs mit Drogen bei Jugendlichen über einen Zeitraum von ca. acht Jahren zu identifizieren und zu rekonstruieren. Ein Hauptinteresse betrifft dabei die selbst konstruierte, subjektive Persönlichkeitsentwicklung und die zugrunde liegenden handlungsleitenden Bedingungen und Sinnzuschreibungen.
Da es sich um den Abschluss eines Teilbereichs der auf zehn Jahre angelegten RISA-Langzeitstudie handelt, interessieren zudem insbesondere die abschließenden Bilanzierungen des Erfolgs oder Misserfolgs der gesamten Integrationsarbeit im Zuge einer Prozessbewertung.
Eine geeignete Erhebungsmethode müsste dementsprechend das Kernkonzept des Modells der Integration abbilden und gleichzeitig genügend Freiraum bieten, um eine selbst konstruierte - an biographisch relevanten Prozessen orientierte - Beschreibung der Persönlichkeitsentwicklung inklusive abschließender Bilanzierungen im Kontext des Umgangs mit psychoaktiven Substanzen zuzulassen.
1.1.2 Bestimmung/ Entwicklung einer geeigneten Auswertungsmethode
Das übergeordnete Forschungsinteresse gilt zusammengefasst der salutogenetisch orientierten Untersuchung von biographisch relevanten Faktoren und Prozessen in Verbindung mit der entwicklungspsychologisch betrachteten Integration des Umgangs mit Alkohol und anderen Drogen bei Jugendlichen unter Berücksichtigung des Modells der Integration.
Durch die Berücksichtigung des Modells der Integration während der Auswertungsphase sollen auslösende, unterstützende und pathologische Bedingungen für biographische Integrationsspannungen und die folgende Integrations- und Identitätsarbeit sowie abschließenden Bilanzierungen des Erfolges oder Misserfolges über einen Zeitraum von acht Jahren exemplarisch am Beispiel Alkohol, Tabak, Cannabis, Stimulanzien und Psychedelika identifiziert und beschrieben werden.
Um ein wissenschaftlich bislang wenig erforschtes Gebiet14 qualitativ zu erschließen, bietet sich eine explorative Herangehensweise an (vgl. Flick 2008). Ziel der vorliegenden Arbeit ist es daher zunächst, eine maximale Komplexität des Phänomens Umgang mit Drogen bei Jugendlichen zu erzeugen und gleichzeitig – im Sinne des o.g. Forschungsinteresses - die bislang unbekannten Lebenswelten „von innen heraus“ (ebd.: 15), aus der Sicht der handelnden Menschen zu beschreiben. Aufgrund der großen Menge der im Längsschnitt erhobenen qualitativen Daten stellt sich zudem die Herausforderung einer methodisch ökonomischen Herangehensweise.
Neben einer Abbildung des Modells der Integration muss es daher vor allem das Ziel der Auswertungsmethode sein, eine maximale Ressourcenökonomie mit einem maximalen Erkenntnispotential zu verbinden, um so eine solide und umfassende empirische Grundlage für weiterführende Analysen zu ermöglichen.
1.1.3 Substanzspezifische Besonderheiten
Eine Schwäche vieler qualitativer (und quantitativer) Studien im Drogenbereich ist ihre mangelnde Differenzierung. Häufig beschränken sie sich auf die Unterscheidung von legalen und illegalen Substanzen, was beispielsweise nach Ullrich-Kleinmanns (2008) „zum Scheitern verurteilt ist“. Bezüglich des Risikopotentials verschiedener psychoaktiver Substanzen kommt er unter anderem zu folgender Erkenntnis: „Ansätze, welche nicht zwischen verschiedenen psychoaktiven Substanzen differenzieren und sozusagen ‚alles, was illegal ist, in einen Topf werfen‘, sind von vornherein zum Scheitern verurteilt, denn die Einschätzung etwaiger Risiken erschließt sich nicht aus dem Betäubungsmittelgesetz.“ (Kleinmanns 2008: 152). Damit ist er auf einer Linie mit Studienergebnissen, wie sie etwa Nutt et al. (2007/ 2010) publizierten. Auch sie kommen zu dem Ergebnis, dass es keine bzw. wenig Zusammenhänge zwischen dem legalen Status einer psychoaktiven Substanz und ihrer Gefährlichkeit gibt.
Die Annahme ist daher, dass sich auslösende, unterstützende und pathologische Bedingungen für biographische Integrationsspannungen, die folgende Integrations- und Identitätsarbeit sowie damit zusammenhängende Bilanzierungen und Sinnzuschreibungen nicht – bzw. genauso wenig - aus dem legalen oder illegalen Status von psychoaktiven Substanzen erschließen lassen, sondern substanzspezifisch betrachtet werden müssen15.
In Verbindung mit dem generellen Ziel, eine maximale Komplexität des Phänomens Umgang mit Drogen bei Jugendlichen zu erzeugen, liegt es daher nahe, die Auswertung der qualitativen Daten substanzspezifisch zu gestalten. Für eine vertiefende und vergleichende Interpretation der Ergebnisse sind so ideale Voraussetzungen geschaffen.
1.1.4 Anwendung und Modifikation des Modells
Bei dem Modell der Integration handelt es sich um das Kernstück einer Diplomarbeit, die 2006 am Institut für medizinische Psychologie fertiggestellt wurde. Es stellt ein theoretisches Ergebnis dar, das in einem Prozess der Auseinandersetzung mit verschiedenen Theorien der Psychologie und anderer Bereiche in „Interaktion mit dem Forschungsgegenstand16 und dem RISA-Forscherteam“ entstand (vgl. Jung 2006:183ff). Das Modell wurde seither nicht mehr überarbeitet und auch nicht auf einen konkreten Forschungsgegenstand angewandt.
Ziel ist es demnach, das Modell exemplarisch auf den Forschungsgegenstand Umgang mit Drogen bei Jugendlichen anzuwenden, dadurch auf seine Praxistauglichkeit zu überprüfen und gegebenenfalls in erneuter Auseinandersetzung mit der Theorie und Empirie zu modifizieren.
1.1.5 Identifikation und Diskussion biographisch relevanter Faktoren und Prozesse
Für eine Betrachtung des integrativen Umgangs mit Drogen als Prozess ist es von zentraler Bedeutung zu wissen, welche drogenbezogenen Faktoren und Prozesse für Jugendliche die höchste biographische Relevanz erlangen bzw. die stärksten Integrationsanforderungen stellen. Um dies herauszufinden leiten folgende - am Modell der Integration orientierte - Forschungsfragen den Analyseprozess:
1. Welche Themen stellten die stärksten Integrationsanforderungen?
2. Wie wurde mit diesen Anforderungen umgegangen?
3. Wer oder was hat die Jugendlichen dabei besonders unterstützt?
4. Wie bewerten die Jugendlichen das Gesamtergebnis dieses Prozesses?
5. Welche Formen der Integration lassen sich aus einer Gesamtbetrachtung ableiten?
Während der Auswertungs- und Ergebnisteil der Identifikation und Beschreibung gefundener Prozesse dienen sollte, so sollte der Diskussionsteil zwar auf der Empirie basierende, aber auch über diese hinaus gehende Perspektiven aufzeigen.
In diesem letzten Schritt des Forschungsprojektes wird daher das Ziel verfolgt, die im Ergebnisteil identifizierten und beschriebenen Faktoren und Prozesse erneut aufzugreifen und die biografisch relevantesten unter Hinzunahme erweiterter theoretischer Grundlagen vertiefend zu explorieren. Besonderes Interesse gilt dabei den RISA-Forschungsarbeiten, entwicklungspsychologischen und gesundheitspsychologischen, aber auch weiteren, das Verständnis des Forschungsgegenstandes erhöhenden Perspektiven.
Im nächsten Kapitel soll anhand des Aufbaus dieser Arbeit ersichtlich werden, wie die genannten Ziele erreicht werden.
1.2 Aufbau der Arbeit
Die Arbeit ist in fünf Haupt-Teile gegliedert. Einen einleitenden Teil, einen theoretischen Grundlagen- und Methodenteil, einen empirischen Teil und einen umfangreichen Diskussionsteil, in welchem der Forschungsprozess und die empirischen Ergebnisse vor dem Hintergrund der genannten Ziele diskutiert werden.
Im Anschluss an die einleitenden Kapitel, in denen der theoretische und praktische Hintergrund der Entstehung dieser Arbeit sowie ihre Ziele beschrieben werden, folgt in diesem Kapitel der Aufbau der Arbeit im Sinne eines Advance Organizers. In Kapitel 2 erfolgt eine Klärung der theoretischen Grundlagen. Hier wird zunächst das von Jung (2006) entwickelte Kernkonzept des Modells der Integration inklusive seiner zentralen Bestandteile vorgestellt. Es handelt sich dabei um auslösende, unterstützende und pathologische Bedingungen für biographische Integrationsspannungen und die folgende Integrations- und Identitätsarbeit sowie abschließende Bilanzierungen des Erfolges oder Misserfolges des Integrationsprozesses.
In einem nächsten Schritt wird nachgezeichnet, welche theoretischen Konzepte sich während des Forschungsprozesses als besonders hilfreich für die Konzeptualisierung des Integrativen Umgangs inklusive einer Modifikation und Erweiterung des Modells der Integration erwiesen haben. Diese Konzepte gliedern sich in gesundheitspsychologische, (sozial-)psychologische und entwicklungspsychologische sowie soziokulturelle Ansätze. Die exkursartigenStellungnahmen zu den Themen Integrale Theorie, Psychoaktive Substanzen, Bewusstsein, Werte, Identität und Persönlichkeit sowie Sucht und Rausch erfolgen in gesonderten Kapiteln.
Für die Erhebung und Auswertung der Daten werden Methoden der qualitativen Sozialforschung angewendet und im Methodenteil (Kapitel 2) vorgestellt. Nach einer kurzen Einführung in die Methodologie und den „Forschungsstil“ der Grounded Theory, der dieser Arbeit zugrunde liegt, folgen Hinweise auf die Erschließung des Forschungsfeldes und die gewählte Stichprobe bzw. das „theoretische Sampling“. Um eine umfangreiche Perspektive auf das Forschungsfeld des integrativen Umgangs mit Drogen zu gewährleisten, besteht das Untersuchungssample aus 14 Jugendlichen, die nach dem Prinzip der maximalen Kontrastierung ausgesucht wurden.
Das Ziel des folgenden Abschnittes (Kapitel 3.4) ist es, den Entscheidungsprozess für die gewählte Erhebungsmethode transparent darzustellen. Es werden sowohl die bislang verwendete Interviewform des problemzentrierten Interviews nach Witzel (1982) beschrieben, als auch die Veränderungen, die nötig waren, um das Modell der Integration in die Datenerhebung zu integrieren und gleichzeitig eine Erhöhung selbst konstruierter, subjektiver Entwicklungsprozesse und Sinnzuschreibungen im Kontext des Umgangs mit psychoaktiven Substanzen zu ermöglichen. Hierfür spielte vor allem die Erhöhung narrativer Anteile sowie die Erarbeitung des externen Integrations- und Bilanzierungsteils eine besondere Rolle. Den Erhebungsteil abschließend folgt eine Schilderung des konkreten Ablaufs der Interviews sowie eine Bezugnahme auf die im Kontext des Erhebungs- und Auswertungsprozesses verwendeten technischen Hilfsmittel (MAXQDA, F4 etc.).
Den zweiten Teil des Methodenteils bestimmen die Auswertungsmethoden und der damit in Verbindung stehende Kodierprozess (Kapitel 3.5). Die Auswahl der Auswertungsmethoden richtet sich danach, der Herausforderung gerecht zu werden, sowohl eine ökonomische Bearbeitung großer Mengen empirischer, längsschnittlich erhobener Daten zu bewerkstelligen, als auch die explorativ-interpretative Erschließung von Entwicklungsprozessen bezüglich des Umgangs mit Drogen - in Verbindung mit einer Berücksichtigung der Themenbereiche des Modells der Integration - zu ermöglichen. Eine Mischung aus verschiedenen Techniken der Grounded Theory (Glaser/ Straus 1967) sowie der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2010) erwies sich vor diesem Hintergrund als besonders vorteilhaft.
Um die während der Auseinandersetzung mit Theorie, Methode und Empirie entstandenen Modifikationen des Modells und den damit zusammenhängenden Aufbau des Ergebnisteils besser nachvollziehen zu können, wird die Zusammenfassung und Synthese der theoretischen und methodischen Grundlagen - und damit ein Teil der Diskussion - im Sinne eines Advanced Organizers vorgelagert. Diese Teile befinden sich aus didaktischen Gründen am Ende des Grundlagen- und Methodenteils (Kapitel 2.13 & 3.6). Diese Synthese-Kapitel sollten idealerweise vor einer Betrachtung des empirischen Ergebnisteils gelesen werden, da dort unter anderem die Herleitung dess erweiterten Modells der Integration vor dem Hintergrund der theoretischen Grundlagen (Kapitel 2.13) stattfindet.
Das erweiterte Modell der Integration stellt - ähnlich wie das Original – ein theoretisches Ergebnis dar, das in einem Prozess der Auseinandersetzung mit verschiedenen Theorien der Psychologie und anderen Bereichen sowie in der Interaktion mit dem Forschungsgegenstand und dem RISA-Forscherteam entstand. Im folgenden empirischen Auswertungsteil (Kapitel 3) werden die einzelnen Komponenten des erweiterten Modells der Integration auf die längsschnittlich erhobenen qualitativen Daten von 14 Jugendlichen angewendet. Diese Anwendung erfolgte zunächst substanzspezifisch am Beispiel von Alkohol, Tabak, Cannabis, Stimulanzien und Psychedelika und findet sich aufgrund des großen Umfangs im Anhang (Empirie). In einem zweiten Schritt wurden diese Ergebnisse im eigentlichen Ergebnisteil wieder zusammengeführt (Kapitel 3) um eine substanzübergreifende aber auch vergleichende Analyse biographisch relevanter Faktoren und Prozesse zu ermöglichen.
Im anschließenden Diskussionsteil (Kapitel 5) werden die empirischen Ergebnisse im Kontext der Ziele dieser Arbeit sowie damit zusammenhängender Forschungsfragen diskutiert. Der erste Teil geht weniger auf die Interpretation der Ergebnisse ein, sondern auf eine Diskussion der erarbeiteten Erhebungs- und Auswertungsmethoden sowie des modifizierten Modells der Integration und seiner Anwendung. Geleitet wird die Diskussion anhand der Konfrontation des Erhebungs- und Auswertungsprozesses mit den Gütekriterien qualitativer Forschung (Mayring 2002/ Flick 2008).
Im zweiten Teil des Diskussionsteils findet eine vertiefende Diskussion der grundlegenden Komponenten des Modells der Integration statt. Diese erfolgt sowohl unter Einbezug der empirischen Ergebnisse als auch theoretischer Konzepte aus dem Theorieteil dieser Arbeit und dient dem Ziel, die im Ergebnisteil identifizierten und beschriebenen Faktoren und Prozesse erneut aufzugreifen und die biografisch relevantesten unter Hinzunahme erweiterter theoretischer Grundlagen vertiefend zu explorieren. Leitende und strukturierende Perspektive der Diskussion bildet die Betrachtung des integrativen Umgangs als Prozess und Zustand. Zudem findet eine Unterscheidung in die Schwerpunkte substanzabhängige- und substanzunabhängige Integration statt.
Da auch die Vermeidung unerwünschter Umgangsweisen als Teil des integrativen Umgangs betrachtet werden muss, widmet sich das Kapitel „Desintegrativer Umgang“ starken Inkonsistenz auslösenden Potentialen. Den Abschluss der Diskussion bildet die Analyse von drei besonders „integrativen“ Einzelfällen und wird von der interpersonellen Ebene wieder auf die Subjektebene führen.
Ein Fazit inklusive eines Definitionsversuches, eine Zusammenfassung sowie Implikationen für Forschung, Praxis und Politik runden die Arbeit ab. Eine schematische Darstellung des beschriebenen Aufbaus dieser Studie findet sich in der folgenden Abbildung 1.
Abbildung 1 Forschungsdesign
1 Zwischen 43000 und 74000 starben an den Folgen ihres Alkoholmissbrauchs und zwischen 100000 und 120000 an den Folgen ihres Tabakmissbrauchs.
2 Diskurs wird hier nicht im Sinne der Theorie der kommunikativen Rationalität von Jürgen Habermas verstanden, sondern geht auf die Idee der „Gouvernementalität“ von Michel Foucault zurück und meint politische Wirkungen, die zugleich die Ebene der Subjekte berühren (Alheit 2009: 80). Diskurs meint einen (Macht-) politischen Prozess, in dem Realität sprachlich erzeugt wird. Der Diskurs definiert für einen bestimmten Zusammenhang, oder ein bestimmtes Wissensgebiet, was sagbar ist, was gesagt werden soll und was nicht gesagt werden darf (Wikipedia/ Diskurs). Diskurse sind „Praktiken […], die systematisch die Gegenstände bilden, von denen sie sprechen“ (Foucault 1995: 74).
3 Aber auch die legalen Drogen Alkohol und Tabak geraten zunehmend ins Visier einer einseitig pathologischen Perspektive, was im schlechtesten Falle zu ähnlichen Entwicklungen führen könnte. Beispiele die in eine ähnliche Richtung führen könnten, sind Diskussionen um Alkoholverbote an öffentlichen Plätzen, die strengen Rauchverbote bzw. Nichtraucherschutzgesetze in NRW und Bayern sowie Debatten um „rauschtrinkende“ (binge drinking) Jugendliche (vgl. Stumpp et al. 2009) oder wirtschaftliche Einbußen durch Sucht am Arbeitsplatz (AOK 2013/ www.aktionswoche-alkohol.de).
4 Im Sinne einer geschlechtsneutralen und nicht-diskriminierenden Schreibweise findet im Folgenden das große „Binnen-I“ Verwendung.
5 RISA ist ein Forschungsprojekt, das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) und der Abteilung für Medizinische Psychologie an der Universität Heidelberg getragen wurde. Zwischen 2002 und 2013 wurde hier als Teil des DFG-Sonderforschungsbereichs Ritualdynamik (SFB 619) eine Langzeitstudie zum Gebrauch und Missbrauch psychoaktiver Substanzen durchgeführt. Das Hauptinteresse galt damit in Verbindung stehenden Ritualen, kontrolliertem Drogengebrauch und Informationen, die zur Verbesserung von Harm-Reduction-Ansätzen führen. RISA ist die Abkürzung von Ritualdynamik und Salutogenese.
6 Das Modell der Integration entstand im Rahmen der RISA-Diplomarbeit „Das Leben nach der Ekstase – die Suche nach Integration“ von Bernd Jung (2006). Den thematischen Schwerpunkt der Arbeit stellte die (salutogenetisch orientierte) Erforschung der Bewältigung von Erfahrungen/ Erlebnissen mit psychoaktiven Substanzen bei drogenerfahrenen Erwachsenen dar.
7 Im Weiteren werden die Begriffe Drogen und psychoaktive Substanz (PAS) synonym gebraucht.
8 Innerhalb der RISA-Studie existieren verschiedene Schwerpunkte und Forschungsinteressen. Diese Arbeit ist Teil der Abschlusserhebung im Bereich der Erforschung jugendlichen Substanzkonsums. Neben der Erforschung von Gebrauchsmustern und Ritualisierungen Jugendlicher DrogenkonsumentInnen, existieren allerdings auch noch weitere Bereiche, die sich mit der Erforschung erwachsener SubstanzkonsumentInnen befassen - beispielsweise aus dem subkulturellen Bereich der Techno-Szene, bei ÄrztInnen und PsychologInnen oder bei Mitgliedern religiöser Gemeinschaften (Santo Daime Gemeinschaft).
9 Mit „Drogenumgang“ sind – im Sinne Kemmesies (2004: 48f) - alle Tätigkeiten, Verhaltensweisen und Einstellungen angesprochen, die im Zusammenhang mit Drogen stehen (siehe Kapitel 2.7.4).
10 Es fand auch eine quantitative, fragebogenbasierte Abschlusserhebung statt. Diese zählte jedoch nicht zu meinem Aufgabengebiet.
11 Da es sich bei der RISA-Studie um eine auf zehn Jahre angelegte Längsschnittstudie handelte und meine Arbeit erst zum Zeitpunkt der Abschlusserhebungen begann, lagen daher bereits mehrere hundert qualitative (problemzentrierte) Interviews von ca. 80 Jugendlichen aus einem Zeitraum von ungefähr sechs Jahren und insgesamt neun Erhebungszeitpunkten vor.
12 Bezüglich der qualitativen Datenerhebung, gab es keine konkreten Vorgaben. Präferiert wurden aber umfangreiche, an narrativen Interviews orientierte, bilanzierende Abschlussinterviews sowie eine Berücksichtigung der bereits vorhandenen längsschnittlich erhobenen Daten. Da dies pro Person ca. sechs ein- bis dreistündige Interviews bedeuten würde, gingen wir zunächst von einer Stichprobe von ca. 10-15 Jugendlichen aus, die nach dem Prinzip der maximalen Kontrastierung ausgewählt werden sollten, um sowohl eine ausreichende „Breite“, als auch „Tiefe“ der Interviews erreichen zu können.
13 Alkohol und Cannabis wurden gewählt, da es sich hierbei um die beiden gesellschaftlich am weitesten verbreiteten (Reitox Bericht 2011) und am besten erforschten legalen (Alkohol) und illegalen Substanzen (Cannabis) handelt. Einerseits konnte das Modell der Integration damit sowohl an einer legalen wie einer illegalen Substanz erprobt werden. Andererseits konnte so auch ein durch die neue Perspektive ermöglichter zusätzlicher Erkenntnisgewinn besser abgeschätzt werden.
14 Recherchen in Bibliotheken der Universitäten Kassel (OPAC, KARLA), Göttingen und Köln führten zu keinem Ergebnis bezüglich der Anfrage nach integrativem Umgang mit Drogen bei Jugendlichen. Integrativer Umgang alleine führte am ehesten zu Publikationen aus der (akzeptierenden) Drogenarbeit, die den Wunsch nach einer verbesserten Integration von abhängigen Jugendlichen in die Gesellschaft zum Thema hatten. Auch eine Internetrecherche ergab ein ähnliches Bild. Es gibt nach meinem Wissen keine andere qualitative Längsschnittstudie, die in Verbindung mit einer biopsychosozialen und salutogenetischen - nicht auf die Entstehung von Sucht etc. fokussierten - Perspektive, den Entwicklungsabschnitt der Adoleszenz erforscht. Auch das Modell der Integration ist neu und wurde bislang nicht angewendet.
15 Dennoch sind mir keine qualitativen Studien bekannt, die den Drogenkonsum Jugendlicher über eine längere Zeit unter salutogenetischer Perspektive untersuchen und dabei innerhalb einer Studie auf die unterschiedlichen Auswirkungen und (Integrations-) Anforderungen der unterschiedlichen Substanzen vergleichend eingehen. Auch die ursprüngliche Arbeit Jungs (2006) bezog zwar legale und illegale PAS in die Analyse des Umgangs mit Drogen bei Erwachsenen ein, differenzierte jedoch nicht systematisch zwischen ihnen. Die einzige derartige Studie, die mir bekannt ist, bezieht sich auf den kontrollierten Konsum Erwachsener im „bürgerlichen Milieu“ (Kemmesies 2004). Sie vergleicht systematisch die Unterschiede zwischen verschiedenen Substanzen innerhalb derselben Studie.
16 Forschungsgegenstand waren erfahrene, erwachsene DrogenkonsumentInnen, die zum Zeitpunkt des Interviews einen kontrollierten Konsum aufweisen und als gesellschaftlich und sozial integriert gelten sollten.
2. Theoretische Grundlagen für die Konzeptualisierung des Integrativen Umgangs
Dieses Kapitel bildet zusammen mit dem Methodenkapitel den theoretischen Rahmen dieser Arbeit. Hier werden alle für das Grundverständnis des integrativen Umgangs relevanten Begriffe und Theorien vorgestellt und jeweils am Ende eines jeden Unterkapitels auf den Kontext dieser Arbeit bezogen reflektiert. Die Kapitel gliedern sich in gesundheitspsychologische, (sozial-) psychologische und entwicklungspsychologische sowie soziokulturelle Ansätze. Das Modell der Integration bekommt aufgrund der zentralen Bedeutung für diese Arbeit und der bereits bestehenden Integration verschiedenster Theorien ein gesondertes Kapitel zugeteilt. Auch eine Zusammenfassung der Erkenntnisse Jungs (2006) zum Integrationsbegriff in Kapitel 2.2.2 sowie die exkursartigen Ausführungen zu den Themen Integrale Theorie, Psychoaktive Substanzen, Bewusstsein, Werte, Identität & Persönlichkeit, sowie Sucht und Rausch erfolgen in gesonderten Kapiteln.
Abschließend findet eine Synthese17 der zugrundeliegenden Theorien mit dem Ergebnis eines erweiterten Modells der Integration statt.
2.1 Modell der Integration (Jung 2006)
Das Modell der Integration nach Jung ist theoretisches Kernstück einer Diplomarbeit, die 2006 am Institut für medizinische Psychologie fertiggestellt wurde. Das Modell entstand im Prozess der Auseinandersetzung mit verschiedenen Theorien der Psychologie und anderer Bereiche in Interaktion mit dem Forschungsgegenstand (empirische Ergebnisse) und dem RISA-Forscherteam (folgend18 Jung 2006:183ff).
Der in dieser Arbeit herausgearbeitete Integrationsbegriff ist nicht auf eine bestimmte Substanzart beschränkt, sondern bezieht sich prinzipiell auf alle psychoaktiven Substanzen19 (PAS). Integration wird nach Jung (2006: 183) „als Prozess der Ganzheitsbildung verstanden, in deren Verlauf Prozesse der Wahrnehmung und deren kognitiver und emotionaler Verarbeitung durch Assimilation und Akkommodation miteinander in Beziehung gesetzt werden. Personen (Konsumenten) benutzen dabei verschiedene Strategien der Ganzheitsbildung.“
„Als Integrationsstrategie ist an dieser Stelle zu verstehen: Methoden, Haltungen, Einstellungen und ganz allgemein Prozesse, die zur Einordnung und Bewältigung von substanzbezogenen Erfahrungen in die Persönlichkeitsstruktur und das Alltagsleben eines Konsumenten beitragen.“ (Auszug aus dem RISA-Forschungsprogramm/ Jungaberle 2002)
Das Modell der Integration ermöglicht die differenzierte Betrachtung des komplexen Ablaufs eines Integrationsprozesses. Dieser findet auf verschiedenen Ebenen statt, die in wechselseitigen Beziehungen zueinanderstehen. Folgende Elemente werden in dem Modell der Integration (Abbildung 2) unterschieden:
Auslösende Bedingungen/ Integrationsanforderungen
Integrationsspannung
Unterstützende Bedingungen/ Ressourcen
Integrationsarbeit
Bewertung des Integrationsniveaus
Abbildung 2 Modell der Integration (Jung 2006: 142)
Im Verständnis des Modells der Integration führen „ungewöhnliche Erfahrungen, die keiner alltäglichen Routine unterliegen, zu einem Spannungszustand (Integrationsspannung), wenn sie nicht direkt assimiliert werden können. Zur Lösung dieses Spannungszustandes muss ein integrierendes Thema (übergeordneter Standpunkt) gefunden werden. Hierzu sind Fähigkeiten des Erinnerns, der Symbolisierung und der Kommunikation erforderlich. Das integrierende Thema kann eine Bedeutungs- oder Sinnzuweisung, eine übergeordnete Narration oder eine sonstig geartete soziale oder kulturelle Rahmung sein. Kann eine Erfahrung nicht integriert werden, so können psychopathologische Prozesse die Folge sein (z.B. Traumatisierung).“ (ebd. 183f)
Integrationsarbeit: Die Wirkung psychoaktiver Substanzen auf den menschlichen Organismus erfordert Integrationsarbeit. Darunter versteht Jung einen aktiven „Prozess der Assimilation und Akkommodation (Ganzheitsbildung) und der Beeinflussung dieses Prozesses durch Kommunikationen zwischen Person und Umwelt (…). Dieser Prozess kann bewusst und intendiert oder unbewusst und ohne Willensanstrengung ablaufen.“ (ebd. 185)
Integrationsarbeit hat erstens den Zweck, „die Aufrechterhaltung der psychischen und sozialen Lebens- und Funktionsfähigkeit zu garantieren“ sowie „deren Steigerung im Sinne einer Erweiterung von Wahrnehmungs-, Erlebnis-, Handlungs- und Interaktionsfähigkeit. Es geht demnach einerseits darum, die Kontrolle über den Substanzkonsum aufrecht zu erhalten (nicht abhängig zu werden), und andererseits darum, die Substanzerfahrung für die eigene Persönlichkeitsentwicklung zu instrumentalisieren (über personale bis hin zur transpersonalen Entwicklung).“ (ebd. 186). Dabei werden folgende Ebenen unterschieden (ebd. 191f):
1. Kognitive Integration von Substanzerfahrungen thematisiert eine gelungene Symbolisierung und damit verbundene Erinnerungsfähigkeit, sowie die Möglichkeit zur Kommunikation über die Erfahrungen. Hilfreich sind hierbei eine entsprechende Begriffswelt zur Beschreibung und die Einbettung der Substanzerfahrungen in eine kohärente Narration der eigenen Lebensgeschichte und des Weltbildes.
2. Emotionale Integration betrifft hauptsächlich die emotionale Bewertung der Erfahrungen und ihres Wertes für das alltägliche Leben. Hierbei geht es auch um Erfahrungen, die die emotionale Erlebnisfähigkeit des Individuums an ihre Grenzen oder darüber hinaus befördern, insbesondere wenn Angst mit der Substanzerfahrung verbunden war. Als emotional erfolgreiche Integration kann gelten, wenn ein sensitiver Umgang mit Emotionen gefördert wird (repressive vs. sensitive Verarbeitung).
3. Behaviorale Integration thematisiert die Steuerungsfähigkeit eines Menschen bzw. die Regelhaftigkeit des Konsums. Verhaltenskontrolle zeigt sich, indem ein Individuum seinen Konsum den Anforderungen seines Lebens anpassen kann, d.h. inwiefern er seinen alltäglichen Pflichten und Aufgaben folgen kann – unabhängig vom spezifischen kulturellen Milieu.
4. Transpersonale oder spirituelle Integration bezieht sich auf Aspekte, die über eine personale Entwicklung hinausgehen. Wissenschaftliche Konstrukte zur Beschreibung solcher Aspekte finden sich für: Transzendente Sinnfindung (auch im Sinne Frankls, 1998), Achtsamkeit und Akzeptanz (Heidenreich 2004; Kabat-Zinn 1999), Hingabe und Mitgefühl, transpersonales Vertrauen (Belschner 2000), etc.
5. Ökonomische Integration meint die Aufrechterhaltung oder (z.B. bei Jugendlichen) das Erlangen finanzieller Unabhängigkeit und Arbeitsfähigkeit. Diese kann auch bei schlechter behavioraler Integration erhalten bleiben.
6. Interpersonelle Integration umfasst die Kontakt- und Austauschfähigkeit mit Bezugspersonen und Freunden, aber auch mit dem Arbeitsumfeld. Geschieht der Konsum nur im Geheimen, kann ein Austausch über die Erfahrungen nicht gelingen. Die Ebene der interpersonellen Integration würde dann als schlecht gelungen bezeichnet werden.
7. Körperliche Integration bezieht sich auf körperliche Folgen des Substanzkonsums. Dazu zählen im positiven Sinn eine Verbesserung der eigenen Körperwahrnehmung, aber auch die allgemeine Aufrechterhaltung oder Besserung körperlicher Gesundheit.
8. Soziokulturelle Integration betrachtet den Konsumenten im Austausch mit seiner soziokulturellen Umwelt. Ein Beispiel für eine mäßige bis schlechte Integration könnte ein junger LSD-User sein, der durch seine Substanzerfahrungen in umfassender Weise mit den Werten seiner Gesellschaft bricht und sein bislang erfolgreiches Studium aufgibt.
Integrationsspannung: Das Ausmaß der notwendigen Integrationsarbeit wird durch die Stärke der Integrationsspannung bestimmt: „Unter Integrationsspannung wird ein Spannungszustand verstanden, der durch eine Diskrepanz zwischen einem erlebten IST-Zustand und einem erwünschten SOLL-Zustand verursacht wird. Der Soll-Zustand kann in verschiedene Richtungen weisen. So kann nach einer traumatischen Erfahrung der Wunsch nach Wiederherstellung des vorigen Zustandes (…) aufkommen. Genauso ist eine positive oder mystische Erfahrung vorstellbar, die den Wunsch nach Weiterentwicklung erweckt und den Soll-Zustand als Zielvektor in der Zukunft darstellt.“ (ebd. 187) Integrationsspannung wird von Jung als eine positiv wirksame Kraft angesehen, die analog zur Theorie von Janet (vgl. Ellenberger 1998) notwendig ist, um die zur Integration benötigten psychischen Funktionen zur Verfügung zu stellen.
Auslösende Bedingungen/ Integrationsforderungen: Die Art und Stärke der Integrationsspannung wird nach Jung (2006: 187) „durch auslösende und unterstützende Bedingungen bestimmt. Integrationsforderungen stellen auslösende Bedingungen dar, welche aus der Umwelt oder dem eigenen Organismus herrühren können.“ Auslösende Bedingungen/Integrationsforderungen können folgenden Bereichen entstammen (vgl. ebd.):
1. Art und Auswirkung einzelner Substanzerfahrungen:
Ich-dystone Erfahrungen, Grenzerfahrungen, peak-experiences, bad-trips, etc. Einzelne Substanzerfahrungen stellen als außergewöhnliche Bewusstseinszustände potentielle Integrationsforderungen dar.
2. Art und Auswirkung von Konsummustern:
Auseinandersetzung mit selbst gewählten Konsumregeln oder Versagen der eigenen Leistungsmöglichkeiten etc.
3. Soziale und soziokulturelle Differenz:
Normative Anforderungen an Entwicklungen des Organismus, Übernahme gesellschaftlicher Aufgaben und Rollen, Forderungen aus Freundeskreis, Arbeitsumfeld und Familie. etc.
4. Körperliche Auswirkungen:
Körperliche Leistungsgrenzen, Konsumgrenzen zur Vermeidung einer Überdosis oder körperlicher Abhängigkeit, fehlendes Enzym zum Alkoholabbau oder genetisch verankerte Vulnerabilität zur Schizophrenie etc.
5. Psychische Auswirkungen:
Einstellungen zum eigenen Drogenkonsum, Verminderung oder Verlust alltäglicher psychischer Funktions- und Leistungsfähigkeit, Auseinandersetzung des Einzelnen mit den eigenen Leistungsmotiven etc.
Unterstützende Bedingungen/ Ressourcen sind nach Jung (2006: 189) sowohl für das Gelingen von Integrationsarbeit, als auch für die Ausbildung einer gesundheitsorientierten Integrationsspannung notwendig. Ressourcen sind in der Persönlichkeit (intern) verankerte oder im soziokulturellen Umfeld (extern) zur Verfügung stehende, bzw. erwerbbare Strukturen, Bedingungen, oder auch bekannte Techniken, die herangezogen werden können, um mit psychoaktiven Erfahrungen umzugehen. Dazu zählen beispielsweise (vgl. ebd. 189f):
1. Personale Ressourcen:
In der Lerngeschichte, Persönlichkeitsstruktur oder physischer Konstitution verankerte Ressourcen wie gesundheitsfördernde Intentionen, Selbstwirksamkeitserwartungen, Sinnfindung, Selbstreflexivität, Resilienz, Sense of Coherence, genetische Disposition, Wissen über die Gestaltung des Settings. Weiter zählen hierzu die körperliche und kognitive Fitness.
2. Techniken des Selbst:
Aus dem soziokulturellen Umfeld stammende Methoden, mit denen psychische Prozesse beeinflusst werden können, wie z.B. Meditationsformen, körperliche Aktivitäten, Tagebuchschreiben, Dialogorientierung oder auch Sharing-Runden.
3. Konfrontation mit kritischen Lebensereignissen:
Ereignisse (z.B. Verlust von Angehörigen, Geburt eines Kindes etc.), die sowohl als Auslöser fungieren können oder Integrationsspannung und –arbeit unterstützen können.
4. Kompetente soziale Netzwerke:
Sie ermöglichen einen Austausch über risikoarme und salutogene Umgangsweisen (Familie, Freundeskreis, Vereine, zivile Organisationen, Schule, Arbeit).
5. Institutionen des Gesundheitswesens:
Diese können bei Problemen und Krankheiten in Anspruch genommen werden (staatliche Drogenhilfe, Psychotherapie, Pharmakotherapie).
6. Integrative kulturelle Rahmen:
Ein Set von Ideen und Narrationen, aber auch Orte und Rituale des Drogengebrauchs. Sie dienen u.a. als „normalisierende Bezugsrahmen“ (ebd. 185, 204) und können dabei helfen, Erfahrungen mit psychoaktiven Substanzen in Weltbilder und Lebenspraxis einzuordnen. Erworbene Kompetenzen und angewandte Techniken garantieren dabei nach Jung „keineswegs einen erfolgreichen Ausgang, sondern erhöhen lediglich die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Integration.“ (ebd. 190)
Prozessbewertung: Der Erfolg der gesamten Integrationsarbeit kann im Zuge einer Prozessbewertung20 evaluiert werden. „Dabei kann Integration als Zustand im Rahmen einer Momentaufnahme sowohl aus subjektiver, als auch objektiv-normativer Sicht bewertet werden. Die Integrationsarbeit kann zu Veränderungen in Einstellungen, Erleben und Verhalten führen.“ (ebd. 191)
Im Rahmen von Jungs (2006) Studie interessierten vor allem die individuellen Selbsteinschätzungen der Konsumenten im Sinne von: „Welche Bedeutung nehmen die Erfahrungen mit psychoaktiven Substanzen in ihrem alltäglichen Leben ein?“ (ebd.: 190f). Eine „objektive“ Beurteilung ist nur durch den Bezug auf Normen möglich und immer paradigmenabhängig.
Reflexion
Das Modell der Integration bildet das theoretische Kernstück meiner Arbeit und beeinflusst zusammen mit Bronfenbrenners ökosystemischem Ansatz die Kategorisierung und Auswertung der zugrundeliegenden Interviews am stärksten. Die einzelnen Elemente des Modells der Integration wurden sowohl in die Erhebung integriert (Kapitel 3.4.2) als auch in das Codierungssystem übernommen und den ökosystemischen Ebenen Bronfenbrenners (Kapitel 2.7.6) zugeordnet.
Zum Phänomen der Akkommodation und Assimilation
Auf eine Besonderheit der von Jung beschriebenen Integrationsarbeit und die Implikationen für meine Arbeit möchte ich an dieser Stelle noch näher eingehen. Jung (2006) versteht darunter einen „aktiven Prozess der Assimilation und Akkommodation (Ganzheitsbildung) und der Beeinflussung dieses Prozesses durch Kommunikationen zwischen Person und Umwelt“ (ebd. 185).
In einer interessanten Arbeit über „Biographien jenseits von Erwerbsarbeit“ identifizierte Reißig (2010) Verlaufstypen (auf Exklusion bezogen) auf drei Ebenen: stärker, schwächer, verharrend/gleichbleibend. Bei den Bewältigungsstrategien unterscheidet sie die zwei Ebenen der Einstellungs- und Handlungsebene (ebd.: 13), wobei sie die Einstellungsebene mit eher psychologischen (passiven) und die Handlungsebene mit sozialen (aktiven) Strategien verbindet. Eine Copingstrategie besteht demnach im besten Fall in einer Verbindung zwischen Einstellungs- und Handlungsebene. Sie kann assimilativ („kreativ“, gestaltend) oder akkommodativ (Werte und Normen übernehmend21) ausgerichtet sein22, sowie zwischen diesen beiden Eigenschaften wechseln. Beide Modi reduzieren - auf unterschiedliche Weise - Dissonanzen zwischen aktueller und gewünschter Situation (IST/SOLL Differenz) und dienen in ihrem Wechselspiel als wesentliche Quelle subjektiver Lebensqualität und Resilienz (vgl. Brandtstädter 2007).
Das Interessante an der Arbeit von Reißig (2010) bestand für mich in der Unterscheidung zwischen psychologischen (passiven) und sozialen (aktiven) Strategien, um einer Exklusion (z.B. durch Arbeitslosigkeit) entgegenzuwirken sowie in der Unterscheidung von assimilativen und akkommodativen Strategien. Übertragen auf meine Arbeit findet sich diese Unterscheidung in den drei Ebenen des Modells der Integration: persönlich (psychologisch, passiv), subkulturell (eher assimilativ) und gesellschaftlich (eher akkommodativ). Hierbei ist zu beachten, dass es natürlich gewagt ist, einen psychischen Prozess (egal ob akkommodativ oder assimilativ) als „passiv“ zu bezeichnen, wovon ich mich daher eher distanzieren würde23.
Jedenfalls wirkte sich diese Arbeit im Sinne eines „sensibilisierenden Konzeptes“ (siehe Kapitel 3.1) derart aus, dass ich während des Auswertungsprozesses auf aktive und eher passive bzw. auch psychische und soziale Integrationsstrategien achtete. Da der besonders interessante Aspekt der Integrationsarbeit bei Jung (2006), wie bereits erwähnt, als „aktiver Prozess der Assimilation und Akkommodation (Ganzheitsbildung)“ verstanden wird.
2.2 Zum Begriff der Integration
Jung (2006) entwickelte das Modell der Integration in einer Auseinandersetzung mit der Empirie (Interviews mit erwachsenen, substanzerfahrenen Konsumenten), psychologischen Ansätzen und dem Integrationsbegriff. Einen Schwerpunkt bildete dabei – neben dem Salutogenesekonzept Antonovskys - eine Auseinandersetzung mit zahlreichen Ansätzen der Psychologie. Ebenfalls wurden sozialpsychologische Ansätze behandelt, allerdings weniger ausführlich. Ich werde mich daher nach der folgenden kurzen Zusammenfassung Jungs wichtigster Ansätze24 im Kapitel über die Integration aus psychologischer Perspektive (Kapitel 2.2.2) vor allem der Darstellung von Jungs Arbeit ergänzenden – und mich während des Forschungsprozesses im Kontext des Umgangs mit Drogen bei Jugendlichen leitenden - Theorien und Modellen widmen.
2.2.1 Integration im allgemeinen Sprachgebrauch
„Integration, soziale [lat. Integratio „Wiederherstellung eines Ganzen“]: Einbettung von Einzelnen in eine größere soziale Gruppe. Der Begriff wird meist im Zusammenhang mit Personen verwendet, deren soziale Integration aufgrund besonderer Merkmale (z.B. geringe Sprachkenntnisse, soziale Störungen, Behinderungen, auffallendes Aussehen) erschwert ist und die Gefahr laufen, ausgegrenzt und diskriminiert zu werden. Soziale Integration gilt heute, im Gegensatz zu früheren Jahrhunderten, als gesellschaftliche Aufgabe. Sie fordert die Zusammenarbeit unterschiedlicher Berufe und ein Umdenken in der Bevölkerung; es ist z.B. für Normalbewegliche kein Problem, Toiletten, Aufzüge oder Türen zu benutzen, die auch für Rollstuhlfahrer geeignet sind, während umgekehrt Behinderte große Mühe haben, mit den „normalen“ architektonischen Standards zurechtzukommen.“ (Brockhaus, 2001)
2.2.2 Integration aus psychologischen Perspektiven (Jung 2006)
Viele wichtige Begriffe der Psychologie sind laut Jung (2006) nur unklar definiert (z.B. der Begriff der Kognition). Dies trifft auch auf den Begriff der Integration zu. In Dorschs Psychologischem Wörterbuch ist Integration zunächst definiert als:
„Zusammenschluss, Vereinigung, Vervollständigung, Vereinheitlichung, Vorgang der Ganzheitsbildung. Psychologisch das einheitliche Zusammenwirken mit gegenseitiger Durchdringung der verschiedenen psychologischen Prozesse.“ (Häcker/Kurt 1998)
Wichtig erscheint hier insbesondere der Aspekt des „Funktionierenden Zusammenwirkens“ verschiedener psychischer Prozesse. Dies wird u.a. im Diskurs der Psychoanalyse und ihrer Abspaltungen thematisiert. In der frühen Geschichte der westlichen Psychologie ist hier nach Jung insbesondere Janet (1859-1947) zu benennen, der „Phänomene wie Hysterie, Dissoziationen und Persönlichkeitsspaltung, als Integrationsmangel bzw. Integrationsschwankung interpretierte.“ (ebd. 64)
Ähnlich früh gründete Jaensch (1930 in Jung 2006: 64) zudem die Integrationspsychologie als Teilbereich der Charakterkunde. „Nach dem Grad der Integration psychischer Vorgänge teilte er die Menschen in verschiedene Typen ein. Drei Typen der Integration (I1, I2, I3-Typ) wurden dem desintegrierten (D-Typ) Typ gegenübergestellt (Häcker/Kurt 1998). Daneben gibt es die durch besondere Labilität der Integration gekennzeichneten S-Typen der Synästhetiker. Jaensch stellte seine Arbeit später in den Dienst der Nationalsozialisten und verband seine Typenlehre mit rassistischem Denken.“ (ebd.)
Heute findet der Begriff der Integration in der Psychologie an erster Stelle im Rahmen der Diskussion um integrative Therapiemethoden und der Integration verschiedener Schulen untereinander Verwendung, also in der Synkretismus- und Eklektizismusdebatte (vgl. Grawe 2000).
Neben zahlreichen weiteren psychologisch/ therapeutischen Ansätzen untersuchte Jung (2006) vor allem die Bedeutung des Integrationsbegriffes im Sinne der Kognitionspsychologie, der Emotionsforschung, der psychoanalytischen und psychodynamischen Perspektive, sowie aus gestalttherapeutischer und transpersonaler Perspektive. Im Folgenden der Versuch - anhand von überwiegend zitierten Ausschnitten aus seiner Arbeit - einen kurzen Überblick über seine für die Entstehung des Modells wichtigsten Erkenntnisse zu geben.
2.2.2.1 Kognitionspsychologie
Die Kognitionspsychologie beschäftigt sich mit Vorgängen des Denkens, Verstehens und Problemlösens. Jung (2006) ging im Besonderen auf die Prozesse des Verstehens ein. Dafür spielen insbesondere die Prozesse von Assimilation und Akkommodation eine Rolle.
„Bei der Assimilation25 werden Erfahrungen über die Umwelt nach Maßgabe verfügbarer affektiv-kognitiver Strukturen aufgenommen und organisiert: Jede Erfahrung wird dabei in bereits bestehende Schemata integriert und neue Informationen an bisheriges Wissen ‚angeglichen‘. Die Akkommodation umfasst die Modifikation bereits bestehender affektivkognitiver Strukturen anhand der Umweltreize. Neue Informationen oder Umwelterfahrungen führen zu einer Veränderung und Anpassung vorhandener Schemata. Der Begriff der majorisierenden Äquilibration beschreibt den Prozess der Ausdifferenzierung affektlogischer Schemata im Rahmen der Anpassungsleistungen eines um die stabilisierende Aufrechterhaltung des optimalen Spannungsbereiches bemühten Individuums (Piaget 1975). So suchen Kinder nicht einen Zustand der Spannungslosigkeit und Ruhe, sondern die aktive Herausforderung durch die Umwelt. Eine zu hohe Anpassungsspannung in Relation zu den eigenen Fähigkeiten ist aber dysfunktional und bedarf eines aktiven Ausgleichs- und Lösungsversuchs.“ (Jung 2006: 71)
„Erfahrungen, Lebensaufgaben und Problemstellungen aktivieren also vorhandene Schemata (Information wird aufgenommen, verarbeitet und führt dann zu einer Handlungsantwort). Fehlen passende, anwendbare Schemata, dann kommt es im Erlebnisfeld zu einer weiteren Erregungssteigerung. Dies führt zum ‚Einschalten‘ von akkommodatorischen Prozessen, die auch als „optimierendes Weiterwachsen repräsentativer Schemata“ bezeichnet werden (ebd.). Es wird unterschieden zwischen evolutionärer und revolutionärer Veränderung bestehender Strukturen und Schemata. Alternativ kann das Individuum auch sogenannte ‚überbrückende Schlussfolgerungen‘ einsetzen (Resch 1999). Diese setzen zwar kurzfristig Ressourcen frei, verhindern aber eine tiefe Verarbeitung im Sinne einer Akkommodation. Im weiteren Verlauf der Verstehens- und Lernprozesse werden die Prozesse der Generalisierung und Diskriminierung als notwendige und gegenläufige Prozesse einer angepassten Übertragung der Erfahrung auf verschiedene Situationen bedeutsam.“ (ebd)
„Wichtig, vielleicht sogar unerlässlich im Zusammenhang mit der Verarbeitung und Integration von Erfahrungen mit PAS scheint also die Bildung eines integrierenden Themas, also einer bewusstseinsfähigen und erinnerbaren Symbolisierung. Ein integrierendes Thema schafft die Voraussetzung für eine längerfristige Auseinandersetzung mit den Erfahrungsinhalten. Ebenso unterstreicht Bache (Bache 2000) die für eine Integration wichtige, bewusste Aufrechterhaltung der Erfahrung im Alltag, zu der eine solche Symbolisierung zumindest hilfreich sein muss. Ein integrierendes Thema dient auch der Aufrechterhaltung einer Integrationsspannung. Wessel (1990) geht so weit, dass kein (kognitives) Verstehen ohne Symbolisierung möglich sei. (…) Unter Umständen kann die Erfahrung in künstlerischer, kreativer Weise (…) repräsentiert werden.“ (ebd: 71f)
Kognitionen und Entwicklung
Nach Resch (1999 in Jung 2006: 68) steht Entwicklung im Spannungsfeld von drei Aufgaben:
Der aktuellen Anpassungsbewältigung
Der Optimierung vorhandener Schemata, die die Kompetenzen repräsentieren
Der Desaktualisierung des unmittelbaren Erlebens, d.h. einer Freimachung des Erlebnisfeldes.
Dabei erfolgt eine „Aktualisierung von Verhaltensbereitschaften anhand einer konkreten Lebensproblemstellung. Diese Aktualisierung geht mit kognitiven und affektiven Prozessen einher“ (ebd.). „Der Begriff der affekt-logischen Schemata (Affekt-logisch strukturierte Repräsentanzen von Selbst, Objekten und dinglicher Umwelt) (Ciompi 1982) kann hierbei als Kern der zu verändernden und zu entwickelnden Strukturen verstanden werden. Assimilation und Akkommodation (Piaget 1975), Äquilibration und Abwehr wechseln sich einander ab und bestimmen das Ergebnis der Anpassung. (…) Ist weder Assimilation noch Akkommodation möglich, dann kann es je nach Alter und Entwicklungsstand zur Abwehr der Erfahrung oder Aktivierung archaischer Bewältigungsschemata kommen.“ (Jung 2006: 69) (siehe Abbildung 3).
„Erst die ‚assimilatorische Erkenntnis‘ (ebd.) führt zu einer Desaktualisierung des Erlebnisraumes. Diese ist absolut notwendig um das Wahrnehmungs- und Erlebnisfeld, in dem die ‚aktuellen Entwicklungs- und Anpassungsprozesse in Form assimilatorischer und akkommodatorischer Aktivitäten stattfinden‘ (ebd.), von der Beschäftigung mit bisherigen Erlebnissen freizumachen und Raum für die Verarbeitung neuer Erfahrung zu schaffen. Ist dieser Erlebnisraum nicht frei, ist die unmittelbare Erfahrung des Erlebens gestört. Die Abspeicherung unzureichend desaktualisierter Erlebniskonstellationen (z.B. im Rahmen erfolgter Abwehr) kann zu Sensibilisierungen und Reaktivierung im weiteren Erleben führen (vgl. Integration aus Sicht der Gestaltpsychologie und -therapie Kapitel [2.2.2.5]). So muss auch eine psychoaktive Erfahrung integriert werden, da sie sonst als desaktualisierte Erlebniskonstellation negativ wirken kann.“ (Jung 2006: 69)
Im Rahmen dieser Theorie können nach Jung auch die oft zitierten Flashbacks (wiederholtes, spontanes Auftreten von der Substanzerfahrung ähnlichen Bewusstseinszuständen ohne unmittelbare Substanzwirkung) als misslungene Desaktualisierung verstanden werden. Und zwar unabhängig von einer möglichen neurologischen Komponente/Schädigung durch die Substanzwirkung. Resch (1999 in Jung 2006) weist auf die Gefahr der Verzerrung und Veränderung wahrgenommener Fakten durch übermäßige assimilatorische Aktivitäten hin. Ganz ähnlich wird nach Jung (2006) in den Kommunikationswissenschaften die Assimilations-Kontrast-Theorie (Brockhaus, 2001) formuliert, nach der bevorzugt Informationen aufgenommen werden, die den eigenen Überzeugungen entsprechen. Dies entspräche der Abwehr von solchen Informationen, die eine Akkommodationsleistung verlangen. Dies könnte eine weitere Entwicklung des geistigen Horizontes behindern.“ (ebd. 69)
Abbildung 3 Integration durch Assimilation und Akkommodation (Entwurf Jung 2006: 69)
2.2.2.2 Emotionsforschung
„PAS können emotionale Prozesse und Erlebnisse triggern, die sich in Intensität und Qualität stark vom alltäglichen Erleben und Umgang mit Gefühlen unterscheiden. Um die Wirkungen dieser Erfahrungen auf das Individuum zu verstehen, ist der Aspekt der emotionalen Verarbeitung zu beachten.“ (Jung 2006: 82)
„Der Mensch lernt mit dem Heranwachsen den Umgang mit seinen Emotionen. Konflikte mit seiner sozialen Bezugsgruppe und erfahrene positive und negative Konsequenzen seiner Emotionen führen zu einer jeweils individuellen Emotionalität. Diese wird bestimmt durch ein jeweils individuelles Muster emotionaler Selbstkontrolle, das sich zwischen hemmendem (repressiven) oder sensitivem Umgang mit Gefühlen bewegen kann (Traue 1998). Diese für das soziale Zusammenleben wichtige emotionale Selbststeuerung kann für den einzelnen sowohl positive, als auch negative Folgen haben.“ (ebd. 82f)
„Die Hemmung von Gefühlen bedeutet eine erhebliche psychische Anstrengung und kann damit auch Folgen für die Gesundheit haben. Weiterhin kann der Prozess der emotionalen Hemmung, der sich sowohl auf das emotionale Erleben, als auch auf die emotionale Expressivität auswirkt, Konsequenzen für die zwischenmenschliche Kommunikation haben. Die repressive Verarbeitung von Emotionen ist von Prozessen der klassischen Abwehrmechanismen wie Verleugnung, Unterdrückung und Verdrängung gekennzeichnet. An ihr sind sowohl neurobiologische Mechanismen als auch kognitive Vorgänge beteiligt. Der Gegenpol dazu ist die sensitive Verarbeitung, welche sich durch eine erhöhte Aufmerksamkeit und bewusstes Erleben von Emotionen und Belastungen auszeichnet.
Emotionale Hemmungen können in diesem Zusammenhang sowohl als Ursache als auch Folge von Defiziten in der Bewältigung von Stress interpretiert werden. Eine Ursache sind sie dann, wenn aufgrund der Gehemmtheit oder der zerstörerischen Wirkung einer emotionalen Implosion (traumatische Erfahrung) emotionale Belastungen nicht aktiv bewältigt werden können. Als Folge von Bewältigungsdefiziten kann emotionale Hemmung entstehen, wenn aktives Copingverhalten (z.B. das Mitteilen von aversiven Emotionen) zu negativen Konsequenzen führt.“ (ebd. 83)
„Ähnliches kann durch eine Substanzerfahrung ausgelöst werden. Durch die Substanz ausgelöste, nicht aktiv zu bewältigende Emotionen, bspw. angstvolle Reaktionen können ursächlich für Copingdefizite sein (anhaltende emotionale Hemmung). Dies kann insbesondere in Milieus geschehen, in denen eher hedonistische Motivationen vorherrschen. Bspw. in der Partyszene ist für solch angstvolle, aversive Erfahrungen kaum Platz; sie sind auch sozial nicht erwünscht und beabsichtigt. Sie müssen regelrecht unterdrückt und gehemmt werden.
Extreme Traumata, wie sie unerwartete, aversive Erfahrungen mit PAS darstellen können, erzeugen unerträgliche Ängste bei einer maximalen physiologischen Erregung in allen Systemen, die eine vollständige Blockade von Expressivität und Verhalten sowie kognitive Bewusstseinsstörungen auslösen. Traue illustriert diesen Prozess mit dem Bild einer Explosion, die sich nach innen richtet, einer emotionalen Implosion.“ (ebd 83f)
2.2.2.3 Psychoanalyse
Jung (2006) gibt in seiner Arbeit einen kurzen geschichtlichen Abriss des Begriffes Integration in der Psychoanalyse:
Mertens (2002 in Jung 2006: 72) beschreibt in seinem „Handbuch psychoanalytischer Grundbegriffe“ Integration folgendermaßen:
„Integration liegt vor, wenn sich Gegensätze nicht ausschließen, sondern ergänzen, weil ein übergeordneter Gesichtspunkt (Funktion/System/Gestalt) sie koordiniert“. (ebd.)
Nach Jung begleitet der Begriff „Integration“ die Psychoanalyse von Anfang an. So schrieb Freud (zit. In Mertens 2002)
„Im Fortschritt der Entwicklung vom Kinde zum reifen Erwachsenen kommt es … zu einer immer weiter greifenden Integration der Persönlichkeit“ (ebd.)
Bei der Integration „werden zum einen neue Erfahrungen in die bestehende Persönlichkeit integriert, zum anderen aber auch alte Erfahrungen, die in das Unbewusste abgedrängt wurden, wieder re-integriert. Unbewusstes soll bewusstseins- oder ichfähig werden (Freud: ‚Es zu Ich’).“ (Jung 2006: 73)
Wesentliche Aspekte für die Integration werden nach Jung (2006: 73) auch von Grinberg (1990) thematisiert. “Dieser beschäftigt sich hauptsächlich im Rahmen der Migrationsforschung mit Integration. Die Sicherheit, auch große innere und äußere Veränderungen (zu denen einige Erfahrungen mit PAS gezählt werden können) zu verarbeiten, also integrieren zu können, hängt nach Grinberg (ebd.) von Identitätsgefühlen ab.“ (ebd.)