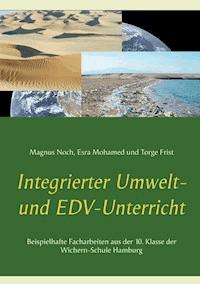
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die softwaregestützte Facharbeit als Unterrichtsmethode ist hervorragend geeignet, um SchülerInnen zu motivieren, innerlich zu differenzieren und grundlegende Anwenderkompetenzen der EDV zu vermitteln. Schülerinnen und Schüler aus der 10. Klasse der Wichern-Schule Hamburg haben sich in Facharbeiten mit verschiedenen Umweltthemen auseinandergesetzt. Drei dieser Facharbeiten liegen in diesem Herausgeberwerk vor: "Desertifikation", "Kunststoff in den Meeren" sowie "Ozon in der Atmosphäre und in Bodennähe". Die Facharbeiten entstanden im Profil "Technik und Natur" und wurden über ein ganzes Halbjahr hinweg erarbeitet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 80
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vorwort
Die überregional bekannte Wichern-Schule bietet in ihrer Stadtteilschule1 ab Klasse 7 das Profil „Technik und Natur“ (TUN) an. In der 10. Klasse lautete das Thema im Halbjahr 2017/2018 „Umwelt“.
Die Schülerinnen und Schüler (SuS) mussten über das ganze Halbjahr hinweg eine Facharbeit über ein selbst gewähltes Thema aus dem Bereich Umwelt schreiben, wobei der Unterricht ausschließlich in Computerräumen statt fand. Dieses Konzept bietet drei wesentliche Vorteile:
Durch die eigene Wahl eines Themas ist die Motivation und das Interesse am Stoff höher als bei vorgegebenen Themen.
Jede/r SuS kann in seinem Tempo und auf seinem Niveau arbeiten (Binnendifferenzierung).
Durch die langfristige Projektarbeit am Computer werden die grundlegenden Anwenderkompetenzen gestärkt.
In der 10. Klasse haben die SchülerInnen drei Stunden TUN-Unterricht pro Woche, so dass genügend Zeit zur Verfügung stand, mindestens 20 DIN-A-5-Seiten zu schreiben.
Es zeigte sich im Verlauf des Projekts, dass die Lerneffekte weit über die ursprünglichen Ziele hinaus gingen. Die SuS stellten dies erfreulicherweise auch selbst fest. Vor allem stellte sich das Projekt als lebenspraktisches Lernen heraus und es wurden Kompetenzen vermittelt, die teilweise nicht durch schriftliche Leistungskontrollen prüfbar sind.
Die Jugendlichen lernten Inhalte und „Alltagsmethoden“ sehr unterschiedlicher Niveaus, wie zum Beispiel
wie und wo man sich in Hamburg Bücher ausleihen kann (nicht nur in der Bücherhalle),
wie man belastbare Quellen im Internet recherchiert,
wie man digitale Expertentools der Hamburger Bücherhallen benutzt (in einem Seminar der Zentralbibliothek),
wie man richtig zitiert und Plagiate vermeidet,
wie man die Urheberrechte von Bildern und Grafiken beachtet und wie man die Erlaubnis einholen kann, geschützte Werken dennoch zu verwenden,
wie man mit verschiedenen Computerprogrammen umgeht.
Insbesondere der letzte Punkt war für die SuS in einer Selbstreflektion am Ende des Halbjahres wesentlich. Obwohl bereits in den vorigen Schuljahren Informatikunterricht statt gefunden hatte und obwohl auch in verschiedenen anderen Fächern mit Computern gearbeitet worden war, meinten die SuS, dass sie durch dieses Langzeitprojekt ihre Anwenderkompetenzen erheblich steigern konnten.
Um die SchülerInnen zusätzlich zu motivieren, bot ich Ihnen an, alle fertigen Facharbeiten zu einem echten Buch zusammenzufügen und per Print-on-Demand zu veröffentlichen. Zu Beginn waren alle Jugendlichen von dieser Idee und dem ganzen Projekt sehr begeistert, allerdings hielt die Begeisterung nicht bei allen über ein ganzes Halbjahr an. Selbst die SchülerInnen, die am Ende des Projekts keine hohe Motivation mehr hatten, fanden das vergangene TUN-Halbjahr jedoch sehr lehrreich. Alle 14 KursteilnehmerInnen waren der Meinung, dass diese Unterrichtsform bis auf einige Verbesserungsvorschläge auch in kommenden Klassen durchgeführt werden sollte.
Die Leistungen der SchülerInnen gingen stark auseinander, so dass sich die Noten vom oberen gymnasialen Bereich bis zum unteren Hauptschulbereich erstreckten. Viele SchülerInnen wollten letztendlich nicht, dass ihre Arbeiten veröffentlicht werden, obwohl auch ihre Arbeiten in meinen Augen für die meisten Erwachsenen absolut lesenswert sind. Ihrer Entscheidung, ihre Texte nicht zu veröffentlichen, wurde stets mit Verständnis begegnet.
Die hier abgedruckten Facharbeiten sind von hoher bis höchster Qualität. Durch ihre Leistung sind diese jungen Menschen nun schon sehr früh zu der Ehre gekommen, einen druckreifen Fachtext publizieren zu können. Darauf können die beteiligten SchülerInnen – zu Recht! – stolz sein.
Hendrik Rubbeling
Wichern-Schule im Mai 2018
1 Hamburger Stadtteilschulen sind vergleichbar mit Gesamtschulen.
Inhaltsverzeichnis
Desertifikation
Einführung
Ursachenforschung
Auswirkungen auf Bewohner betroffener Länder und die Welt im Gesamten
Voraussichtliche Entwicklung
Maßnahmen um Desertifikation aufzuhalten
Fazit
Definitionen und Erläuterungen
Quellen
Kunststoff im Meer
Einleitung
Wie kommt der Kunststoff in unsere Weltmeere?
Warum ist die Abfallentsorgung in vielen Ländern unzureichend?
Wie viel Plastikmüll schwimmt bereits in unseren Weltmeeren?.
Plastikmüll in der Arktis
Die Müllkippen der Meere
Was sind die Folgen?
Wie groß ist das Problem momentan?
Weniger Plastikmüll in den Meeren
Ist ein Leben ohne Kunststoff noch möglich?
Technische Lösungsmöglichkeiten
Wie war die Entwicklung in den letzten Jahren?
Ursachen und Gefahren für Mensch, Tier und Planet
Wie kann ich helfen?
Quellenangaben
Ozon in der Atmosphäre und in Bodennähe
Einleitung
Die Ozonschicht
Das Ozonloch – historisch und gegenwärtig
Bodennahes Ozon – Problemstoff in deutschen Städten
Chemie
Folgen / Schäden
Möglichkeiten, die Situation zu verbessern
Fazit
Quellen
Desertifikation
Darstellung des Phänomens und seiner Lösungsansätze
von Magnus Noch
Einführung
Diese Arbeit wird sich mit dem Problem der Desertifikation auseinandersetzten.
Desertifikation ist der Fachbegriff für die Bildung von Wüsten oder die Erweiterung derselben. In der Umgangssprache würde man von Wüstenbildung oder Verwüstung reden. Und während der erste Begriff eine ziemlich treffende Veranschaulichung des Vorgangs ist, bin ich der Meinung, dass „Verwüstung“ zu leicht missinterpretiert werden kann und man dadurch zu dem Trugschluss kommen kann, dass es sich bei der Desertifikation nur um das Entstehen von Unordnung handelt. Desertifikation ist nämlich sehr viel differenzierter und das Verständnis dieses Prozesses erfordert deshalb auch einige Vorarbeit.
So sollte erst einmal geklärt werden, was das Wort „Wüste“ bedeutet. Hierfür nutze ich die Definition des Dudens. Denn obwohl sie der Einfachheit halber unvollständig ist, beschreibt sie genau die Arten von Wüsten, mit denen sich dieser Text befasst:
„Durch Trockenheit, Hitze und oft gänzlich fehlende Vegetation gekennzeichnetes Gebiet der Erde, das über weite Strecken mit Sand und Steinen bedeckt ist.“2
Der Grund, warum ich eine Definition gewählt habe, in der Salz- und Eiswüsten keinen Platz finden, ist, dass es bis jetzt keine Hinweise darauf gibt, dass das Phänomen auch in diesen auftritt. Dieser Text befasst sich also hauptsächlich mit Sand- und Halbwüsten.1
Das Wort „Desertifikation“ stammt wie viele Fachbegriffe aus dem Lateinischen und leitet sich aus „deserta“ und „facere“ ab, was übersetzt so viel bedeutet wie „Wüste“ und „machen“.
Manche sehen in dieser Wortabstammung schon das indirekte Eingeständnis, dass der Mensch für die Desertifikation verantwortlich ist,3 da man „facere“ auch mit „bewirken“ übersetzten kann, was einen direkten Eingriff impliziert. Dazu komme ich im Abschnitt über den aktuellen Stand der Desertifikationsforschung und die Rolle des Menschen.
Wenn man das alles jedoch beiseite nimmt, und sich nur die Zahlen ansieht, wird eines klar: Desertifikation existiert! Schon heute sind ca. 1,5 Milliarden Menschen von den Auswirkungen der Desertifikation betroffen, wobei aufgrund unserer globalisierten modernen Welt eigentlich jeder betroffen ist. Wenn also der Preis für eine exotische Frucht steigt, kann es daran liegen, dass der Bauer einen Teil seines Feldes an die Wüste verloren hat und nun weniger Früchte produzieren kann. Denn das ist es, was das Leben dieser 1,5 Milliarden Menschen beeinflusst: Der Verlust von agrarwirtschaftlich nutzbarem Land. So werden jede Minute 24 Hektar nutzbares Land in unfruchtbare Wüste umgewandelt. Dadurch sind auf rund der Hälfte des gesamten Landes, das auf der ganzen Welt als Ackerland genutzt wird, wenigstens erste Anzeichen von Desertifikation zu sehen.4
Am Ende des Textes, vor den Erläuterungen habe ich eine Karte eingefügt, auf der man sieht, wie anfällig ein jeweiliges Gebiet gegenüber Desertifikation ist.
Bis jetzt war immer die Rede von Wüsten, die sich ausbreiten und das Land unbrauchbar machen. Leider ist das Problem nur auf den ersten Blick so einfach zu beschreiben und verstehen. Denn auch wenn wüstennahe Zonen, die zu echten Wüsten werden, am häufigsten vorkommen, kann man den leichten Rückgang in der Nährstoffhaltigkeit der Böden in manchen Teilen Europas auch als Desertifikation bezeichnen. Verena Schmitt hat diesem Thema ein ganzes Buch gewidmet: Desertifikation in der Region Murcia/Spanien5)
Um diese Unklarheiten zu lösen, und um genau feststellen zu können, wie stark ein Land oder ein Gebiet durch Desertifikation betroffen ist, haben es sich eine ganze Reihe von Experten auf dem Gebiet zur Aufgabe gemacht, den Begriff der Desertifikation zunächst klar zu definieren und am besten die Stärke des Auftretens des Phänomens zu messen. Hier gibt es einige völlig verschiedene Ansätze:
S. Nicholson und B. Tucker, zwei renommierte Wissenschaftler im Bereich der Desertifikationsforschung, beschreiben „Desertifikation“ als die Transformation von fruchtbarem Land in einen „unproduktiveren Zustand“, in dem es entweder gar nicht agrarisch genutzt werden kann, oder weniger ergiebig ist. Jedoch beziehen sie auch die klimatischen Gegebenheiten des Gebietes ein. Mit anderen Worten: Wenn man Wüsten in Regionen findet, in denen das Klima eigentlich nicht zu einer Wüste führen sollte, handelt es sich höchstwahrscheinlich um Desertifikation.6
Die UN (United Nations), oder genauer gesagt die durch sie gebildete UNCCD (United Nations Convention to Combat Desertification), geht einen etwas anderen Weg und nutzt zur Bestimmung biologische Marker und das biologische Potenzial. Das bedeutet, dass sie dann Desertifikation feststellen, wenn ihre biologischen Marker sich in einer bestimmten Weise und einem bestimmten Ausmaß verändern. Als ein solcher Marker dienen meist Tiere oder Pflanzen, die bestimmte Umstände zum Leben brauchen. Wenn also eine bestimmte Art von Busch, die viel Regen braucht, in einem bestimmten Gebiet langsam ausstirbt, dafür aber eine trockenheit-liebende Skorpionart anfängt, das Gebiet für sich zu erschließen, ist das ein sehr deutliches und gut messbares Zeichen für Desertifikation. Dazu sollte man festgelegen, ab wann die Änderungen signifikant genug sind, um zu bestätigen, dass es sich nicht nur um natürliche Schwankungen der Marker handelt.7
M. Mortimore und B. Turner fügen dieser sehr biologischen Definition noch die Komponente der „physischen Transformation“ hinzu. Diese interpretiere ich als die geologische Veränderung des Gebiets. So zum Beispiel wenn eine Landschaft, die von kleinen Erdflecken und vielen Steinen geprägt war, langsam versandet und so auch ihr Aussehen ändert.8





























