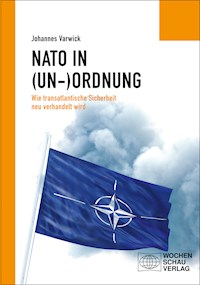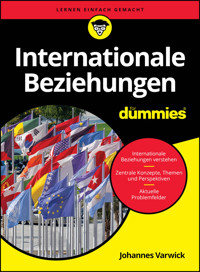
20,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wiley-VCH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Für Dummies
- Sprache: Deutsch
Internationale Verflechtungen durchblicken
Internationale Politik hat heutzutage einen zentralen Stellenwert und beeinflusst aktiv den Alltag der Menschen – gleichzeitig ist sie sehr komplex und teilweise widersprüchlich. Johannes Varwick erklärt Ihnen, wie internationale Beziehungen zu verstehen sind und wer diese gestaltet. Sie erhalten einen ??berblick über die zentralen Konzepte, Perspektiven und Themen des Fachs Internationale Beziehungen sowie über die aktuellen Spannungsfelder – von der Globalisierung über Menschenrechte und Wirtschaftsbeziehungen bis hin zu Umweltproblemen und Kriegen.
Sie erfahren
- Welchen Regeln internationale Politik folgt
- Wer internationale Beziehungen gestaltet
- Welchen Einfluss internationale Angelegenheiten auf nationale Politik haben
- Wie Weltprobleme effizient gelöst werden können
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 475
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Internationale Beziehungen für Dummies
Schummelseite
DAS (SEHR) KLEINE IB-ABC
Anarchie: Für Kooperationschancen folgenreiche Struktur der Nichtexistenz einer den Staaten übergeordneten Autorität. Sie können internationale Vereinbarungen eingehen und einhalten, aber niemand kann sie dazu zwingen.Club-Governance: Format der Zusammenarbeit, das weniger formalisiert ist als die Zusammenarbeit im Rahmen von internationalen Organisationen. Clubs wie G7, G20 oder BRICS spielen eine zunehmende Rolle in den internationalen Beziehungen.Entwicklungszusammenarbeit: Zusammenarbeit zwischen Ländern und/oder Organisationen, um wirtschaftliche und politische Entwicklung zu fördern und Lebensbedingungen zu verbessern.Frieden: Gegenteil von Krieg; Zustand, in dem Konflikte ohne Gewalt gelöst und Unterschiede kooperativ bearbeitet werden; ist voraussetzungsreich und muss »gestiftet« werden.Genfer Flüchtlingskonvention: Wichtigste rechtliche Grundlage für den internationalen Flüchtlingsschutz.Geopolitisierung: Zunehmend rauer gewordener geoökonomischer Machtkampf zwischen den Großmächten mit der Folge geoökonomischer Spannungen und negativen Konsequenzen für die Weltwirtschaft.Globalisierung: Ereignisse in einem Teil der Welt beeinflussen Gesellschaften und Problembereiche in anderen Teilen der Welt; klassische Annahme von der Einheitlichkeit von Staatsgebiet, Staatsvolk und Staatsmacht gerät ins Wanken.IB-Theorien: Identifizieren Ursache und Wirkung internationaler Zusammenhänge; Analyse der Vielfalt internationaler Prozesse und Strukturen ist ohne solche Weltbilder nicht möglich. Große Widerparte sind realistische, liberale, institutionalistische und konstruktivistische Theorieansätze.IGOS und INGOS: Staatliche oder nichtstaatliche internationale Organisationen, deren Aktivitäten die Weltpolitik in zunehmender Weise prägen.Kollektive Weltgüter: Globale öffentliche Güter wie Luft, Handelswege oder Klima, die für das Wohlergehen aller Menschen entscheidend sind, deren Schutz aber besonderen kooperativen Herausforderungen unterliegt.Kolonialismus: Ausübung der politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Kontrolle über ein anderes Land oder Gebiet, oft durch Besetzung und Ausbeutung von Ressourcen und Bevölkerung.Krieg: Militärische Auseinandersetzung zwischen Staaten, daneben zunehmend »neue Kriege« mit nichtstaatlichen Akteuren. Der Militärtheoretiker Carl von Clausewitz sprach 1832 vom Krieg als ein »wahres Chamäleon«; das heißt, Krieg stellt sich in immer neuen Formen dar.Las-Vegas-Regel: »Was dort geschieht, verbleibt dort« – hat heute angesichts vielfältiger gegenseitiger Abhängigkeiten und Problemvernetzungen nur noch sehr bedingte Gültigkeit.Menschenrechte: Grundlegende Idee über eine angemessene Behandlung von Einzelpersonen oder Gruppen, die ihnen nach allgemeiner Auffassung aufgrund ihrer Existenz unabhängig vom politischen System oder kulturellen Kontext zusteht.Multilateralismus: Praxis der Koordination nationaler Politiken von Staaten durch Ad-hoc-Vereinbarungen oder Institutionen jenseits von Uni- und Bilateralismus. Zugleich Politikstil, bei dem die zwischenstaatlichen Beziehungen auf der Basis bestimmter allgemein akzeptierter Verhaltensregeln ablaufen.Schutzverantwortung: Umstrittenes Konstrukt zum militärischen Eingreifen von außen in die inneren Angelegenheiten von Staaten bei schwersten Menschenrechtsverletzungen.Sicherheitsbegriff: Sicherheiten und Unsicherheiten werden unterschiedlich wahrgenommen und gewichtet, Bedrohungen verschieden eingeschätzt, Gefahren identifiziert oder ignoriert.Souveränität: Recht eines Staates auf innere Selbstbestimmung und selbstbestimmte Interessenvertretung nach außen.Staatlichkeit: Grundlegende Kategorie in der internationalen Politik. Der Nationalstaat hat sich seit dem Westfälischen Frieden (1648) weltweit als Ordnungsmodell etabliert. Zugleich ist es durch zerfallende Staaten und eingeschränkte staatliche Handlungsfähigkeit unter Druck.Thukydides-Falle: Tendenz eines dominierenden Staates, eine aufsteigende Macht als Bedrohung zu sehen. Diese Dynamik beruht auf der Angst vor einem Machtverlust und einer möglichen Veränderung der regionalen oder globalen Machtverhältnisse, zu sehen aktuell am Beispiel USA-China.Völkerrecht: Prinzipien und Verhaltensregeln, an die sich Staaten gebunden fühlen und die sie deshalb in ihren gegenseitigen Beziehungen freiwillig beachten (können); in der Bindewirkung aber nicht vergleichbar mit nationalem Recht.Welthandel: Wuchs jahrzehntelang stärker als die Weltproduktion, Produkte und Dienstleistungen werden für einen weltweiten Bedarf hergestellt, Kapital kann frei über den Globus fließen und sucht sich die günstigsten Anlagebedingungen.Weltordnung: Summe grundlegender Spielregeln und Prinzipien der internationalen Beziehungen. Sie umfasst das internationale System, das die Beziehungen zwischen Staaten, internationalen Organisationen und anderen internationalen Akteuren strukturiert und reguliert.Westfälische Ordnung: Neuzeitliche internationale Politik beginnend mit dem Westfälischen Frieden von 1648 als Mit- beziehungsweise Gegeneinander souveräner Staaten. Heute sprechen viele von »post-westfälischer Ordnung«.
Internationale Beziehungen für Dummies
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
1. Auflage 2025
© 2025 Wiley-VCH GmbH, Boschstraße 12, 69469 Weinheim, Germany
All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form. This book published by arrangement with John Wiley and Sons, Inc.
Alle Rechte vorbehalten inklusive des Rechtes auf Reproduktion im Ganzen oder in Teilen und in jeglicher Form. Dieses Buch wird mit Genehmigung von John Wiley and Sons, Inc. publiziert.
Wiley, the Wiley logo, Für Dummies, the Dummies Man logo, and related trademarks and trade dress are trademarks or registered trademarks of John Wiley & Sons, Inc. and/or its affiliates, in the United States and other countries. Used by permission.
Wiley, die Bezeichnung »Für Dummies«, das Dummies-Mann-Logo und darauf bezogene Gestaltungen sind Marken oder eingetragene Marken von John Wiley & Sons, Inc., USA, Deutschland und in anderen Ländern.
Alle Rechte bezüglich Text und Data Mining sowie Training von künstlicher Intelligenz oder ähnlichen Technologien bleiben vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne die schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form – durch Photokopie, Mikroverfilmung oder irgendein anderes Verfahren – in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsmaschinen, verwendbare Sprache übertragen oder übersetzt werden.
Das vorliegende Werk wurde sorgfältig erarbeitet. Dennoch übernehmen Autoren und Verlag für die Richtigkeit von Angaben, Hinweisen und Ratschlägen sowie eventuelle Druckfehler keine Haftung.
Coverfoto: hasan - stock.adobe.comFachkorrektur: Professor Dr. Stefan FröhlichKorrektur: Petra Heubach-Erdmann
Print ISBN: 978-3-527-72192-4ePub ISBN: 978-3-527-84765-5
Über den Autor
Johannes Varwick (Jahrgang 1968) ist seit März 2013 Inhaber des Lehrstuhls für internationale Beziehungen und europäische Politik an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Darüber hinaus ist er seit Mai 2024 Präses des »Wissenschaftlichen Forums Internationale Sicherheit« (WIFIS) und seit Januar 2014 Herausgeber der Fachzeitschrift POLITIKUM.
Vor seiner Tätigkeit an der Universität Halle-Wittenberg war er unter anderem Professor für Politikwissenschaft an der Universität Erlangen-Nürnberg (2009–2013) und Juniorprofessor für europäische Integration an der Universität Kiel (2003–2009). Von 2000 bis 2003 war er wissenschaftlicher Assistent am Institut für internationale Politik der Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr Hamburg, 1999–2000 Leiter des Bereichs europäische Sicherheitspolitik am Forschungsinstitut der »Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik« (DGAP) in Berlin, zuvor Fellow am »Kulturwissenschaftlichen Institut« in Essen. Von 1991 bis 1995 studierte er Politikwissenschaft, Rechtswissenschaft und Wirtschaftspolitik in Münster und Leeds.
Johannes Varwick ist einer der sichtbarsten Experten für internationale Politik in Deutschland und hat zahlreiche Bücher zu Themen der internationalen Beziehungen und der Politikwissenschaft veröffentlicht. Er forscht zu internationaler Ordnungspolitik, internationaler Außen- und Sicherheitspolitik, internationalen Organisationen und Problemen des Multilateralismus.
Er ist Präsidiumsmitglied der »Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen« und Beiratsmitglied der »Clausewitz Gesellschaft«. Sein besonderes Engagement gilt der Politikberatung und der politischen Bildungsarbeit. Seine Beiträge erschienen unter anderem in Die ZEIT, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und der Berliner Zeitung und er ist regelmäßiger Autor in Der Freitag. Zudem tritt er als Experte im Radio (unter anderem im Deutschlandfunk und verschiedenen ARD-Sendern) sowie im Fernsehen (unter anderen in den Talkshows Maischberger, Illner und Lanz) auf.
Weitere Informationen finden Sie unter www.johannes-varwick.de. Aktuelle Fragen der internationalen Beziehungen kommentiert Professor Varwick täglich auf »X« unter JohannesVarwick.
Inhaltsverzeichnis
Cover
Titelblatt
Impressum
Über den Autor
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Über dieses Buch
Törichte Annahmen über die Leser
Wie dieses Buch aufgebaut ist
Konventionen in diesem Buch
Symbole, die in diesem Buch verwendet wurden
Wie es weitergeht
Teil I: Wie internationale Beziehungen zu verstehen sind
Kapitel 1: Gegenstand und Grundprobleme der internationalen Beziehungen
Zentrale Konzepte der internationalen Beziehungen
Politik unter den Bedingungen der Anarchie
Spannungsfelder internationaler Politik
Vermittlungshindernisse
Kapitel 2: Eine kurze Geschichte der Welt
»Las-Vegas-Regel« unter Druck
Internationale Beziehungen als akademische Disziplin
Analyseebenen
Kapitel 3: Staaten in der internationalen Politik: vom Aufstieg – und Fall?
Strategien zur Stabilisierung von Staatlichkeit
Ursachen für schwache Staatlichkeit und Staatszerfall
Maßnahmen zur Stützung von Staatlichkeit
Fehlannahmen des »Nation-building«
Teil II: Welche Perspektiven und Trends relevant sind
Kapitel 4: Theoretische Perspektiven
Theorienpluralismus und seine Eckpunkte
Zusammenhang zwischen Theorie und politischer Praxis
Methodische Trends
Kapitel 5: Globalisierung als herausgeforderter Megatrend
Definitionen und Erklärungsansätze
Empirische Befunde
Erosion staatlicher Souveränität
Globalisierung unter Druck
Kapitel 6: Technologischer Wandel und Digitalisierung
Von der Erfindung des Rades bis zum Datenverkehr
Militär als Treiber technologischen Wandels
Cyberraum und Cybersicherheit
Folgen für Gesellschaften und Staaten
Kapitel 7: Völkerrecht und internationale Politik
Zwischen Politik und Recht
Ambivalentes Verhältnis
Internationale Strafgerichtsbarkeit
Teil III: Welche Themenfelder die internationalen Beziehungen prägen
Kapitel 8: Sicherheit und Unsicherheit
Krieg und Frieden: Konzepte und Empirie
Konfliktursachen und -potenziale
Wandel des Sicherheitsbegriffes
Kapitel 9: Internationale Menschenrechtspolitik
Grundlagen des internationalen Menschenrechtsschutzes
Generationen von Menschenrechten
Durchsetzungsmechanismen
Schutzverantwortung
Kapitel 10: Internationale Wirtschaftsbeziehungen
Außenhandel und der Wohlstand der Nationen
Akteure und Probleme der Welthandelsordnung
Dimensionen der ökonomischen Globalisierung
Geopolitisierung des internationalen Handels
Kapitel 11: Entwicklungspolitik
Entwicklung und internationale Beziehungen
Sinnkrise der Entwicklungspolitik
Zentrale internationale Konfliktlinie
Kapitel 12: Internationale Klima- und Umweltpolitik
Entwicklung des Politikfeldes
Klimawandel als Querschnittsproblem
Konfliktlinien in der globalen Umweltpolitik
Kapitel 13: Ressourcenpolitik
Verbrauch und Nutzung
Internationale Energiepolitik
Kapitel 14: Migration und Fluchtursachenbekämpfung
Migrationsdruck und Regelungsansätze
Fluchtursachenbekämpfung
Kapitel 15: Internationale Gesundheitspolitik
Herausforderungen der Weltgesundheitsarchitektur
Pandemien als transnationales Problem
Biosicherheit
Teil IV: Wer internationale Beziehungen gestaltet
Kapitel 16: Außenpolitiken der Großmächte
USA als herausgeforderter Hegemon
Chinas Mehrrollenstrategie
Indiens Sonderrolle
Russlands Irrwege
»Zusammengesetzte Außenpolitik« der EU
Kapitel 17: Internationale Organisationen
Unterscheidungskriterien und Typologien
Erklärungsansätze und Rollen
Entscheidungsträger in internationalen Organisationen
Kapitel 18: Der Aufstieg »der Anderen« und das Ende des Westens?
Machtpolitische Veränderungen
Aufstieg Chinas als Fallbeispiel
»Gruppe der 20« und »BRICS-Plus«
»Entwestlichung« der internationalen Ordnung
Kapitel 19: Deutsche Außenpolitik in einer turbulenten Welt
Grundorientierungen und Handlungsmuster
Ukraine-Krieg als »Zeitenwende«
Teil V: Ein Blick in die Zukunft
Kapitel 20: Die Debatte um Werte und Interessen
Fallstricke einer wertegeleiteten Außenpolitik
Kategorisierung von Interessen
Moral- versus Realpolitik
Kapitel 21: Weltregieren und Welt(un)ordnung
Gestaltungsansätze für die multipolare Konstellation
Multilateralismus und »Club-Governance«
Weltregieren ohne Weltregierung
Kapitel 22: Ob und wie Weltprobleme effizient gelöst werden
Handlungsfähigkeit der »internationalen Gemeinschaft«
Visionen einer künftigen Weltordnung
Teil VI: Der Top-Ten-Teil
Kapitel 23: Zehn strukturprägende Ereignisse
Westfälischer Frieden
Genfer Konventionen
Zweiter Weltkrieg
Kuba-Krise
Bandung-Konferenz
Weltumweltkonferenz von Stockholm
Chinesische Reformpolitik
Zerfall der Sowjetunion
Europäische Integration
Multipolarisierung der Weltpolitik
Kapitel 24: Zehn Missverständnisse über die internationalen Beziehungen
Die Staaten sind souverän
Demokratie ist der zentrale Wert
Jedes Problem hat eine Lösung
»Gut« und »Böse« sind brauchbare Kategorien
»Der Westen« ist das Zentrum der Welt
Eine »Weltregierung« könnte alle Probleme lösen
Die wichtigen Probleme bekommen die meiste Aufmerksamkeit
Weltgeschichte folgt einer inneren Logik
NGOs haben die Macht übernommen
Militärische Macht ist entscheidend
Kapitel 25: Zehn gute Internetadressen und Informationsquellen
Fachinformationen in deutscher Sprache
International Affairs Online
Deutsche Welle
Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen
Stiftung Wissenschaft und Politik
Friedensforschung
Globale und Regionale Studien
International Crisis Group
Strategische Studien
Berichte des VN-Sicherheitsrats
Kapitel 26: Zehn gute Bücher zu den internationalen Beziehungen
Kriegsgeschichte zeitlos
Friedensgeschichte zeitlos
Klassiker des politischen Realismus
Kulturen der Anarchie
Revolutionen in Geschichte und Gegenwart
Handbuch internationale Beziehungen
Handwörterbuch internationale Politik
Gelungenes IB-Lehrbuch
Weltordnungsfragen
Kritische Theorie der internationalen Beziehungen
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Stichwortverzeichnis
End User License Agreement
Tabellenverzeichnis
Kapitel 3
Tabelle 3.1: Die zehn größten Staaten der Welt 2024, Quelle: eigene Zusammenstel...
Kapitel 4
Tabelle 4.1: IB-Theorien im Vergleich, Quelle: eigene Darstellung
Tabelle 4.2: Realistische und liberale Perspektiven im Vergleich, Quelle: eigene...
Kapitel 8
Tabelle 8.1: Friedenssicherungseinsätze der Vereinten Nationen im Januar 2025, Q...
Kapitel 10
Tabelle 10.1: Grundprinzipen der VN- und der Bretton-Woods-Organisationen im Ver...
Kapitel 12
Tabelle 12.1: Länderüberschreitungstage 2025, basierend auf Daten der Situation ...
Tabelle 12.2: Meilensteine der internationalen Umweltpolitik, Quelle: eigene Dar...
Kapitel 13
Tabelle 13.1: Entwicklung des weltweiten Energieverbrauch in Terawattstunden (TW...
Kapitel 16
Tabelle 16.1: Grunddaten der fünf Großmächte im Vergleich, Quelle: eigene Darste...
Kapitel 17
Tabelle 17.1: Meilensteine in der Entwicklung von IGOS und INGOs, eigene Darstel...
Kapitel 18
Tabelle 18.1: Anteile an der Weltwirtschaftskraft nach Ländergruppen, Quelle: ei...
Kapitel 20
Tabelle 20.1: Kategorisierung von Interessen, Quelle: eigene Darstellung
Kapitel 21
Tabelle 21.1: Unterschiede zwischen altem und neuem Multilateralismus, Quelle: e...
Kapitel 22
Tabelle 22.1: Bilanz zentraler Themenfelder der internationalen Beziehungen, Que...
Tabelle 22.2: Entwicklungsmöglichkeiten für die Welt im Jahr 2040; Quelle: eigen...
Illustrationsverzeichnis
Kapitel 1
Abbildung 1.1: Widersprüchliche Trends in den internationalen Beziehungen, Quell...
Kapitel 3
Abbildung 3.1: Europa 1500, 1900 und 2020, Quelle:
Euratlas.net
Abbildung 3.2: Weltkarte 2024 © Porcupen –
stock.adobe.com
,
https://stock.adobe.
...
Kapitel 5
Abbildung 5.1: Der KOF Globalization Index, Datenquelle:
https://kof.ethz.ch/en/
...
Kapitel 8
Abbildung 8.1: Zahl der militärischen Konflikte 1946–2020, Quelle: Institute for...
Kapitel 10
Abbildung 10.1: Bruttoinlandsprodukt nach Weltregionen von 1900 bis 2020, Quelle...
Orientierungspunkte
Cover
Titelblatt
Impressum
Über den Autor
Einleitung
Inhaltsverzeichnis
Fangen Sie an zu lesen
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Stichwortverzeichnis
End User License Agreement
Seitenliste
1
2
5
6
7
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
35
36
37
38
39
40
41
42
43
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
219
220
221
222
223
224
225
226
227
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
279
280
281
282
283
285
286
287
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
Einleitung
Wenn Sie morgens (oder mittags, auch nicht schlimm) aufwachen und sich über Politik informieren, dann stolpern Sie fast unvermeidlich auch über internationale Fragen. Beim Stolpern kann man leicht hinfallen. Darum geht's hier. Zunächst beschreibe ich, wie ich Sie mir als Leser vorstelle (wenn ich danebenliege, seien Sie mir nicht allzu lange böse), und dann, wie Internationale Beziehungen für Dummies aufgebaut ist und worum es dabei eigentlich geht. Anschließend erfahren Sie, welche Symbole und Konventionen in diesem Buch verwendet werden – und wie es weitergeht.
Über dieses Buch
Internationale Beziehungen haben heutzutage einen zentralen Stellenwert und beeinflussen massiv den Alltag der Menschen. Gleichzeitig sind sie sehr komplex und teilweise widersprüchlich. Um mitreden zu können, braucht es einen Fundus an Grundwissen, der über die gegenwärtigen und schnelllebigen tagesaktuellen Entwicklungen hinaus Zugänge legt, die das notwendige Verständnis ermöglichen.
Sie erfahren, wie internationale Beziehungen zu verstehen sind und wer diese gestaltet.
Sie bekommen einen Überblick über die zentralen Akteure, Strukturen, Prozesse, Konzepte, Perspektiven und Themen des Fachs Internationale Beziehungen (IB) sowie über die aktuellen Spannungsfelder der internationalen Beziehungen – von der Globalisierung über Menschenrechte, Entwicklung und Wirtschaftsbeziehungen bis hin zu Umweltproblemen und Kriegen.
Im Unterschied zu klassischen und fußnotenlastigen Lehrbüchern oder bisherigen Einführungswerken:
erfahren Sie das Wichtigste, das Sie für ein Bachelor- oder Lehramtsstudium benötigen, sei es zur Vorbereitung auf das Studium oder in den ersten Semestern im Fach Politikwissenschaft,
können Sie es auch in Fächern wie Wirtschafts-, Geschichts- oder Kulturwissenschaft, Soziologe oder Ethnologie gebrauchen – die allesamt für Politik wichtig sind und von internationalen Beziehungen berührt sind,
ist
Internationale Beziehungen für Dummies
dennoch vergleichsweise kompakt, vor allem voraussetzungslos und ohne große politikwissenschaftliche Vorkenntnisse zu lesen,
wird auf unnötigen Fachjargon verzichtet oder er wird – so weit unvermeidbar – entschlackt und möglichst nachvollziehbar heruntergebrochen,
ist dieses Buch keine Bleiwüste, sondern kommt in aufgelockerten Abschnitten und Absätzen sowie so oft wie möglich mit Häkchenlisten wie dieser daher, verwendet zudem Symbole und Informationskästen – dazu gleich mehr,
benötigen Sie für dieses Buch zwar keine Vorkenntnisse, aber natürlich einen wachen Geist und
schlussendlich werden Sie nicht mit Meinungen und Stereotypen behelligt, müssen aber doch mitunter Positionen und Positionierung ertragen können, an denen Sie sich gerne auch mal reiben mögen.
Törichte Annahmen über die Leser
Da Sie dieses Buch bereits in die Hand genommen haben, gehe ich davon aus, dass Sie sich über den nationalen Tellerrand hinaus für Politik interessieren und wissen, dass heutzutage die internationalen Beziehungen für das Politische auch in einem einzelnen Staat auf allen Ebenen prägend sind oder es zumindest beeinflussen. Des Weiteren vermute ich, dass Sie:
mehr darüber erfahren möchten, wie der Zustand unserer Welt ist und welche Herausforderungen und Lösungsmöglichkeiten für die zahlreichen internationalen Probleme bestehen,
welche Rolle Akteure wie Staaten, internationale Organisationen und die transnationale Zivilgesellschaft dabei spielen,
in Schule, Hochschule, Universität oder in der politischen Erwachsenenbildung mit den internationalen Beziehungen als Lern- und Prüfungsstoff konfrontiert sind und dabei Unterstützung und Hintergrundinformationen suchen oder
sich als politischer Mensch für Hintergründe des »Netzwerks Weltpolitik« interessieren.
Wie dieses Buch aufgebaut ist
Internationale Beziehungen für Dummies besteht aus 26 Kapiteln, die in sechs großen Teilen organisiert sind. Die einzelnen Kapitel sind in Unterkapitel aufgeteilt, die sich je nach Interesse einzeln oder verbunden lesen lassen.
Teil I: Wie internationale Beziehungen zu verstehen sind
Hier erfahren Sie, warum sich internationale Spielregeln grundlegend von den gewohnten nationalen Spielregeln unterscheiden und warum internationale Angelegenheiten wachsenden Einfluss auf nationale Politik haben. Zudem geht es um die Eckpunkte der historischen Entwicklung der internationalen Beziehungen und um zentrale Merkmale, Spannungsfelder und Grundkategorien des Internationalen.
Teil II: Welche Perspektiven und Trends relevant sind
In diesem Teil geht es um die Frage, was die wissenschaftliche Beschäftigung mit internationaler Politik leisten kann. Dazu wird in wichtige Denkschulen wie Realismus, Liberalismus, Institutionalismus und Konstruktivismus eingeführt sowie mit technologischem Wandel, Globalisierung und Völkerrecht auf zentrale Grundlagen geblickt.
Teil III: Welche Themenfelder die internationalen Beziehungen prägen
Hier werden die Politikbereiche behandelt, die die internationalen Beziehungen prägen. Dazu zählen Sicherheit und Unsicherheit, Menschenrechte, Wirtschaft, Entwicklung, Klima und Umwelt, Migration und Fluchtursachenbekämpfung sowie Gesundheit. Die thematisch geordneten Kapitel lassen sich einzeln auch wie abgeschlossene Themenporträts lesen, die einen klaren Einblick in spezifische Aspekte der internationalen Beziehungen geben.
Teil IV: Wer internationale Beziehungen gestaltet
In diesem Teil werden die wichtigsten Akteure behandelt, die internationale Beziehungen gestalten. Das sind neben den Staaten auch internationale Organisationen vielfältiger Art. Zudem erfahren Sie Details zu der Neuverteilung von Macht und dem Aufstieg neuer Mächte sowie den Außenpolitiken der Großmächte USA, Chinas, Russland, Indien und der EU wie auch Deutschlands.
Teil V: Ein Blick in die Zukunft
Im Schlussteil geht es zunächst um das Spannungsverhältnis von Werten und Interessen und dann um einige Gestaltungsansätze für die gegenwärtige multipolare Konstellation und den Wandel von Multilateralismus und globalem Weltregieren. Sie erfahren, ob und wie Weltprobleme effizient gelöst werden und wie es um die Handlungsfähigkeit der »internationalen Gemeinschaft« steht.
Teil VI: Der Top-Ten-Teil
Im Top-Ten-Teil – dieser Teil hat beim Schreiben noch mehr Spaß gemacht und auch Kopfschmerzen bereitet als die anderen – lesen Sie dann etwas über zehn strukturprägende Ereignisse und zehn Missverständnisse der internationalen Beziehungen, zehn gute Internetadressen und Informationsquellen sowie über zehn gute Bücher zu den Internationalen Beziehungen.
Konventionen in diesem Buch
Um das Auge beim Lesen etwas zu verwöhnen, werden wichtige Schlagwörter oft fett, englischsprachige Originalbegriffe – ich habe versucht sehr sparsam damit umzugehen – kursiv gesetzt. Mitunter ist es sinnvoll, den englischsprachigen Begriff zumindest in Klammern hinzuzufügen, beispielsweise bei Eindämmung (containment) oder Staatsbildung (nation building). Abkürzungen werden so gut es geht vermieden. Bei der ersten Nennung werden Abkürzungen und notwendige Kürzel wie IGO (International Governmental Organisation, deutsch: internationale Regierungsorganisation) aufgelöst, danach meist als Abkürzung verwendet.
Symbole, die in diesem Buch verwendet wurden
In den … für Dummies-Büchern finden Sie bestimmte Symbole, die den Inhalt auflockern und auf ergänzende Informationen oder Beispiele hinweisen. In Internationale Beziehungen für Dummies habe ich die folgenden Symbole verwendet:
Hier geht es um Definitionen zentraler Begriffe und Konzepte, beispielsweise »Souveränität«, »westfälische Ordnung« oder »verzahnter Dualismus«. Diese helfen dabei, sich die dahinter stehenden Inhalte zu erschließen. Deshalb werden sie in diesem Buch hervorgehoben. In den Internationalen Beziehungen gibt es zudem eine Reihe an Begriffen, die im Alltagsverständnis eine andere Bedeutung haben – etwa die Begriffe »internationale Regime« oder »Anarchie«. Definitionen sind daher wichtig – und vermeiden oftmals Missverständnisse.
Bei diesem Symbol geht es um Beispiele, die die Inhalte verdeutlichen sollen. Von »Paketlösungen« über »Neue Seidenstraße« bis hin zu »Steueroasen« werden die Inhalte an diesen zahlreichen Beispielen exemplarisch verdeutlicht und vertieft.
Hier werden meist etwas komplexere Zusammenhänge vertiefend dargestellt. Diese sind für Interessierte und für das Hintergrundverständnis gut zu wissen, beispielsweise der »Melierdialog« oder das »Zyklenmodell«, aber es geht auch ohne.
Info-Kasten
Zudem gibt es eine Reihe an Kästen, die Hintergrundinformationen liefern, beispielsweise zu Themen wie »Globaler Süden in deutschsprachigen Medien«, »Zusammengesetzte Außenpolitik der EU« oder »Kriegstüchtigkeit als umstrittenes Paradigma«.
Wie es weitergeht
Das erste Kapitel steht nicht zufällig ganz am Anfang, sondern es ergibt Sinn, damit einzusteigen. Sie erfahren beispielsweise, warum internationale Angelegenheiten und grenzüberschreitende Herausforderungen zunehmend Einfluss auf die nationale Politik nehmen und wie das mit einem Sack Reis in China zusammenhängt. Und nein: Das hat nichts mit Landwirtschaft zu tun. Wenn Sie hart im Nehmen sind, können Sie auch gleich mit Kapitel 22 einsteigen, denn da erfahren Sie, ob und wie Weltprobleme gelöst werden können. Und Kapitel 24 räumt wie erwähnt mit einigen Missverständnissen auf – auch das könnten Sie durchaus schon gleich zu Beginn lesen.
Ich wünsche Ihnen jedenfalls Freude mit diesem Buch. Beim Schreiben hatte ich diese en masse (dies wird der einzige französische Begriff sein, den Sie in diesem Buch lesen) und habe versucht, so oft wie möglich an Arthur Schopenhauer zu denken. Der hat zwar nichts mit internationalen Beziehungen zu tun, aber in seiner Schrift Parerga und Paralipomena schrieb er 1851: »Wenn ein Autor sich bemüht, klar zu schreiben, so ist dies eine Achtung, die er seinem Leser erweist.«
Sie können selbst beurteilen, ob das auch für Internationale Beziehungen für Dummies gilt. Die Hoffnung stirbt zuletzt!
Teil I
Wie internationale Beziehungen zu verstehen sind
IN DIESEM TEIL …
Warum die Logiken internationaler Beziehungen sich grundlegend von den gewohnten nationalen Spielregeln unterscheidenWarum internationale Angelegenheiten und grenzüberschreitende Herausforderungen zunehmend Einfluss auf die nationale Politik nehmen und was das mit einem Sack Reis in China zu tun hatWie die Eckpunkte der historischen Entwicklung der internationalen Beziehungen aussehen und was zentrale Merkmale und Grundkategorien der internationalen Politik sindWarum Staat und Staatlichkeit herausgefordert sind, aber doch zentrale Kategorie der internationalen Politik bleibenKapitel 1
Gegenstand und Grundprobleme der internationalen Beziehungen
IN DIESEM KAPITEL
Worum es in den internationalen Beziehungen gehtAnarchie als zentrale GrundbedingungBesondere Logiken des InternationalenHaben Sie sich schon einmal gefragt, was zum Beispiel Bhutan und die Vereinigten Staaten von Amerika gemeinsam haben? Klar, es handelt sich in beiden Fällen um souveräne Staaten, die aus der Verbindung von Territorium, Staatsvolk und Regierung bestehen und damit die klassische Definition eines Staates erfüllen. Darüber hinaus sind sowohl Bhutan als auch die USA Mitglieder der Vereinten Nationen und verfügen damit über eine gleichberechtigte Stimme in wichtigen internationalen Angelegenheiten und Gremien – im Gegensatz zu nur teilweise anerkannten Gebieten wie Katalonien, Palästina, der Republik China (alias Taiwan) oder der Republik Kosovo.
Bhutan ist
klein
(700.000 Einwohner) und hat mit einem Bruttoinlandsprodukt von etwa 2,5 Mrd. US-Dollar eine vergleichsweise geringe Wirtschaftskraft.
Die USA sind
groß
(334 Millionen Einwohner) und sind mit einer Wirtschaftskraft von mehr als 24 Billionen US-Dollar die größte Wirtschaftsmacht der Welt.
Innerhalb der Gemeinschaft der gegenseitig anerkannten Staaten, die die Vereinten Nationen darstellt, sind dennoch alle Mitglieder, einschließlich Bhutan und den USA,
in ihrer Souveränität
gleich
, auch wenn sie sehr unterschiedliche rechtliche und faktische Möglichkeiten haben, die internationale Politik zu beeinflussen.
Anders ausgedrückt: Sie verfügen über
unterschiedliche Machtmittel
, um ihre Interessen durchzusetzen.
Die Lehre von den internationalen Beziehungen als Teil der Politikwissenschaft umfasst die vielfältigen Formen der Zusammenarbeit und Konfrontation zwischen Akteuren, die über nationale Grenzen hinweg handeln. Dies bezieht sich sowohl auf zwischenstaatliche als auch auf nichtstaatliche Beziehungen. Neben den Beziehungen zwischen Staaten und Gesellschaften spielen auch internationale Organisationen eine bedeutende Rolle.
Es hat sich etabliert, Internationale Beziehungen (IB) großzuschreiben, wenn die akademische Disziplin gemeint ist, und »internationale« klein, wenn der konkrete Gegenstand gemeint ist. Dieses Buch folgt dieser Logik.
Klassische Themen der internationalen Beziehungen (klein- und großgeschrieben) wie insbesondere Krieg und Frieden sind um weitere wichtige Themenfelder und Herausforderungen erweitert worden. Damit soll die komplexe und scheinbar unübersichtliche internationale Lage in einer »Welt in Unordnung« besser verstanden und es sollen dauerhafte analytische Ordnungsmuster entwickelt werden.
Internationale Beziehungen, die über nationale Grenzen hinausgehen, nehmen heutzutage einen
zentralen Stellenwert
in nahezu allen politischen Belangen ein. Dies betrifft nicht nur Kriege und gewaltsame Konflikte, die oft die Schlagzeilen dominieren.
Die Redewendung,
»Wenn in China ein Sack Reis«
umfällt als Metapher für die vermeintliche Bedeutungslosigkeit eines Themas gilt heute nicht mehr und entspricht auch nicht der politischen Korrektheit.
Medien liefern
in Echtzeit Informationen
aus entlegenen Teilen der Welt, politische Ereignisse werden durch Bilder und Videos von Augenzeugen in einer neuen Qualität erlebbar.
Durch
wirtschaftliche und politische Verflechtungen
, die den Großteil der Welt umfassen, gewinnt das internationale Geschehen zunehmend an Relevanz für den Alltag der Menschen.
Um es in den Worten des Kabarettisten Rainald Grebe auszudrücken: »Wenn in China ein Sack Reis umfällt:
Kurzarbeit in Bitterfeld
.«
Welche Merkmale kennzeichnen also die internationalen Beziehungen, oder anders ausgedrückt: Wie kann man sie analytisch erfassen? Um diese Frage zu beantworten, muss zunächst geklärt werden, was genau unter »internationalen Beziehungen« verstanden wird.
Wenn Sie zunächst die internationale Dimension außer Acht lassen, kann man
Politik
grundsätzlich als die autoritative Zuweisung von materiellen und immateriellen Werten in der Gesellschaft verstehen. Denn in jedem menschlichen Zusammenleben müssen Konflikte – die es immer geben wird – ausgetragen und entschieden werden. Und genau die verbindliche Entscheidung über Konflikte ist die Aufgabe von Politik. Damit eine solche Entscheidung mit Verbindlichkeit durchgesetzt werden kann, wenn sie also Geltung beanspruchen will, dann muss sie auch mit Macht verbunden sein, die Akzeptanz findet.
Die
internationale Politik
und auch die
internationalen Beziehungen
unterscheiden sich hiervon wesentlich, da sie mehr oder weniger »unter den Bedingungen der Anarchie« stattfindet, was bedeutet, dass es keine übergeordnete Instanz über den Staaten gibt. Darüber erfahren Sie gleich mehr.
Sie können zwischen
internationaler Politik
und
internationalen Beziehungen
unterscheiden. Internationale »Politik« bezieht sich dann vorwiegend auf die staatliche Dimension, während »Beziehungen« alle Akteure – also zum Beispiel auch internationale Organisationen und die internationale Zivilgesellschaft miteinschließen. »Internationale Beziehungen« ist also der umfassendere Begriff.
Unter
Außenpolitik
wird die Fortsetzung der Politik eines Staates über seine Grenzen hinaus verstanden, gerichtet auf Probleme, die außerhalb der Staatsgrenzen existieren. Mit und in Außenpolitik nimmt die im souveränen Nationalstaat organisierte Gesellschaft ihre politischen, wirtschaftlichen, militärischen und sonstigen Interessen gegenüber ihrem internationalen Umfeld wahr. Dazu gehören sowohl die Reaktionen auf von außen kommende Einflüsse und aktuelle Handlungen als auch die interessenbestimmte Einwirkung auf die Umwelt.
Zentrale Konzepte der internationalen Beziehungen
Damit sind bereits vier zentrale Kategorien der politikwissenschaftlichen Teildisziplin der Internationalen Beziehungen (IB) auf dem Tisch:
Staat
beziehungsweise Staatlichkeit
:
Dies stellt die grundlegende Kategorie in der internationalen Politik dar, wobei das Modell des Nationalstaats weltweit als vorherrschendes Ordnungsmodell etabliert ist (siehe
Kapitel 3
). Wenn Sie beispielsweise ein hypothetisches außerirdisches Wesen fragen würden, was an der Organisation unseres Planeten besonders auffällt, würde er oder sie höchstwahrscheinlich als Erstes erwähnen: »Ihr habt hier Ländergrenzen, und Macht ist bei euch in Staaten unterschiedlicher Größe und Bedeutung organisiert.«
Souveränität
:
Zentrales Konzept, das die Autonomie und Unabhängigkeit von Staaten bezeichnet (dazu gleich mehr).
Macht
und Hierarchie
:
Macht ist ein entscheidender Faktor, der die internationalen Beziehungen prägt, und sie bringt implizit Hierarchien zwischen Staaten hervor. Herrschaftslosigkeit bedeutet freilich nicht, dass keine Macht vorhanden wäre. Während Macht eine generelle Fähigkeit zur Einflussnahme ist, stellt Herrschaft eine spezifische Form der Macht dar, die durch Legitimation und Institutionalisierung gekennzeichnet ist.
Interesse als Ziel der Machtausübung:
Das Verfolgen eigener Interessen ist das Ziel, das durch die Ausübung von Macht in der internationalen Politik angestrebt wird.
Die Bedeutung von geografischen Faktoren in der internationalen Politik ist erheblich. Die Politik von Großmächten wie den USA, China oder Russland lässt sich insbesondere durch den Zusammenhang zwischen geografischen Gegebenheiten und politischen Konstellationen verstehen, die unter dem Begriff »Geopolitik« gefasst wird. Das Konzept des »Gleichgewichts der Mächte« ist ein spezifisches Denkmodell, dem die Außenpolitik verschiedener Länder in bestimmten Phasen folgte. Dies ist entscheidend für die Analyse der internationalen Beziehungen. Eine Außenpolitik, die vom Gleichgewichtsgedanken geprägt ist, akzeptiert beispielsweise die Interessen anderer Akteure als legitim und strebt danach, unter Berücksichtigung der wichtigsten Interessen zentraler Akteure ein stabiles System des internationalen Status quo zu etablieren.
Souveränität wird grundlegend als das Recht eines Staates auf innere Selbstbestimmung und selbstbestimmte Interessenvertretung nach außen verstanden. Dieses Konzept ist auch als Rechtsnorm in Artikel 2 Absatz 1 der Charta der Vereinten Nationen verankert. Dort heißt es: »Aus dieser Charta kann eine Befugnis der Vereinten Nationen zum Eingreifen in Angelegenheiten, die ihrem Wesen nach zur inneren Zuständigkeit eines Staates gehören, oder eine Verpflichtung der Mitglieder, solche Angelegenheiten einer Regelung aufgrund dieser Charta zu unterwerfen, nicht abgeleitet werden.«
In der internationalen Politik ist die Souveränität von zentraler Bedeutung, da sie die Gestaltungsfreiheit der Staaten nach innen und außen anerkennt. »Nach außen« bedeutet dabei, dass andere Staaten nicht befugt sind, sich in innere Angelegenheiten einzumischen. Dies ist ein hochaktuelles Thema, wie etwa die Beziehungen zwischen Russland und der Ukraine oder die aktuellen Herausforderungen mit Blick auf Bürgerkriege wie Syrien, Jemen oder das Vorgehen Israels in Gaza zeigen.
Wenn Staaten die Freiheit haben, ihre eigenen Ziele zu formulieren, entstehen nationale Interessen, ein weiteres wichtiges Konzept. Interessen sind die Beweggründe, die die Politik eines Staates in der internationalen Arena antreiben, sei es materieller oder ideeller Art. Hierbei ist das Konzept des Interesses, wie Sie in Kapitel 20 noch genauer sehen werden, umstritten:
Realistische Theorien
gehen davon aus, dass es ein quasi universales Interesse aller Staaten gibt, nämlich die Mehrung von Macht und den Ausbau der eigenen Sicherheit.
Liberale oder konstruktivistische Perspektiven
argumentieren hingegen, dass Interessen immer konstruiert sind und von strukturellen Faktoren oder verschiedenen Akteuren abhängen.
Auch die Debatte um den Zusammenhang von
Werten und Interessen
ist ein Diskussionsthema. Das Verständnis von nationalem Interesse wird zunehmend von faktischen Einschränkungen nationaler Souveränität beeinflusst, wie sie beispielsweise durch Globalisierung (siehe
Kapitel 5
) und internationale Verflechtung entstehen.
Macht
ist sowohl Mittel als auch Gegenstand des Interesses. Ähnlich wie für die Rechtswissenschaft die Norm, für die Volkswirtschaft der Nutzen und für die Finanzwissenschaft das Geld zentral sind, gilt Macht als »Fundamentalbegriff der Sozialwissenschaften«, so der deutsche Politikwissenschaftler Christian Hacke.
Politik unter den Bedingungen der Anarchie
Trotz oder gerade wegen dieser ordnenden Konzepte von Staatlichkeit, Souveränität und Macht ist die Anarchie ein zentrales Element. Anarchie beschreibt einen Zustand der Herrschaftslosigkeit und stellt eine Herausforderung für die genannten Konzepte dar. Frank Schimmelfennig, einer der führenden deutschen IB-Forscher, betont, dass Anarchie nicht nur schwerwiegende Sicherheits-, Wohlfahrts- und Freiheitsprobleme schafft, sondern auch deren wirksame Bearbeitung und Lösung in einer anarchischen Ordnung besonders schwierig ist.
Die vergleichsweise klare Form der hierarchischen Herrschaft endet auf der Ebene der Staaten. Über dieser Ebene gibt es keinen Weltstaat, sondern ein System territorial differenzierter Herrschaft. Um die Unterschiede zwischen Staat und internationalem System zu verdeutlichen, lassen Sie uns kurz ihre zentralen Merkmale vergleichen:
Das Ordnungsprinzip des Staates ist die
Hierarchie
. Der Staat besitzt das Herrschafts- und Gewaltmonopol nach innen, innerhalb seiner territorialen Grenzen.
Im Gegensatz dazu ist das Ordnungsprinzip des internationalen Systems die
souveräne Gleichheit
, deren zwangsläufige Kehrseite die Anarchie ist.
Zwei weitere Aspekte sind eng mit dem anarchischen Charakter des internationalen Systems verbunden:
Das Instrumentarium zur Regulierung von Problemen mit rechtlichen Mitteln – also das Völkerrecht – ist im Vergleich zum Nationalstaat begrenzt. Internationale Gerichtsbarkeit hat oft keine eigenständigen Mittel zur Sanktionierung von Rechtsverstößen. Die Bindungskraft internationaler Normen ist schwächer als im nationalstaatlichen Recht. Die Koordinierung der internationalen Politik ist daher auf die freiwillige Mitwirkung der Staaten angewiesen. Dabei müssen Interdependenzen – also die wechselseitige Abhängigkeit zwischen den Akteuren – berücksichtigt werden.
Es gibt zwar ein formales völkerrechtliches Gewaltmonopol, verankert beim Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, aber es existiert keine internationale Polizei oder ein ähnliches Sanktionierungsinstrument, das Verstöße gegen das Gewaltverbot wirksam durchsetzen könnte. Die Konsequenz ist die fortwährende Existenz gewaltsamer Konflikte bis hin zum Krieg.
Ein zentraler Aspekt erschwert besonders das Verständnis internationaler Politik – die Anarchieals Strukturmerkmal. Diese bezeichnet die für Kooperationschancen folgenreiche Struktur der Herrschaftslosigkeit beziehungsweise der Nichtexistenz einer den Staaten übergeordneten, zentralen Autorität mit Handlungskompetenz. Staaten können internationale Vereinbarungen eingehen und einhalten, aber niemand kann sie dazu zwingen. Völkerrecht ist mithin mehr ein politisches und oft auch politisiertes Recht als Gesetze im Nationalstaat und hat daher keine vergleichbare Wirkungskraft.
Mit Anarchie, Souveränität, Interesse und Macht sind bereits einige zentrale Konzepte benannt, die allgemeine Spezifika der internationalen Politik sind. Sie orientieren sich grob an der Zeit seit der Entstehung der modernen Staatenwelt, die in der Regel auf das Ende des Dreißigjährigen Krieges und den Westfälischen Frieden von 1648 zurückdatiert wird. Jedoch sagen sie wenig über die spezifische Struktur der heutigen Politik aus, da die Politikwissenschaft, anders als die Geschichtswissenschaft, gegenwartsbezogen arbeitet.
Spannungsfelder internationaler Politik
Um systematischer an aktuelle Herausforderungen heranzugehen, ist ein Blick ohne tagesaktuelle Brille auf einige der strukturellen Merkmale der heutigen internationalen Politik notwendig. Diese Merkmale sind durch zahlreiche Widersprüche gekennzeichnet.
Einer
Erosion nationalstaatlicher Souveränität
mit zunehmend funktionalen (also an Aufgaben und Herausforderungen orientierten) statt territorialen (also an rein staatlichen Grenzen orientierten) Handlungsräumen, aber auch Tendenzen einer Wiederkehr oder auch Rückbesinnung auf die Kategorie des nationalen Interesses.
Eine
steigende Bedeutung internationalisierter politischer Kooperationsformen
bei variierendem Verrechtlichungsgrad in unterschiedlichen Regionen und Themenfeldern.
Die
Rückkehr einer Großmächtekonkurrenz
beziehungsweise einer Art Systemkonkurrenz entlang der »Konfliktlinie Demokratie versus Autokratie«. Insbesondere zwischen den USA plus europäischen und anderen demokratischen Staaten auf der einen Seite und Russland und China, aber auch Indien, Brasilien, Südafrika, der Türkei, dem Iran, Saudi-Arabien, Ägypten, Nigeria, Indonesien und anderen Mittelmächten, die sich im »BRICS-Plus-Format« zusammengeschlossen haben, auf der anderen Seite.
Ein multidimensionaler und steigender
Problemdruck
in zahlreichen Politikfeldern wie zum Beispiel internationaler Sicherheits-, Wirtschafts-, Finanz-, Entwicklungs-, Umwelt-, Energie-, Migrations- und Gesundheitspolitik.
Lassen Sie mich schon an dieser Stelle einige der daraus resultierenden widersprüchlichen Trends der internationalen Beziehungen näher beleuchten. Die Schlagworte finden Sie in Abbildung 1.1 – und die Details in den weiteren Kapiteln dieses Buches.
Abbildung 1.1: Widersprüchliche Trends in den internationalen Beziehungen, Quelle: eigene Darstellung
In den vergangenen drei Jahrzehnten war eines der großen Themen der internationalen Politik die »Entstaatlichung«, ein Prozess, der scheinbar im Widerspruch zur Staatenlastigkeit der internationalen Politik steht.
Dies umfasst im Wesentlichen zwei unterschiedliche Phänomene: scheiternde Staatlichkeit einerseits und die freiwillige Übertragung von Kompetenzen von den Staaten an internationale Organisationen andererseits. Staaten sind grundlegend Strukturen zur Bereitstellung zentraler öffentlicher Güter für ihre Bevölkerung, wie Sicherheit, Infrastruktur, wirtschaftlicher Austausch, Gesundheit und Bildung. Das Gewaltmonopol des Staates nach innen sichert die Einhaltung gemeinsamer Regeln. Scheiternde Staatlichkeit führt zu fragilen oder gescheiterten Staaten, die weder diese Funktionen erfüllen noch das Gewaltmonopol durchsetzen oder die Wohlfahrt des Individuums fördern können. Die freiwillige Übertragung von staatlichen Kompetenzen oder Souveränitätsrechten zielt dagegen darauf ab, die Funktionen des Staates zu stärken. Sie resultiert aus der Erkenntnis über die abnehmende Steuerungsfähigkeit einzelner Staaten und den grenzübergreifenden Charakter globaler Probleme wie des Klimawandels. Die Europäische Union ist ein Paradebeispiel für eine solche Übertragung, obwohl populistische und nationalistische Entwicklungen in EU-Mitgliedsstaaten die Zählebigkeit des Staates unterstreichen.
Ein zweites großes Thema seit dem Ende des Ost-West-Konflikts ist die
Globalisierung
. Diese bedeutet zunächst, dass Ereignisse in einem Teil der Welt Gesellschaften und Problembereiche in anderen Teilen der Welt immer mehr beeinflussen. Die klassische Annahme von der Kongruenz von Staatsgebiet, Staatsvolk und Staatsmacht gerät damit ins Wanken. Globalisierung bringt auch neue Akteure wie transnationale Konzerne und transnational vernetzte Zivilgesellschaften auf die Bühne der Weltpolitik. Handlungsräume werden funktional bestimmt, was den Bedarf nach internationaler politischer Kooperation erhöht. Gleichwohl hat die COVID-19-Pandemie wie auch die zunehmende Zweiteilung der Welt infolge des Krieges gegen die Ukraine und wachsender Systemkonkurrenz zwischen den USA und China die Vorteilhaftigkeit internationaler Arbeitsteilung infrage gestellt und in vielen Bereichen zu einer erheblichen De-Globalisierung geführt (siehe
Kapitel 5
).
Ein drittes Gegensatzpaar ist das Spannungsverhältnis zwischen
Verrechtlichung und Ent-Rechtlichung
. Es existiert ein Netz von völkerrechtlichen Verträgen, das den Globus umspannt. Die Anzahl globaler, multilateraler Verträge ist hoch. Gleichzeitig steht das internationale Recht unter Druck, besonders das Gewaltverbot. Interventionen wie im Kosovo 1999, in der Ukraine ab 2022 oder in Gaza 2023 haben diesbezüglich Erschütterungen ausgelöst. Die Entscheidung für den Brexit in Großbritannien, die mangelnde Wirkungskraft der Klima-Rahmenkonvention, die Demontage des Internationalen Strafgerichtshofs oder der Ausstieg der USA aus zahlreichen internationalen Vertragswerken in den Amtszeiten des Präsidenten Donald Trump zeigen, dass die Verrechtlichung der internationalen Politik begrenzt und nicht unumkehrbar ist.
All dies wird verstärkt durch eine neue Phase der Großmachtrivalität beziehungsweise einer zunehmenden Systemkonkurrenz, insbesondere zwischen China und den USA. Chinas rasanter ökonomischer Aufstieg hat in den vergangenen Jahrzehnten zu erheblichem politischen und militärischen Bedeutungszuwachs geführt. Die COVID-Pandemie sowie der auch im Krieg gegen die Ukraine sichtbar gewordene Gegensatz zwischen Demokratien und Autokratien könnten als Verstärker für US-amerikanische Bemühungen um eine Entkopplung von China wirken. Dadurch könnten Tendenzen zunehmen, die auf eine »sektorale De-Globalisierung« hinauslaufen.
Die
Auswirkungen
auf die internationale Ordnung sind heute noch unabsehbar.
Die Entwicklung der internationalen Beziehungen der vergangenen Jahre deutet jedenfalls darauf hin, dass eine neue
Ordnung im Plural
geschrieben wird.
Es ist mithin wahrscheinlich, dass es künftig eine Welt mit
mehreren Ordnungen
geben wird, deren globale Reichweite der Vergangenheit angehören dürfte. Sie finden mehr dazu in
Kapitel 21
.
Vermittlungshindernisse
Die Tatsache, dass die internationale Politik und ihre Auswirkungen auf die nationale Politik mittlerweile alltägliche Themen geworden sind, ist keineswegs Garant für ein tiefgreifendes Verständnis der zugrunde liegenden Problemlagen. Das breite Spektrum und das heute dominierende Megaphänomen der Unübersichtlichkeit legen zwei Schlüsse nahe. Zum einen verschwimmt die Trennung von nationalen und internationalen Themen in ihrer Alltagsrelevanz für die Bürgerinnen und Bürger. Zum anderen steigt die Gefahr, die im Alltag relevanten, aber aufgrund ihrer Komplexität schwer fassbaren Themen der internationalen Politik nicht mehr hinreichend zu verstehen. Es sind insbesondere zwei strukturelle Aspekte, die das Verständnis internationaler Zusammenhänge erschweren:
Anarchie
als Strukturmerkmal internationaler Politik:
Anarchie bezeichnet, wie bereits oben erwähnt, den Zustand der Herrschaftslosigkeit beziehungsweise die Nichtexistenz einer übergeordneten, zentralen Autorität mit Handlungskompetenz für Kooperationschancen oder die Sanktionierung von Regelverstößen. Zwischenstaatliche Kooperation ist daher auf Freiwilligkeit angewiesen, und »internationale Politik ist Politik unter den Bedingungen der Anarchie«. Wer diesen Umstand nicht hinreichend zur Kenntnis nimmt, wird falsche Erwartungen an die Handlungsmöglichkeiten in der internationalen Politik und einen verzerrten Blick auf die Welt haben.
Geringere Bedeutung von Demokratie
in den internationalen Beziehungen:
Demokratie ist für den primären politischen Bezugsrahmen der meisten Menschen konstitutiv, aber in der Sphäre der internationalen Beziehungen nur begrenzt relevant. Obwohl demokratische Werte Einzug in die internationalen Beziehungen gehalten haben, bleiben sie vorwiegend eine Domäne des Regierungshandelns, und unter diesen Regierungen sind längst nicht alle demokratisch gewählt. Ansätze einer internationalen Parlamentarisierung existieren, etwa mit der parlamentarischen Versammlung der NATO. Sie sind jedoch Ausnahmen und kaum mit nationalen Parlamenten vergleichbar.
Diese strukturellen Herausforderungen legen nahe, dass neue Zugänge für das Verständnis der internationalen Beziehungen gefunden werden müssen. Trotz oder vielleicht gerade wegen der unüberschaubaren Menge an verfügbaren Informationen scheint die Undurchsichtigkeit der Abläufe und Problemstrukturen in den internationalen Beziehungen eher größer zu werden. Diese Transparenzlücke ist nicht nur auf die beschriebene Regierungslastigkeit zurückzuführen, sondern auch auf die Komplexität des internationalen Systems und die Interdependenz der verschiedenen Bereiche.
Interdependenz
bezieht sich hier auf die Verwobenheit verschiedener Akteure, Strukturen, Prozesse und Themen. Mit Ausnahme ökonomischer Interdependenzen, die sich beispielsweise durch Waren- und Kapitalströme nachzeichnen lassen, bleibt der Begriff der Interdependenz in der Regel eher eine Beschreibung als eine Erklärung.
Die mangelhafte analytische Qualität ergibt sich aus dem Wesen des Begriffs, da gegenseitige Abhängigkeit zunächst offenlässt, in welche Richtung eine
Kausalkette oder Handlungsfolge
vorwiegend verläuft.
Ein weiteres Hindernis für Außenstehende ist die Komplexität internationaler politischer Prozesse. Zahlreiche Gipfeltreffen, oftmals medial aufwendig inszeniert und oft bewusst als Symbolpolitik konstruiert, suggerieren bedeutende Entscheidungshandlungen. In Wirklichkeit gehen diesen Konferenzen jedoch zahlreiche kleine Vorbereitungsschritte auf der Arbeitsebene voraus. Zudem erschweren die große Anzahl unterschiedlicher Akteure (staatliche und zunehmend auch nichtstaatliche), der Mehrebenen-Charakter der Verhandlungen (zum Beispiel Normbildungsprozesse von unten und die Wirksamkeit globaler Normen auf lokaler Ebene) sowie der Wandel der Steuerungsmodi (zunehmend horizontales statt eines hierarchischen Regierens) das Verstehen durch Außenstehende.
Ein Beispiel für die prozessuale Undurchsichtigkeit in den internationalen Beziehungen ist das weitverbreitete Phänomen der Paketlösungen bei internationalen Verhandlungen. Eine Paketlösung ist zunächst ein interessantes Verhandlungsinstrument, weil es den Akteuren ermöglicht, Präferenzen bezüglich mehrerer, ganz verschiedener Themen auszudrücken und im Sinne einer Art »Kuhhandel« in einer für sie weniger wichtigen Materie Zugeständnisse zu machen, um dafür an anderer Stelle Unterstützung zu erhalten. Dies ist jedoch unvermeidbar mit einem Transparenz- und auch Logikdefizit verbunden.
In den vergangenen drei Jahrzehnten hat sich nicht nur die weltpolitische Realität grundlegend gewandelt, sondern damit auch die Disziplin der Internationalen Beziehungen (IB).
Dies bringt neue Herausforderungen für alle mit sich, die sich mit internationaler Politik beschäftigen, und erhöht den Bedarf nach
Orientierungswissen
erheblich.
Neue Themenfelder, Akteure und Problemkonstellationen gehen mit
Schwerpunktveränderungen
, aber durchaus auch partieller Kontinuität in der wissenschaftlichen Beschäftigung mit den IB einher. Dies beeinflusst die Gegenstände, Theorien und methodischen Ansätze der Disziplin erheblich.
Die potenziellen negativen Folgen eines
Missverstehens internationaler Beziehungen
sind vielfältig, von der teils naiven Annahme, die Logiken nationaler Politik (Hierarchie und Demokratie) seien auf die internationale Politik übertragbar, über Verschwörungstheorien und einen irrationalen Umgang mit internationalen Aspekten bis hin zu einer diffusen Ablehnung des Fremden, die in aggressiven Nationalismus umschlagen kann.
Kapitel 2
Eine kurze Geschichte der Welt
IN DIESEM KAPITEL
Weltgeschichte im SchnelldurchgangPrägende EreignisseIB als akademische DisziplinSeitdem sich vor vermutlich mehr als 3,5 Milliarden Jahren das Leben auf der Erde entwickelte, ist unser Globus in seinen grundlegenden Dimensionen unverändert. Auch wenn manche zeitweise etwas anderes glaubten: Die Erde ist eine Kugel. Wenn Sie sich an das hypothetische außerirdische Wesen aus Kapitel 1 erinnern, dann wäre seine Aussage zur gegenwärtigen Welt (»Ihr habt Ländergrenzen, und Macht ist in Staaten unterschiedlicher Größe und Bedeutung organisiert«) aber sicher nichts, was zu anderen Zeiten so gesehen worden wäre.
Die Erdgeschichte wird klassischerweise unterteilt in vier Erdzeitalter (Erdfrühtum, Erdaltertum, Erdmittelalter und Erdneuzeit), kürzere Abschnitte werden Perioden genannt, noch kürzere Epochen.
Derzeit leben Sie in der Erdneuzeit, in der Periode Quartiär und der Epoche Holozän, die vor etwa 12.000 Jahren begann. Doch erst vor einigen Millionen Jahren begann ganz allmählich die Entwicklung des Menschen, der nach heutigem Verständnis erst rund 200.000 Jahre die Erde bevölkert. Klimaveränderungen und wechselnde Umwelteinflüsse zwangen den Frühmenschen, sich immer wieder anzupassen.
Viele argumentieren, dass es angebracht ist, die gegenwärtige, in vielerlei Hinsicht menschlich dominierte geologische Epoche als Anthropozän (und damit fünftes Erdzeitalter) zu bezeichnen. Sie und ich leben in einem Zeitalter, in dem die Spuren des Menschen so tief in die Erde eindringen, dass es auch nachfolgende Generationen als ein ganzes Zeitalter, das maßgeblich vom Menschen geprägt wurde, ansehen werden. Das sind beispielsweise Spuren von Kernwaffentests, des rasanten Bevölkerungswachstums, der Klimaveränderung, der Rohstoffausbeutung, des Mikroplastiks in den Ozeanen (siehe Kapitel 12).
Lange bevor Staaten oder Gesellschaften nach heutigem Verständnis existierten, gab es prähistorische Stämme und Völker, die miteinander oder auch gegeneinander handelten. Im Zeitverlauf entstanden dann kleinere und größere Stadtstaaten, Reiche und Imperien, die teils eher abgeschlossen agierten, teils aber auch rege Beziehungen miteinander pflegten. Die Geschichte der internationalen Beziehungen lässt sich insbesondere als eine Geschichte vom Aufstieg und Fall von kleinen und großen Mächten lesen. Pax Romana, Pax Britannica, Pax Mongolica, Pax Osmanica oder Pax Americana prägten die Welt zu unterschiedlichen Epochen auf unterschiedliche Weise. Die Begriffe deuten darauf hin, dass stabile Machtbereiche als Friedensordnungen verstanden werden wollten (lateinisch pax – Frieden). Umbrüche in den übergeordneten Machtstrukturen gingen in der Regel mit großer Unsicherheit und Kriegen einher. Die Wahrnehmung einer zyklischen Geschichte der Weltordnungen ist dabei beinahe so alt wie die Geschichtsschreibung selbst.
Bereits der griechische Historiker Herodot(484–425 vor Christus) arbeitete Gesetzmäßigkeiten der internationalen Politik heraus und argumentierte, dass sich alles Menschliche im Kreislauf vollziehe. Die Weltgeschichte dulde nicht, dass immer die Gleichen glücklich leben. Auch Thukydides (460–396 vor Christus), der sich als einer der Gründungsväter der IB als akademische Disziplin bezeichnen lässt, analysierte die politischen Antriebskräfte in der griechischen Antike. Seine Geschichte des Peloponnesischen Krieges, also des jahrzehntelangen Machtkampfes zwischen Athen und Sparta, an dessen Ende die athenische Demokratie gegen das spartanische Königtum unterlag, gilt als Klassiker der Geschichtsschreibung. Im darin enthaltenen Melierdialog wird mustergültig die oftmals prekäre Wechselwirkung zwischen Recht, Macht und Moral beschrieben. Thukydides behandelt die Frage, wie Großmächte handeln und ob oder inwieweit die eigene Überlegenheit und die eigenen Interessen durch rechtliche Regelungen zugunsten der Schwächeren begrenzt werden können.
Die griechische Staatstheorie stellt die Stadt (griechisch polis, Ursprung des modernen Wortes Politik) ins Zentrum, doch der Weltreichsgedanke (lateinisch Imperium) prägte die Wahrnehmung der Weltgeschichte und besteht bis in die jüngste Geschichte (das »Dritte Reich«). Imperiale Reiche, wie das Perserreich, das Reich Alexanders des Großen oder das Römische Reich waren geprägt durch die Eroberung des nahezu gesamten damals bekannten internationalen Systems von einem starken Zentrum aus. Dieses Zentrum hat dann versucht, das gesamte Gebiet sehr großflächig zu unterwerfen. Mittelalterliche Konzepte der von Gott geordneten Welt denken die Geschichte als eine Abfolge von Weltreichen, weshalb sich das »deutsche« Königreich als Fortsetzung des Römischen Reiches verstand (»Weltreichsgedanke«). In der Realität bestehen aber parallel zu den großen Reichen immer auch verschiedenste Formen und Ausprägungen von Staatlichkeit, etwa:
Stammesstaaten,
Fürstentümer,
Stadtstaaten,
religiös begründete Staaten und anderes mehr.
Im mittelalterlichen Reich war Herrschaft geprägt von mehreren parallelen und sich überlappenden Ansprüchen. Die Könige und Fürsten besaßen in diesem System zum einen nur einen mittelbaren Zugriff auf die Bevölkerung. Anstelle des Gewaltmonopols des modernen Staates existierten autonome Befugnisse auf allen Herrschaftsebenen. Zum anderen gab es eine Trennung zwischen weltlichen und geistlichen Herrschaftsangelegenheiten. Gleichzeitig entwickelten sich in England und Frankreich seit dem Spätmittelalter die ersten Strukturen institutionalisierter Staatlichkeit, die sich in der Frühen Neuzeit in Europa schrittweise durchsetzt. Mit dem »Westfälischen Frieden« von 1648 (siehe Kapitel 3) wird diese Form der staatlichen Organisation kodifiziert: Der moderne National- beziehungsweise Territorialstaat nach einem neuzeitlichen Verständnis entsteht. Diese Strukturen treten neben die traditionellen Denkmuster. So endet das Römische Reich formal erst 1806 mit der Gründung des napoleonischen Rheinbundes und der Niederlegung der Reichskrone.
Außerhalb des lateinischen Westens stiegen andere Großmächte auf und vergingen wieder. So war China im frühen 15. Jahrhundert sicher einer der am höchsten entwickelten Staaten weltweit, verlor dann aber für einige Jahrhunderte seine Vorherrschaft. Mit der Einnahme Konstantinopels 1453 endete das ehemals oströmische, Byzantinische Reichund das heutige Istanbul wurde zur Hauptstadt des Osmanischen Reichs. Dieses prägte fast fünf Jahrhunderte die internationale Politik, bis die Niederlage im Ersten Weltkrieg zur Schaffung der bis heute weitgehend so bestehenden Staatenwelt auf dem Balkan und im Nahen Osten führte. Durch die Entdeckung Amerikas wurde die bekannte Welt plötzlich ein Stück größer und die Weltmachtansprüche wuchsen mit ihr. Das Habsburgerreichunter Karl V. erstreckte sich von der Westküste Nord- und Südamerikas bis zu den Grenzen des Osmanischen Reiches. Das British Empirespannte sich im frühen 19. Jahrhundert über den Globus von Kanada über Ägypten und Indien bis nach Neuseeland – und hat seinen Weltmachtstatus heute ebenso verloren wie Frankreich, das seit Ende des 16. Jahrhunderts seine Kolonien eroberte und zeitweise die zweitgrößte Kolonialmacht der Welt war.
»Las-Vegas-Regel« unter Druck
Im Zuge von Kolonialismus, Industrialisierung, Imperialismus und Kapitalismus und dem damit verbundenen rasant gestiegenen Handel und Warenverkehr entwickelten sich internationale Beziehungen in voller globaler Reichweite. In der Folge prallten auch Kulturen und Imperien aufeinander, bei denen die einen sich ausdehnten, die anderen marginalisiert oder vernichtet wurden. Auch mit zunehmendem technischen Fortschritt wurden Ideen und Interessen tendenziell vermehrt planetarisch verstanden. Trotz etlicher Konstanten hat sich die Art und Weise, wie Menschen leben und wie und in welchem Rahmen politische Herrschaft ausgeübt wird, fundamental und permanent gewandelt. Die »Las-Vegas-Regel« – was dort geschieht, verbleibt dort – hat heute nur noch sehr bedingte Gültigkeit.
Zu den prägendsten Ereignissen der jüngeren Weltgeschichte zählen die französische und russische Revolution, der Erste Weltkrieg und der Zweite Weltkrieg, der Ost-West-Konflikt sowie der Entkolonialisierungsprozess.
Mit der
Französischen Revolution
von 1789–1799 wurde die Feudalherrschaft gewaltsam abgeschafft und in Frankreich eine bürgerliche Republik mit Volkssouveränität und Liberalisierung etabliert. Sie hatte fundamentale Auswirkungen auf das politische Europa und darüber hinaus und war einerseits gekennzeichnet durch den Kampf für bürgerliche Freiheitsrechte, der aber andererseits zunehmend mit Terror gegen die vermeintlichen Feinde der Revolution vorging. Sie wurde damit Modell dafür, wie eine Volkserhebung Errungenschaften bringen, aber auch zu Tugendterror und Krieg führen kann.
Mit der
Russischen Revolution
von 1917 wurde zunächst die autokratische Zarenherrschaft im Russischen Reich und dann mit der Oktoberrevolution die provisorische bürgerliche Regierung gestürzt und durch eine Räteregierung ersetzt. Mit der Sowjetunion entstand der erste kommunistische Staat der Welt, der eine Art Weltrevolution anstrebte und das 20. Jahrhundert weltweit prägte. Ihre Auflösung im Jahr 1991 hatte fundamentale Konsequenzen. »Wir schliefen in einem Land ein und wachten in einem anderen auf« – dieser Satz wird häufig von ehemaligen Sowjetbürgern verwendet. Grenzen, die davor innerstaatlich waren, waren über Nacht international geworden. Viele der ehemals zur UdSSR (Russland, die Ukraine, Kasachstan) beziehungsweise dem Ostblock (Polen) gehörenden Staaten sind heute bedeutende Akteure in den internationalen Beziehungen. Der Zusammenbruch der UdSSR war ein Katalysator für umwälzende Veränderungen in Eurasien, Osteuropa und der Weltpolitik insgesamt, die bis heute nachwirken. Krisen und Kriege, wie der russische Überfall auf die Ukraine oder der langjährige Konflikt zwischen Aserbaidschan und Armenien um die Enklave Bergkarabach, sind indirekte Folgen jener Ereignisse.
Der als »Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts« geltende Erste Weltkrieg, in den von 1914 bis 1918 rund 34 Staaten und ihre Kolonien verwickelt waren, forderte über 17 Millionen Tote.
Der Krieg wurde zwischen den Mittelmächten Deutschland und Österreich-Ungarn sowie Frankreich, Großbritannien und Russland ausgetragen. Er änderte die internationale Politik grundlegend. Die politische Landkarte Europas und des Nahen Ostens wurde neu gezeichnet, Imperien – die Vielvölkerstaaten Österreich-Ungarn und das Osmanische Reich – wurden aufgelöst und aus ihrer Konkursmasse entstanden neue Staaten. Der Erste Weltkrieg leitete auch den Abstieg Europas in der Welt ein. Der Versailler-Vertrag 1919 wies dem Deutschen Reich die Alleinschuld am Ausbruch des Krieges zu und sah für Deutschland Gebietsabtretungen und Reparationszahlungen vor. Eine Phase ökonomischer Prosperität wurde durch Jahrzehnte von Krisen abgelöst und mündete schließlich auch in die Massenbewegungen Faschismus und Kommunismus.
Der Zweite Weltkrieg begann im September 1939 mit dem Angriff Deutschlands auf Polen und weitete sich 1939–1945 auf verschiedene Kontinente aus und wurde von über 60 Staaten in Europa, Nord- und Ostafrika, dem Vorderen Orient sowie im Atlantik und Pazifik geführt. Er forderte bis zu 70 Millionen Tote.
In Europa endete der Krieg im Mai 1945 mit der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands, im Pazifik im September 1945 mit der Kapitulation Japans. Deutschland hatte im Laufe des Krieges weite Teile Europas besetzt und insbesondere im Osten einen Vernichtungsfeldzug singulären Ausmaßes durchgeführt und dort systematisch die Ermordung des jüdischen Teils der Bevölkerung geplant und durchgeführt. Japan besetzte bis 1941 fast ein Drittel des chinesischen Territoriums. Der Zweite Weltkrieg war die bis dahin größte Menschheitskatastrophe und ist durch den von Deutschland begangenen Holocaust (durch den mehr als 6 Millionen Juden getötet wurden), Flächenbombardements auf Städte und Zivilbevölkerung und den Einsatz von Atomwaffen (durch die USA im August 1945, was dann zur Kapitulation Japans führte) gekennzeichnet. Mit ihm wurden die weltpolitischen Gewichte grundlegend geändert. Die kriegsschuldigen Staaten Deutschland und Japan schieden als Großmächte aus, die Siegermächte USA und Sowjetunion (die mit etwa 20 Millionen Kriegstoten die höchsten Verluste zu verzeichnen hatte) stiegen zu Hegemonialmächten in ihrer jeweiligen Einflusssphäre auf, und die Zweiteilung der Welt sollte die folgenden 45 Jahre die Weltpolitik bestimmen.
Der
Ost-West-Konflikt
prägte in den Jahren 1945–1989 die gesamte internationale Politik auf eine strukturbestimmende Weise. Bei diesem Konflikt handelte es sich im Kern nicht um eine gewaltsame, sondern um eine machtpolitische und ideologische Auseinandersetzung zwischen zwei Blöcken und ihren Führungsmächten, den USA auf der einen und der Sowjetunion auf der anderen Seite.
Beginn und Ende des Ost-West-Konflikts
Bald nach Ende des Zweiten Weltkriegs gerieten die westliche Allianz um die USA und die Sowjetunion in eine »Art Kalten Krieg«. Kern waren ideologische Unterschiede beziehungsweise eine Systemkonkurrenz zwischen dem »liberal-pluralistischen Lager« (das allerdings schon deshalb nicht einheitlich war, weil es in diesem antikommunistischen Block mit Staaten wie Spanien und Portugal noch bis Mitte der 1970er-Jahre faschistische Diktaturen gab) und dem »sozialistischen Regierungsmodell«.
Beide Seiten befürchteten die Ausdehnung des jeweils anderen Machtbereichs und versuchten diesen durch eigene Stärke, mit politischen und militärischen Bündnissen wie NATO und Warschauer Pakt, extrem hohen Rüstungsausgaben sowie dem Ringen um Einflusszonen in etlichen blockfreien Regionen der Welt zu verhindern.Nachdem die Sowjetunion in Polen, Rumänien, Bulgarien und Ungarn sowjetfreundliche Regime installiert hatte, gingen die USA ab den späten 1940er-Jahren zu einer Strategie der Eindämmung (containment) über.Eine direkte militärische Konfrontation zwischen den Blöcken konnte zwar letztlich verhindert werden, es wurden aber zahlreiche »Stellvertreterkriege« in vielen Teilen der Welt geführt und die auf Atomwaffen basierende Abschreckung war letztlich erfolgreich, aber durchaus labil.Davon zeugte etwa 1962 die Kuba-Krise, bei der die Welt nur knapp an einem vernichtenden Nuklearkrieg vorbeischrammte. Gerade nach dieser Erfahrung bemühten sich beide Seiten um eine Entspannungspolitik, die gleichwohl etwa mit dem sowjetischen Einmarsch in der Tschechoslowakei 1968 Rückschläge erlitt. Dennoch begann man 1973 mit einer multilateralen »Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa«, die 1975 mit Unterzeichnung der Schlussakte von Helsinki und ihren Regelungen in den Bereichen wirtschaftliche Zusammenarbeit und Menschenrechte erfolgreich abgeschlossen wurde.Mit Amtsantritt von Michail Gorbatschow als Generalsekretär der Kommunistischen Partei der Sowjetunion im Jahr 1985 setzte dann eine Phase der Entspannung und Annäherung ein (perestroika). Spätestens mit dem Fall der Berliner Mauer