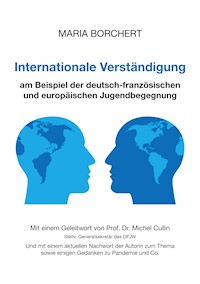
Internationale Verständigung am Beispiel der deutsch-französischen und europäischen Jugendbegegnung E-Book
Maria Borchert
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Autorin muß man äußerst dankbar sein, ... die facettenreiche Komplexität interkultureller Lern- und Begegnungsprozesse systematisch untersucht und hervorgehoben zu haben. ... Gleichzeitig zeigt sie, wie der Umgang mit doppelter Geschichtlichkeit zu jener Transkulturalität führt, die heute im Zeitalter der Globalisierung unumgänglich ist ... die Forschungen von Maria Borchert ... sind ... nicht nur für das DFJW, sondern für den gesamten deutsch-französischen Dialog der Zivilgesellschaften von eminenter Bedeutung ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 261
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
An dieser Stelle möchte ich Herrn Professor Dr. Wolfgang Neubauer, der
die vorliegende Arbeit betreut hat, meinen aufrichtigen Dank sagen.
Meiner Familie und meinen Freunden
mit Dank.
Inhaltsverzeichnis
Zum Geleit
0) VORWORT
1 Einführung:
1.1 Zur Bedeutung und Aufgabe der pädagogischen Jugendarbeit auf lokaler und internationaler Ebene
1.2 Politische Jugendbildung und die Stärkung der internationalen Verständigung
1.3 Die Internationalen Beziehungen als Rahmenbedingungen für Friedensförderung und Kulturaustausch
2 Thematische Schwerpunkte:
2.1 Deutschland und Frankreich:
2.1.1 Die historische Nachbarschaft: Über den Umgang mit Grenzen
2.1.2 Der Elysée-Vertrag von 1963 und die daraus resultierenden Möglichkeiten
2.1.3 Politische Sozialisation, Kultur und Vergangenheitsbewältigung
2.1.4 Unterschiedliche Bildungssysteme, Fremdsprachenkenntnisse und Jugendbegegnungen
2.2 Ausgewählte Konfliktsituationen in Jugendseminaren und ihre Bewältigung
2.2.1 Vom praktischen Umgang mit der Verschiedenheit durch sprachliche und nicht-sprachliche Mittel
2.2.2 Wie´s glückt oder schiefgeht: Das annähernde Scheitern und Gelingen von Jugendbegegnungen
2.3 Beeinflussende und erklärende Faktoren bei der Gestaltung von Jugendbegegnungen:
2.3.1 Die Bedeutung der Ausnahmesituation »Jugendtreffen«
2.3.2 Das interkulturelle Zusammentreffen: die Auseinandersetzung mit Unbekanntem
2.3.3 Vorausgehende Vorurteile und nationale Stereotype
2.3.4 Gemeinschaftsbildende Aktivitäten und die (mögliche) Dynamik der Kleingruppe
2.3.5 Wirkung der Räumlichkeiten, Entfernungen und Umstände am Tagungsort
2.3.6 Kommunikation, Mehrsprachigkeit, Übersetzung und Verständigung
2.3.7 Institutionelle Vorgaben und Rahmenbedingungen eines Seminars
3 Auswertung und Beurteilung:
3.1 Mögliche Konzepte der Gruppenleitung
3.2 Über die Evaluation von Jugendbegegnungen
3.3 Das Spektrum der pädagogischen Anforderungen an internationale Jugendseminare
4 Zusammenfassende Überlegungen
4.1 Ausblick
4.1.1 Geschichte – Entwicklung – Verständigung (Stichworte zu einer umgreifenden Betrachtung)
4.1.2 Grenzen und Möglichkeiten der kurzfristigen internationalen Jugendarbeit
Literaturverzeichnis:
Nach fast 20 Jahren: Ein abschließendes Kapitel / Nachwort zu meiner Magisterarbeit :
Zum Gedenken an Prof. Dr. Michel Cullin, 1944-2020, Stellv. Generalsekretär des DFJW / OFAJ von 1999-2003
Zum Abschluss:
Zum Geleit
Die vorliegende Arbeit liefert zunächst eine wesentliche Erkenntnis: ohne das Laboratorium DFJW wären die deutsch-französischen Beziehungen äußerst arm in der Substanz und in dem experimentellen Charakter. Dies gehört immer wieder hervorgehoben, weil ständig die herrschenden Diskurse – ob politischer Natur oder von den Medien verbreitet – das deutsch-französische Verhältnis als »passe« bezeichnen. Der deutsch-französische Motor hätte nur Pannen, die deutsch-französische Ehe nur Krisen und die deutschfranzösischen Beziehungen keinen Stellenwert mehr. Gerade zeigen die Erkenntnisse von Maria Borchert, dass zunächst diese als selbstverständlich geltenden Lamentos keineswegs der Wirklichkeit entsprechen und dass dann diese Beziehungen zwischen den beiden Zivilgesellschaften lebendig und vielfältig sind solange man sich mit ihnen ernsthaft beschäftigt und sich nicht mit Sonntagsreden und Floskeln über die »ewige Freundschaft« zwischen Deutschen und Franzosen begnügt.
Der Autorin muss man äußerst dankbar sein, dass sie ihre Methodik und ihre Analysen von den Forschungsarbeiten herleitet, die Jahrzehnte lang unter der genialen Leitung von Ewald Brass das DF JW bereichert haben. Es sei nur an Namen wie Jean-Rene Ladmiral, Jacques Demorgon, Rene Barbier, Burkhard Müller, Hans Nicklas, Christoph Wulf, Klaus Eder, Pascal Dibie, Dany Dufour, Herbert Swoboda, Jeanne Kraus, Lucette Colin und so viele andere erinnert, die diesen unglaublichen Reichtum angesammelt haben, der das intellektuelle Kapital des DFJW durch die Jahre vermehrt hat.
Der Autorin muss man äußerst dankbar sein, sich in diese gute Tradition eingereiht zu haben und somit die facettenreiche Komplexität interkultureller Lern- und Begegnungsprozesse systematisch untersucht und hervorgehoben zu haben. Nicht im Elfenbeinturm der universitären Forschung sondern aus der Realität und Praxis der deutsch-französischen Jugendbegegnungen heraus. Statt einer Friedenspädagogik, die Homogenität und Einseitigkeit reproduziert, das Wort zu reden, bietet Maria Borchert eine Auseinandersetzung mit Fremdheit als Weg zur Selbsterkenntnis – durchaus im Sinne der oben zitierten »Ecole de Paris« in den interkulturellen Studien. Statt Modelle, wie das so oft und so falsch heraufbeschworene deutsch-französische Modell, zu propagieren, untersucht z.B. Maria Borchert die doppelte Geschichtlichkeit, die themenzentrierte Jugendbegegnungen charakterisiert. Gleichzeitig zeigt sie wie der Umgang mit doppelter Geschichtlichkeit zu jener Transkulturalität führt, die heute, im Zeitalter der Globalisierung, unumgänglich ist. Eine Transkulturalität, die keineswegs von »oben« kommt, diktiert oder postuliert wird, sondern die interkulturellen Lern- und Lehrprozessen zugrunde liegt und die »dynamische Empathie« beim Fremden fördert ohne sich im Anderen aufzulösen.
Gerade weil die Forschungen von Maria Borchert die Rahmenbedingungen einer »citoyenneté européenne« in den Vordergrund stellt, sind sie nicht nur für das DFJW, sondern für den gesamten deutsch-französischen Dialog der Zivilgesellschaften von eminenter Bedeutung. Nicht in den Inhalten oder in den Stoffen dieses Dialoges, die angeblich erschöpft wären, liegt das postulierte Desinteresse junger Franzosen für Deutschland oder junger Deutschen für Frankreich, sondern in der mangelnden Experimentierfreudigkeit und Fähigkeit der Institutionen und ihrer Akteure. Die kritische Auseinandersetzung mit der Globalisierung, die Chance, sie mitzugestalten, ja sogar partiell ihr Herr zu werden, sie aktiv zu lenken, wird vertan, solange interkulturelles Lernen das Vorexerzieren eines Modells der »braven Freundschaft« bleibt.
Konsumgesellschaft und »jeunisme« sind dabei nicht nur die Irrwege sondern die Kapitalfehler. Die Reproduktion wie sie Pierre Bourdieu in der Institution Schule oder die »distinction« in der Institution Universität haben bekanntlich systemkonforme Verhaltensweisen und deren Theoretisierung nicht zuletzt durch den »jeunisme« zur Folge gehabt.
Maria Borchert erinnert uns hingegen daran, dass »Solidaritätsbereitschaft« die Grundlage der internationalen Verständigung und des Weltfriedens ist und bleibt. Gerade ist und bleibt die transnationale Dimension dieser Solidaritätsbereitschaft eines der Ziele des DFJW.
Maria Borcherts Aussage deckt sich also voll und ganz mit Bemühungen, die schon 40 Jahre lang nicht ohne Resonanz in den beiden Ländern geblieben sind.
Die Aktualität des Buches liegt nach wie vor auf der Hand.
Prof Dr. Michel CULLIN
Stellv. Generalsekretär des DFJW
0) VORWORT
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, inwieweit der internationale Jugendaustausch (und davon im besonderen der deutschfranzösische und derjenige im europäischen Maßstab) dazu beitragen kann, den Boden der internationalen politischen Beziehungen zu verbessern. Diese übergeordnete Frage wird ganz in einem theoretischen Modus angegangen. Ausgangspunkt sind sozialpsychologische und psychologische Aspekte und ihre Vergleichbarkeit auf makro- und mikrosoziologischer Ebene. Aus dieser Ausgangslage ergibt sich auch, dass jegliche Einzelbereiche nur auf eine sehr allgemeine (und manchmal pauschal anmutende) Art und Weise angesprochen werden (können). Zu dem Schwerpunktthema »Jugendbegegnung« werden fünf empirische Untersuchungen analysiert, zwei zum europäischen Bereich1 und drei zu deutsch-französischen Begegnungsmaßnahmen.2 Daneben findet im besonderen die umfangreiche wissenschaftliche Begleitliteratur, die vom Deutsch-Französischen Jugendwerk / Office francoallemand pour la jeunesse3 herausgegeben bzw. gefördert wird, kritische Beachtung.
Bei der Evaluation von Begegnungs-Freizeiten spielt immer auch die methodische Zugangsweise eine wichtige Rolle. Die hier ausgewerteten Studien verfolgen (in einer groben Unterscheidung) entweder einen interaktionistischen oder einen psychoanalytischen Ansatz. Bedauerlicherweise lassen sich die Ergebnisse kaum vergleichen oder zu einer einheitlichen Aussage hin kombinieren.4 Zudem ist eine genauere Differenzierung von Austauschmaßnahmen vonnöten; diese Arbeit beschäftigt sich im Kern ausschließlich mit der pädagogisch organisierten Jugendbegegnung, welche verschiedene Ziele der Politischen Bildung anstrebt (s. a. u.).
Trotz variabler inhaltlicher Akzente über Deutschland, Frankreich und das politische (und manchmal auch das geographische) Europa ist hier eine ‹deutsche› Arbeit entstanden, die im Wesentlichen von der in Deutschland vorhandenen wissenschaftlichen Literatur ausgeht. So wurden alle zu Rate gezogenen empirischen Untersuchungen von deutschen Wissenschaftlern verfasst (welche allerdings wiederum verschiedene Fachrichtungen vertreten). Die darüber hinaus bedeutsame fremdsprachliche Sekundärliteratur wurde, wann immer möglich, in der Originalsprache zitiert. (Der Umstand, dass dies für die französischen Autoren nicht immer zu gewährleisten war, wird quasi ‹ausgeglichen› durch das Versehen, einen deutschen Wissenschaftler nur in der französischen Übersetzung zitieren zu können.5) Bei der nur am Rande erwähnten sozialpsychologischen Fachliteratur (US-amerikanischer Provenienz) wurde auf die deutschsprachige Rezeption zurückgegriffen. Ansonsten wird – pauschal und vereinfachend – der traditionellen deutschen Sprachform mit dem maskulinen Substantiv im Plural gefolgt.6
Das hauptsächliche Ziel der Arbeit besteht darin, die Vielfalt der Bezugspunkte aufzuzeigen, mit denen sich die Internationale Jugendarbeit mit ihrem Umfeld der internationalen Beziehungen in Verbindung bringen lässt. Da diese Verbindungslinien so unbestreitbar wie auch inhaltlich fragwürdig sind, sollte die Darstellung zu einem Teil vielleicht eher als Skizze (oder Entwurf) verstanden werden (der sich in der Folge an die jeweiligen Einzelwissenschaften richten könnte). Fast ließe sich da ein zukunftsweisender Satz über die Anwendung und die Aufgaben der pädagogisch-psychologischen Jugendforschung auf die sich daraus ergebende Situation beziehen: »Künftig wird Raum sein müssen für verschiedene Arten von Untersuchungen, die einander ergänzen. Fügen wir hinzu, dass es aber (…) hierbei (…) nicht angebracht wäre, von wissenschaftlicher Forschung zu erwarten, dass sie auf alle möglichen praktischen Fragen eine passende Antwort gibt. Menschen in Praxissituationen werden stets aufgrund der zu einem bestimmten Moment verfügbaren Daten und deren Beurteilung selbst Entscheidungen treffen müssen. Die Wissenschaft wird diese Verantwortung nie übernehmen können und dürfen. Man darf zufrieden sein, wenn treffende Fragen gestellt werden.«7
Die Arbeit ist in folgende vier übergeordnete Abschnitte gegliedert: Kapitel 1 dient der Einführung, Kapitel 2 behandelt ausgewählte Schwerpunkte. Die Kapitel 3.1 bis 3.3 nähern sich schrittweise einer Auswertung an; der vierte Abschnitt beinhaltet in Form eines weiterführenden Ausblicks beide Teilbereiche der Themenstellung: Internationale Beziehungen (bzw. Verständigung) und Internationale pädagogische Jugendarbeit. Wie oben geschildert, werden beide Aspekte in der vorliegenden Arbeit aufeinander bezogen bzw. in ihren Verbindungslinien dargestellt. Wie bereits erwähnt, sind die Ergebnisse nicht unbedingt eindeutig oder einfach zu interpretieren, und das aus folgendem Grund:
Einerseits sind die Wirkungen von pädagogischen Handlungen gerade im Kontext institutioneller und internationaler Unterschiedlichkeiten schwer bestimm- und vorhersehbar. Andererseits gibt es natürlich durchaus Möglichkeiten der Einflussnahme und beschreibbare Kriterien für deren Gelingen. Auch die Umstände und Gestaltungsweisen von Austauschmaßnahmen (im allgemeinen) sind sehr vielfältig. Diese Arbeit beschränkt sich jedoch auf die Darstellung der sog. themenzentrierten Jugendbegegnung, einem pädagogischen Konzept zur speziellen Förderung des Interkulturellen Lernens im kurzzeitigen Handlungsbereich. Gerade diese Art des Seminar-Angebotes ermöglicht im besonderen die Rückbeziehung auf den ‹großen Rahmen› der politisch wie gesellschaftlich wirksamen internationalen Beziehungen (und erfüllt somit ein wichtige Forderung der politischen Bildung).
Mit dieser Zielrichtung und vor dem Hintergrund des oben skizzierten Fragenkomplexes ist vor zwei Jahren diese Arbeit entstanden.
Bonn, im Mai 2002
Maria Borchert M.A.
1 Treuheit / Janssen / Otten, op. cit. und Mester, op. cit.
2 Letze, op. cit., Haumersen / Liebe, op. cit. und Giust-Desprairies / Müller, op. cit.
3 Gängigerweise im folgenden abgekürzt mit DFJW / OFAJ.
4 Zu dieser Problematik vgl. Mester, op. cit., S. 44 unter Bezugnahme auf: Uli Zeutschel: »Einführung in die Austauschforschung für PraktikerInnen der interkulturellen Begegnung«. In: Werner Müller / Jens-D. Kosmale (Hrsg.): Materialbox international. Bausteine zum interkulturellen Lernen bei Freizeiten und Begegnungen. Frankfurt / Main 2 1991; S. 54-58 (u. a. Titel, s. Mester, ebd).
5 B. Müller, s. Kap. 3.1.
6 Die verwendeten Begriffe »Gruppenleiter«, »Teamer« (und »Team«) werden synonym gebraucht, ebenso das französische »Animateur« (letzteres mit dem Vorbehalt der ansonsten irrelevanten Erklärungen in Kapitel 3.1).
7 Jan de Wit / Guus van der Veer: Psychologie des Jugendalters. Donauwörth 1982 (niederl. Original Nijkerk 1979; S. 275).
1 Einführung:
1.1 Zur Bedeutung und Aufgabe der pädagogischen Jugendarbeit auf lokaler8 und internationaler Ebene
Das Jugendalter ist ein Lebensabschnitt, der durch sichtbares allmähliches Selbständigwerden geprägt ist. Die davon betroffenen Lebensbereiche sind vielfältig: »(…) Der Jugendliche steht an der Grenze – nicht länger Kind, noch nicht erwachsen, – und er fühlt Druck von allen Seiten. In verhältnismäßig kurzer Zeit muss er zahlreiche Anpassungen vollbringen Er muss sich allmählich von seiner Familie unabhängig machen, sich sexueller Reife befleißigen, mit Kameraden in gegenseitig befriedigender Arbeitsgemeinschaft zusammenarbeiten, sich für einen Beruf entscheiden und sich darauf vorbereiten, eine gewisse Lebensphilosophie zu entwickeln, sich zumindest eine Sammlung von sittlichen Grundsätzen aneignen, nach denen er sich richtet und handelt, und er muss einen Sinn für seine Individualität entwickeln. (…)«9.
Teilweise bedingt durch die (vorerst innere) Ablösung von der Familie spielt die sog. Gleichaltrigengruppe oder Peergroup für den bzw. die Jugendliche in diesem Zeitabschnitt eine große Rolle10:
»Diese Gruppen haben ein doppeltes Gesicht: Einerseits tendieren sie dazu, sich unter der Glocke der Solidarität gegen die Ansprüche der Erwachsenenwelt abzuschirmen; sie dienen gewissermaßen dem Schutz von Ansprüchen, die noch nicht erfüllt werden können. Andererseits wird Erwachsensein in diesen Gruppen gleichsam experimentell gelebt. Der Blick ist nach vorne gerichtet auf das, was das künftige Leben schließlich fordert«.11 In soziologischpsychologischer Hinsicht erklärt die folgende Theorie nach Mario Erdheim12 den jugendlichen Ablösungsprozess. Sie spricht von der »Zweiten Chance Jugend« als der bewussten Hinwendung zur außerfamiliären »Kultur«.13 Mit diesem Kultur-Begriff ist alles ‹Unpersönliche› der gesellschaftlichen Beziehungen unter Erwachsenen gemeint, jene Lebenswelt, die nicht wie die ursprünglich sozialisierende Familie, wie die Schule und Ausbildungsstätte ‹familiär› und zugleich mit familienähnlichem Autoritätsgefälle orientiert ist. Es geht nach dieser Theorie für die Jugendlichen um die Bewältigung des soeben beschriebenen »antagonistischen Spannungsverhältnisses von Familie und Kultur«14, wobei in diesem Durchgangsstadium »narzißtische Stimmungen«15 ein natürlicher und notwendiger Begleitumstand sind. Die Jugendarbeit greift die persönliche Situation der Jugendlichen durch pädagogisch betreute Freizeit- und Kontaktangebote auf.
In ihrem soziologischen Überblick »Freizeit« geben Walter Tokarski und Reinhard Schmitz-Scherzer in der folgenden Aufzählung die allgemein häufigsten Freizeit-Interessen von Jugendlichen an:
das Bedürfnis nach Bewegung, Sport usw.,
das Bedürfnis nach Rekreation, Erholung,
das Bedürfnis nach Sozialkontakten,
das Bedürfnis nach Information und Kommunikation und/ oder
das Bedürfnis nach expansiver und/oder schöpferischer Erlebnisentfaltung.«
16
In diesem Zusammenhang sei auf Untersuchungsergebnisse hingewiesen, die die Verwirklichung dieser Wünsche mit in den Blick nehmen. Detlef Grieswelle nennt beurteilend zu seiner empirischen Untersuchung zum Freizeitverhalten saarländischer Schüler folgende im Rahmen der landesweiten »außerschulische(n) Jugendbildung« problematische Grundtendenzen (als Ergebnis):
»geringe Bereitschaft zu Engagement und Verantwortung; geringe Motivation zu eigener Gestaltung und eigener Verpflichtung;
häufig geringe Motivation zu planmäßigem und zielgerichtetem Tun (einmal abgesehen vom Sport);
Einstellungen gegen stärkere Bindung, Formalisierung und Institutionalisierung von Aktivitäten; Wunsch nach Flexibilität in der Wahl von Zeit, Ort, Inhalt und Sozialeinheit der Betätigung (lockere Formen werden in den Organisationen bevorzugt);
starkes Votieren für Mitbestimmung bzw. Eigenverantwortung der Jugendlichen, aber gegen stärkere Kontrolle, Beachtung von Regeln, Einflüsse von Führungsgruppen und –personen;
Vorliebe für konsumorientierte-kommerzialisierte Verhaltensmuster der Unterhaltung.«
17
Für die Pädagogen (besonders die Freizeitpädagogen, die Sozialarbeiter und Medienerzieher) stellt sich die Frage, wie sie im Einzelnen mit diesen Umständen umgehen wollen oder sollen. Ein kurzer Blick auf einige Theorieansätze zeigt verschiedene Möglichkeiten.
Lothar Böhnisch erinnert daran, dass die Hoffnungen der 70-iger Jahre auf eine Verbesserung der Welt durch die Energie der jungen Generation unrichtig waren, ihre »Dynamik« und »Vitalität« 18 jedoch erzieherisch beachtet und »aus dem Spielraum des Jugendkulturell-Pädagogischen heraus in die sozialen und politischen Konflikt- und Konsenszonen der Gesellschaft (vermittelt) (werden können).«19 Für eine sozusagen ‹generationsübergreifende› Pädagogik (besonders im außerschulischen Bereich) spricht sich auch Dieter Baacke aus: »pädagogische Konzepte, die auf der Voraussetzung eines Generationsgefälles ruhen, jedenfalls für bestimmte pädagogische Arbeitsformen und für ältere Jugendliche zu ersetzen durch das Konzept einer ‹Solidarität der Generationen›«.20 Ohne die wachsende Einflussnahme der »Gruppen der Altersgleichen«21 als neue gesellschaftliche Entwicklungsschiene ausblenden zu wollen, stimmt Baacke mit Giesecke überein, was den o. g. weniger autoritären pädagogischen Ansatz betrifft. Giesecke seinerseits schrieb 1984 dazu: »(…) Vermutlich ist es kein Zufall, dass die großen gegenwärtigen politisch-kulturellen Bewegungen (Friedensbewegung, ökologische Bewegung) generationsübergreifend sind. Mir scheint, dass die Grenzen zwischen Jugendarbeit und Erwachsenenbildung immer fließender geworden sind, und noch werden müssen, und manches spricht dafür, die Ghettoisierung des Jugendalters nicht noch pädagogisch zu verschärfen. Die kulturelle ‹Gleichschaltung› der Generationen enthält auch neue Chancen für ihre Beziehungen.«22
Die in Frankreich entwickelte sog. »pédagogie institutionnelle« mag hier ergänzend wirken können, denn sie bezieht (im aufklärerischen Sinne) die Einwirkungen eines jeglichen pädagogisch-institutionellen Überbaues in ihre Theoriebildung mit ein.23
Der in der deutschen Jugendarbeit viel beachtete Ansatz einer »sozialräumlichen Pädagogik« deutet die Lebenserfahrung Jugendlicher innerhalb ihres sozialen Lebensraumes.24 Im Bereich der interkulturellen Begegnung ist ein derartiges Paradigma von erlebnishafter Einheitlichkeit im höchsten Grade hinfällig.25 Was da von den genannten Charakteristika der Jugendarbeit bestehen bleibt, ist eine grundsätzliche Funktionsoffenheit, welche besonders dann zum Tragen kommt, wenn es sich um nicht schul- oder berufsbezogene Begegnungen aus dem freizeitbezogenen Themenangebot handelt. Gerade hier geht es vor allem darum, eigene persönliche Erfahrungen zu ermöglichen und den offenen (Gedanken-) Austausch zu unterstützen. Dass dieses übergeordnete Ziel wohl nicht in jedem Fall genügend beachtet wird, zeigen Lucette Colin, Remi Hess und Gabriele Weigand in Band 11 der »Arbeitstexte« des Deutsch-Französischen Jugendwerkes. Es geht um unterschiedliche Voraussetzungen bei interkulturellen Begegnungen, namentlich um die unterschiedliche Ausgangslage in Seminaren mit festgelegten (»identitätsstiftenden«) Gruppen und den thematisch offeneren mit sehr unterschiedlichen Teilnehmern, denen besonders an der menschlichen Begegnung gelegen ist. Die Autoren fordern eine bessere Nutzbarmachung der interkulturellen Erfahrung, auch dort, wo »die pädagogische Beziehung im internationalen Kontext nicht automatisch Anlass zu Fragen gibt« 26, d. h. im erstgenannten Bereich der stark fachlich orientierten Begegnungen mit einheitlichen Teilnehmer-Gruppen (etwa nur Reiter, Köche, Frauen …).27
Innerhalb der außerschulischen pädagogischen Arbeitsbereiche bildet die internationale Begegnung eher nur ein Randgebiet der Jugendarbeit, da diese in erster Linie ganz lokal ‹vor Ort› stattfindet, um die Jugendlichen in ihrer alltäglichen Freizeit zu erreichen. Mit Dieter Baacke, op. cit. sind folgende, oftmals nur schwach voneinander abgrenzbaren Arbeitsfelder der Jugendarbeit zu unterscheiden: (1) Jugendverbände, (2) Jugendfreizeitstätten, (3) Jugendbildungsstätten und (4) zusammengefasste ‹Nebengebiete›28, zu denen auch die internationale Jugendbegegnung gehört.29 Ihre Bedeutung wird erst aus einem übergreifenden Blickwinkel deutlich, der neben den erweiterten pädagogischen und sozialen Zielsetzungen30 die »internationale Verständigung« 31 als einen (wichtigen und zukunftsweisenden) »Teil der politischen Bildung«32 erfasst.
In der Europäischen Gemeinschaftspolitik bilden Jugendfragen kein eigenes Ressort, werden aber in vielfacher Weise behandelt (Es gibt ein Europäisches Jugendwerk und einen Jugendfonds.) Der Jugendaustausch im Freizeitbereich wird (für Gruppen) aus dem Programm »Jugend für Europa« gefördert. Dabei soll auch vor allem solchen Jugendlichen zu einem Auslandsaufenthalt verholfen werden, die sonst nicht leicht so etwas machen könnten oder würden.33 Als Veranstalter kommen sowohl selbstorganisierte Gruppen von Jugendlichen als auch Verbände, Jugendorganisationen, Gemeinden und Bildungseinrichtungen in Frage. Eine weitere Vorbedingung ist, dass die Teilnehmer (im Alter zwischen 15 und 25 Jahren) aus mindestens zwei Mitgliedsstaaten der Europäischen Union kommen. Auf die entsprechenden organisatorischen und institutionellen Details des Jugendaustausches wird im Zusammenhang mit der Deutsch-Französischen Jugendbegegnung noch eingegangen werden (s. Kap. 2.3.7).
Hier noch ein kurzer Blick auf einige sozialwissenschaftliche Forschungsrichtungen, die sich speziell mit Bereichen der internationalen Jugendarbeit beschäftigen. Ein maßgebliches Kriterium ist die Interkulturalität der Begegnung und der Umgang mit daraus resultierenden Fragestellungen (s. Kap. 2.3.2). Im Unterschied dazu handelt es sich bei der sogenannten »Interkulturellen Pädagogik« um eine eigenständige Forschungsrichtung, die sich schwerpunktartig mit den sozialen und politischen Folgen von ethnischkultureller Verschiedenheit auseinandersetzt. Teilweise sind von diesem Problemkreis allerdings auch bspw. deutsch-französische Freizeiten betroffen.34 Zur Ermittlung von (vorwiegend inter-europäischen) Kulturdifferenzen, ihrer Wahrnehmung und Verarbeitung (vor makrosoziologischem Hintergrund) wurde durch Anregung von politikwissenschaftlicher Seite die Vorgehensweise der Ethnopsychoanalyse adaptiert, um eine empirische Untersuchung von Deutsch-Französischen Jugendbegegnungen zu ermöglichen. Dies ist ein Verfahren, das in analytischer Weise aus einem gegenüberstellenden, einem vergleichenden und einem die eigene Personalität mit hineinnehmenden Blickwinkel arbeitet. (s. a. Kunst-Beispiel in Kap. 2.2).
Soziologische und psychologische Forschungsergebnisse können die weitere Planung des Jugendaustausches erleichtern. Denn den Organisatoren rückt ihr eigentliches Ziel vielfach aus dem Blickfeld: »Bei den Politikern hat Jugendaustausch – erfreulicherweise – einen recht guten Stellenwert. Als Aufgabe ist er wohl allgemein unumstritten; es besteht Einigkeit, dass Jugendaustausch sinnvoll und unterstützungswürdig ist. Konkrete Ziele, die damit verbunden werden sollen, vor allem aber die Inhalte, sind oft nicht näher definiert. Jugendaustausch ist insoweit ein Phänomen, als die Kommunalpolitiker, die meist recht praxisnah und laut nach dem Sinn von politischen Entscheidungen fragen, gerade den Jugendaustausch recht unkritisch befürworten, ohne ihn an Sinnkriterien zu messen, ihn als Selbstzweck hinnehmen. Bei den Betreuern, gerade bei den im kommunalen Austausch sehr häufig als Begleiter von Jugendgruppen fungierenden Jugendsporttrainern, Klassenlehrern usw. ist oft keinerlei Nachdenken über den Sinn einer Austauschreise zu bemerken. Auch sie nehmen einen Austausch als Selbstzweck, beschränken sich auf das reine organisatorische Abwickeln, sind auch oft damit voll ausgelastet. Die pädagogische Reflexion, ein bewusstes Planen von Austauschinhalten ist ihnen fremd.«35 Die pädagogischen Leiter sehen sich dabei vor das scheinbare Paradox gestellt, dass »eine Jugendaustauschmaßnahme einerseits meist in der Freizeit der Teilnehmer stattfindet, andererseits aber ein Austausch eben auch ‹Arbeit› ist.«36 Alles erziehungswissenschaftliche und pädagogische Bemühen richtet sich demnach sowohl auf den Freizeit-Aspekt einer Jugendbegegnung als auch auf den ‹arbeitsamen› Teil, d. h. die themengebundene Seminar- und Gruppenarbeit. Hinzu treten vielerlei sozialwissenschaftlich fassbare Begleitumstände (aus der makrosoziologischen und mikrosoziologischen Perspektive), die die konkrete Arbeit maßgeblich mitbestimmen und in jedem besonderen Fall variieren. Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Untersuchung und Erläuterung ihres Zusammenwirkens bei deutsch-französischen und europäischen Jugendbegegnungen. Zielrichtung ist die pädagogische Gestaltung (im allgemeinen); auf eine thematische, umfassendere Aufgliederung der interkulturellen Bildungsmaßnahmen muss im Rahmen dieser Arbeit verzichtet werden.37
1.2 Politische Jugendbildung und die Stärkung der internationalen Verständigung
Schulische und außerschulische Politische Bildung kann unterschiedlich verstanden und gelehrt werden.38 In der außerschulischen Jugendbildung steht zumeist die problemorientierte Vermittlung im Vordergrund. Als Zitat nach Bernd Janssen nennt Wolfgang W. Mickel drei unterschiedlichen Auffassungen von Politischer Bildung (und damit auch der politischen Sozialisation) innerhalb Westeuropas:
» parteipolitische Schulung und Propaganda
Unterricht oder Studien über Politik (Institutionen, politische Systeme usw.) und
Befähigung zu politischem Urteil und politischer Beteiligung des einzelnen ohne parteipolitische Ausrichtung.«
39
Neben einer unterschiedlichen Akzentuierung von Begriffen und Lernzielen »(wird) Position 1 (…) in Dänemark negativ abwertend verstanden, ebenso in Großbritannien, Frankreich, Luxemburg, Belgien, schwächer in den Niederlanden.«40 Doch müssen die Gemeinsamkeiten bestärkt werden, besonders auch im zusammenwachsenden Europa41. In einem Bericht des CAHJE (……), einem Ausschuss des Europarates, ausgeführt wird die Ausgangslage zur politikbezogenen Jugendarbeit so beschrieben: »Jugendliche sind nicht gewillt, eine Ordnung mitzutragen, die für sie keine Mitgestaltungsmöglichkeiten nach ihren eigenen Prioritäten bereithält. (….). (…) sie sind aber äußerst pessimistisch in bezug auf die gesellschaftliche Zukunft: Drohender Verlust des ökologischen Gleichgewichts, Atomkatastrophen, Spannungen zwischen den Großmächten, der Rüstungswettlauf, das andauernde und immer schlimmer werdende Elend in der dritten Welt verschaffen ihnen (den Jugendlichen – W. M.) den Eindruck, dass vor lauter Sachzwängen und wegen der Eigendynamik bzw. Statik des Gesamtsystems niemand mehr imstande sein wird, die großen Weltprobleme zu lösen, und die Apokalypse Realität werden könnte. (…) Autonomie, Genügsamkeit, Sensibilität, Identität von Denken und Handeln und eine Art sozialer Zärtlichkeit sind einige der Werthaltungen, die die neuen Jugendkulturen bestimmen«42. Trotz einiger Veränderungen der Weltpolitik der Zwischenzeit geben diese deutlichen Erläuterungen skizzenhaft vielleicht die Grundzüge von verbreiteten Einschätzungen des ‹Politischen› unter Jugendlichen wieder, auch wenn sich diese manchmal nur schwer mit konkreten politischen Fragen auseinandersetzen wollen: Auf die Frage nach den allgemeinen (d. h. nicht durch Informationen beeinflussten) Erwartungen der Teilnehmer an europapolitischen Jugendseminaren43 stand gemeinschaftliches Erleben und »Kennenlernen anderer Jugendlicher« eindeutig an erster Stelle; auch die Verbesserung von Sprachkenntnissen und freizeitliche Erwägungen wurden nicht vergessen. Die Beschäftigung mit europapolitischen Themen war dagegen wenig gefragt, und die Option »Jugendprobleme gemeinsam erarbeiten« konnte erst bei der Befragung nach der jeweiligen Veranstaltung unter den speziell »inhaltlichen Erwartungen« den höchsten Rang einnehmen (obschon dieser Rubrik wegen ihrer Ähnlichkeit zur Schulsituation insgesamt ein ‹schlechtes Image› anhaftete).44 Auch in einer neueren und speziell auf das politische Lernen ausgerichteten Untersuchung an vier (sog.) »Europäischen Jugendwochen« 45 wird deutlich, »dass Europa bei den Jugendlichen sehr stark auf der Ebene von Freundschaft, Freizügigkeit und persönlichem Erleben gesehen wird«.46 Die Beschäftigung mit »Europa« (allgemein und politisch) wurde von den Teilnehmern dieser Veranstaltungen sehr gut aufgenommen und zeitigte in jeder Hinsicht begrüßenswerte Lernergebnisse.47
Angesichts dieser vielschichtigen Problematik eines Lernfeldes sollten – bei aller notwendigen Abstraktion48 – die vieldiskutierten49 Ziele der modernen Politischen Bildung nicht untergehen. Besonders seit der politischen und gesellschaftlichen Öffnung Osteuropas bietet es sich an, bei Untersuchungen zur internationalen Jugendarbeit die interkulturelle Dimension mit derjenigen des politischen Lernens zu verknüpfen (bzw. als verbunden hervorzuheben). Dies geschieht in einer in dieser Fassung50 recht konzisen theoretischpraktischen Handreichung zum internationalen Jugendaustausch, die in der Forschungstradition von Treuheit / Janssen / Otten (op. cit.) steht.51 (In Kap. 2.2.1 wird daraus das Beispiel einer politischgeschichtlichen Kontroverse unter zwei Teilnehmern der östlichen Staaten diskutiert werden.)
So wird neben der faktischen Information auch die Wichtigkeit einer allgemeinen Menschenbildung deutlich. Wenn man bspw. im Lebensbericht des französischen Soziologen Edgar Morin liest, er habe wahrscheinlich deswegen dem Nationalsozialismus und später dem Stalinismus (geistig) widerstanden, weil er den Grausamkeiten der Politik und letztendlich der Grausamkeit der Welt habe widerstehen wollen52, ist das auf die moralische Dimension des »Lebenlernens« zurückzuführen. Das Postulat, im Rahmen einer umfassenden Friedenserziehung wiederum einzelne Problembereiche zu konkretisieren (was z. B. heißen kann, »den Krieg schonungslos in seiner ganzen Realität darzustellen«53), wird durch diesen Ansatz sicherlich nicht infrage gestellt.
Bei der internationalen Kontaktaufnahme spielen im besonderen vorgefertigte Ansichten über Land und Leute eine wichtige Rolle. (Wenn möglich, sollte dieser Themenbereich auch in der begleitenden Studien-Arbeit einer organisierten Jugendbegegnung aufgegriffen werden.) In der theoretischen Auseinandersetzung gilt es zunächst, grundsätzlich zwischen den unumgänglichen Vor-Urteilen unserer Wahrnehmung und jenen gesellschaftlich propagierten sog. ‹nationalen Stereotypen› zu unterscheiden: »Kein Vorurteil wäre bedenklicher, als die Annahme, ohne Vorurteile leben zu können. Die schlechthin vorurteilsfreie Existenz ist nicht vollziehbar. Das gilt im Prinzip für jeden Bereich, dessen wir uns vital, sozial, intellektuell oder sentimental bemächtigen. Die Frage ist allerdings, in welchem Umfang, auf welche Weise und mit welchen Konsequenzen das geschieht (…).«54 Mit dieser Beschreibung soll ausgedrückt werden, dass das bewusste Urteilen ein Spezifikum des Menschen ist. Für den inter-kulturellen Kontakt ist die unausweichliche »kulturelle Determiniertheit«55 unserer Anschauungsweise bedeutsam, das unser ‹Bild› vom anderen jeweils prägt.56 Die Auseinandersetzung mit jeder Art von Unterschiedlichkeit ist wichtig, denn vielfach ist es jener sicherheitsspendende Alltag, der die Menschen dazu verleitet, die Augen vor gefährlichen Tendenzen zu verschließen – wie Bruno Bettelheim festgestellt hat, auch längstmöglichst in Zeiten der nationalsozialistischen Judenverfolgung.57
Allerdings existieren (besonders zwischen weit entfernt liegenden Kulturen) Unterschiede oder Widersprüche, mit denen umzugehen schwierig ist. Die kulturelle Andersartigkeit betrifft vereinbare und ausschließende Elemente: »Unterschiedliche Kleidung und Eßgewohnheiten sind koexistenzfähig, unterschiedliches Zeitverständnis, unterschiedliche Auffassung der Geschlechtsrollen und der sexuellen Beziehungen sind es nicht. Es hat den Anschein, als ob gerade die zentral den Kern der Person betreffenden Normen nicht koexistenzfähig sind.«58 Für diese Problematik gibt es (nach Nicklas) keine einfachen Lösungen. Einerseits brauche eine menschliche Gesellschaft einen »Grundkonsens«59 von Regeln für ihr Zusammenleben, schreibt er, andererseits jedoch auch eine »Normenflexibilität« auf der Grundlage der Erkenntnis, »dass die eigenen Normen keineswegs ‹natürlich› (seien) (…), sondern historisch entstanden und relativ«.60 Als Abhilfe nennt er (u. a.) die folgenden beiden pädagogischen Ansätze (von denen der erste noch kaum pädagogisch ausgewertet sei): Einmal die (von Henri Tajfel herausgestellte) Bedeutsamkeit, das jeweils eigene Selbstwertgefühl zu stärken, damit kein abwertender und hierarchisierender Vergleich nötig werde, um die eigene Identitätsvorstellung ‹hochzuhalten›. Andererseits das von Alexander Mitscherlich postulierte Bemühen, unbewusste emotionalen »Triebmechanismen und ihre Funktion für unser Denken und Handeln zu durchschauen und mit ihnen besser umgehen zu können«.61
Ein anderer Ansatz besteht in der Bekämpfung von Vorurteilen durch gezielt dargebrachte Information.62 Dieser nicht psychologisierende Weg wird beim internationalen Jugendaustausch vielleicht am häufigsten beschritten: Vorhandene [nationale oder gesellschaftliche] Vorurteile sollen durch überzeugende Erfahrungen verändert werden. Dahinter stehen psychologische Grundannahmen, die durchaus durch Experimente gestützt werden,63 und die sich in folgender ‹Binsenweisheit› subsumieren lassen: »Wer Andersartigkeit versteht, versteht auch Alternativen, versteht möglicherweise auch den eigenen Standpunkt mit seinen Vor- und Nachteilen, in seinen Stärken und Schwächen besser.« 64 Dabei geht es um wirkliches Kennen und Verstehen in allen Facetten und aus einer sachlich-nüchternen Grundhaltung heraus: »Es kann nicht Ziel des Austausches sein, Emotionen umzudrehen, von Erzfeindschaft zu Verbrüderungseuphorie zu kommen.65 (…) »Anzustreben wäre vielmehr eine realistische Darstellung des anderen unter Berücksichtigung aller da mitschwingenden pluralistischen Tendenzen.« 66 Ein solch weiträumiger Blickwinkel erlaubt(e) den Dissens als Kommunikationsgrundlage in einer originär67 pluralistischen Gesellschaft und Welt, wodurch einseitiges und ausschließendes Denken auch in der Politik verhindert wird (bzw. würde).68
In diesem Sinne haben internationale (bzw. bilaterale) Kontakte immer eine (mehr oder weniger allgemeine) politische Bedeutung, nämlich die Unterstützung des Zusammenlebens Menschen und der Völker. Auch wenn unser gegenwärtiges Erziehungsverständnis weniger normativ orientiert ist, bleibt wohl auch heute »das ethische Engagement für den Frieden, als das letzte und größte Ziel jeder internationalen Jugendarbeit zu sehen und stets anzustreben«. 69 Die in Kapitel 1.3 beschriebene Vielschichtigkeit und Kontext-Abhängigkeit von friedensfördernden Initiativen legt eine gut durchdachte pädagogische Vorbereitung nahe. Nur aus diesem Zusammenhang heraus ist die bereits von Breitenbach (1979) geforderte und durch Treuheit / Janssen / Otten (1990) bestätigte70 Orientierung an den konkreten Interessen und Bedürfnissen der Jugendlichen zu verstehen: »‹Die … Förderung interkulturellen Lernens in der Internationalen Jugendarbeit (erfordert) … zunächst einmal mehr Zielklarheit. Dies … setzt voraus, so paradox es auch klingen mag, dass sich die Maßnahmen von dem programmatischen Anspruch befreien, der ‚Sicherung des Weltfriedens‘, der ‚Versöhnung zwischen ehemaligen Gegnern‘, der ‚Verwirklichung der Menschenrechte‘, der ‚Europäischen Einigung‘ etc., dienen zu wollen. Jugendliche jeder Nationalität und mit den unterschiedlichsten Sozialisationserfahrungen haben sehr unmittelbare Probleme, Wünsche, Interessen, Hoffnungen und auch Ängste, um die es ihnen geht›.«71
Von dieser (auf den ersten Blick streitbaren) konzeptionellen Grundhaltung wird in Kap. 4 noch einmal die Rede sein, da sie immerhin den Dreh- und Angelpunkt für jene wichtigen, biographisch nachhaltigen persönliche Erfahrungen bildet.
1.3 Die Internationalen Beziehungen als Rahmenbedingungen für Friedensförderung und Kulturaustausch
Vorbemerkung:
Es können in dieser Arbeit wirklich nicht alle politischen Erklärungsweisen dargestellt werden, um den sozialen Gegebenheiten im Kleinen den ‹großen Spiegel› der Weltpolitik vorzuhalten. Es geht hier lediglich um einige ausgewählte Gesichtspunkte, an denen sich möglicherweise Parallelen erkennen lassen. (Der Weg zu einer besseren internationalen Verständigung bleibt dabei insofern offen, als dass dabei viele situationsspezifische Interaktionsmomente mitspielen.) Außerdem soll ein Eindruck von der Arbeitsweise einiger übernationaler Institutionen (im kulturellen Bereich) gegeben werden, um einen gewissen Vergleich zwischen theoretischen Zielvorstellungen und ihrer Verwirklichung zu ermöglichen. Der Blick auf die großen Organisationsformen verweist somit auf die engeren Strukturen (der Bildungsinstitutionen).
Innerhalb der politischen Theoriebildung können wohl vier grundsätzlich verschiedene Richtungen unterschieden werden (hier dargestellt in einem Schema, das sich an Druwe/Hahlbohm/Singer 1995; S. 103-104, 114 und 119-122 anlehnt)72:
(Neo-)Realismus,
Staatenwelt-Modell bzw. Billiardkugel-Modell (Sicherheit + Frieden durch allseits stabilisierende Macht-Politik)
Integrations– ,
Weltstaat, Weltgesellschaft (ï stabiler »positiver Friede« in sozialer Gerechtigkeit; sinnvoll nur in Verbindung mit Regimeforschung?!)
Dependenz–,
Weltmarkt (Ausrichtung am Sozialismus, Betonung der Belange der Dritten Welt ï neue Weltwirtschaftsordnung)
Interdependenztheorien.
Gittermodelle, Spinnennetzmodell (Variabilität in staatl. Macht-Sicherung + geschäftl. globaler Kooperation)
Von diesen Ansätzen seien zwei zur näheren Betrachtung herangezogen, ein »REALISTISCHER« Ansatz nach Klaus Jürgen Gantzel73 und drei Varianten der integrationspolitischen Richtung nach Daniel Frei, aufbauend auf Amitai Etzioni.74 Dabei ist zu bemerken, dass im ersten Fall einzelstaatlich argumentiert wird, im zweiten Fall von einem globalen Standpunkt aus.
Eine »realistische« Situationsanalyse erläutert »komparativ-statisch«75 (und damit einschränkend) die »Determinanten, Faktoren, Parameter« 76, die die Reaktionen von bestimmte «‹Staatstypen›« in bestimmten »‹Situationstypen77›« bestimmen. Dennoch ist dieser Ansatz durchaus umfassend angelegt. Gantzel schreibt: »(…) (Das Modell) darf sich (…) aber nicht auf psychologische Kategorien beschränken; vielmehr muss es die strukturellen gesellschaftlichen und politischen Bedingungen umgreifen, die die psychischen Mechanismen erzeugen, zulassen oder antreiben«78. Bei dieser Situationsanalyse spielen die sog. »Perzeptionsfaktoren« 79 eine große Rolle. Damit sind neben den Faktoren »Information und Kommunikation; Perzeption von Perzeptionen; Attitüden; allgemeine Wertstandards und spezielle Präferenzen; eigene und konkurrierende Zielsetzungen; (…); Zukunftserwartungen; stereotype Vorstellungen von anderen Akteuren usw.« 80 gemeint. Eine konkrete Konfliktsituation kann sich dann so darstellen: »Je eher das Tiefengedächtnis (zum Beispiel Stereotypen über andere Gesellschaften oder das darwinistische Image eines von Gewaltsamkeit diktierten internationalen Systems) überwiegt, desto eher wird sich die Regierung zu einer kruden Status-quo-Politik entschließen und gegebenenfalls physische Machtmittel für sie einsetzen. Je nach dem Grad, an dem die verschiedenen Schaltstellen des Systems kombiniert und koordiniert sind und innovative Neukombinationen ermöglichen (Elastizität und Anpassungsfähigkeit versus Rigidität des Regierungssystems), werden Handlungsalternativen sichtbar oder wird die Situation zwanghaft erscheinen81





























