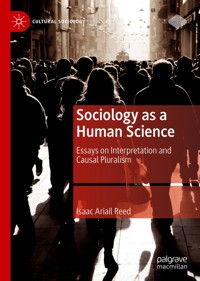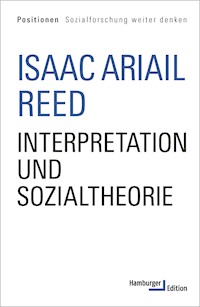
27,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hamburger Edition HIS
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Positionen
- Sprache: Deutsch
Soziologie ist eine Disziplin, die durch zahlreiche Kontroversen geprägt ist. Nicht jeder dieser Konflikte trägt jedoch dazu bei, die soziale Welt besser zu begreifen. Mit seinem Buch wendet sich Isaac Ariail Reed vor allem gegen den Gegensatz von Erklären und Verstehen, der in der Soziologie seit ihren Anfängen im 19. Jahrhundert gepflegt wird und vielerorts als unüberwindlich gilt. Sein Buch ist ein provokantes Plädoyer dafür, dass Sozialtheorie dazu dienen kann, anschauliche und historisch sensible Erklärungen für soziale Phänomene zu gewinnen. Der Clou ist, dass die Erklärungen, für die Reed wirbt, interpretativ angelegt sind. Der Gegensatz zwischen Erklären und Verstehen ist letztlich eine Scheinopposition. Er analysiert, wie Theorie in den Sozialwissenschaften tatsächlich genutzt wird, anstatt auf Prinzipien herumzureiten, die unabhängig von dieser Praxis sind. Reed gelangt so zu einem hermeneutisch angelegten Forschungsansatz, der Machtbeziehungen reflektiert und das Augenmerk darauf lenkt, wie soziale Interaktionen ablaufen. Selbst wer diesen Ansatz nicht teilt, gewinnt mit dem Buch die Möglichkeit, sein eigenes Arbeiten zu überdenken und schärfer zu profilieren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 377
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Positionen Sozialforschung weiter denken
In der Reihe Positionen erscheinen klassische und neue Texte, die sich damit auseinandersetzen, was wegweisende Sozialforschung methodisch und theoretisch ausmacht, und die aufzeigen, was sie leisten kann.
Sozialforschung weiter denken heißt, mit Positionen zu experimentieren, die inspirieren und irritieren, weil sie die theoretischen und methodischen Konventionen sozialwissenschaftlichen Forschens hinterfragen, überwinden oder neu arrangieren. Die ausgewählten Werke fordern allesamt heraus; sie geben Orientierung und enthalten überraschende Einsichten; sie machen Deutungsangebote und ermuntern zu Kritik.
Ziel der Reihe des Hamburger Instituts für Sozialforschung ist es, methodisch und theoretisch kreativen Impulsen mehr Gewicht in wissenschaftlichen und öffentlichen Diskursen zu verleihen. Dazu versammelt Positionen sowohl Originaltexte als auch Übersetzungen.
ISAAC ARIAIL REED
INTERPRETATION UND SOZIALTHEORIE
Aus dem Englischen von Ursel Schäfer
Mit einer Einführung von Thomas Hoebel
Hamburger Edition
Für Hans-Gerhart Rosenthal (1913–2008)
Für Hannah Katarina Bair, die außergewöhnliche Hermeneutin
Hamburger Edition HIS Verlagsges. mbH
Verlag des Hamburger Instituts für Sozialforschung
Mittelweg 36
20148 Hamburg
www.hamburger-edition.de
© der E-Book-Ausgabe 2022 by Hamburger Edition
ISBN 978-3-86854-468-8
E-Book Umsetzung: Dörlemann Satz, Lemförde
© der deutschen Ausgabe 2022 by Hamburger Edition
Licensed by the University of Chicago Press, Chicago, Illinois, U.S.A.
ISBN 978-3-86854-344-5
© der Originalausgabe 2011 by The University of Chicago. All rights reserved.
Titel der Originalausgabe: »Interpretation and Social Knowledge.
On the Use of Theory in the Human Sciences«
Umschlaggestaltung: Wilfried Gandras
eISBN 978-3-86854-469-5
INHALT
THOMAS HOEBEL
Hexerei und Sozialforschung
ISAAC ARIAIL REED
Einleitung
1 Wissen
2 Realität
3 Utopie
4 Bedeutung
5 Erklärung
Epilog
Danksagung
Bibliografie
Zum Autor
THOMAS HOEBEL
Hexerei und Sozialforschung
Salem Village, Massachussets Bay Colony, 1692. Die Küche im Wohnhaus des örtlichen Pastors Samuel Parris entwickelt sich in den ersten Wochen des Jahres zu einem beliebten Treffpunkt von Mädchen und jungen Frauen. Sie gehören entweder zum Haushalt oder stammen aus der näheren Nachbarschaft, sind zwischen neun und 20 Jahre alt und verbringen dort regelmäßig ihre Nachmittage in Gesellschaft der auf Barbados geborenen Sklavin Tituba. Nach einer Weile beginnen manche von ihnen, sich in der Anwesenheit anderer ungewöhnlich zu verhalten. Sie geben unvermittelt spitze Schreie von sich, verrenken ihre Körper, kriechen auf offener Straße über den Boden oder bellen wie Hunde. Zwei von ihnen, Betty Parris und Abigail Williams, geben an, Visionen zu haben.
In kurzer Zeit macht die Nachricht über diese außergewöhnlichen Ereignisse die Runde. Und immer mehr Mädchen des Städtchens haben mitunter »heftige Anfälle«, wie Deodat Lawson, ein ebenfalls in der Region tätiger Pastor, wenig später schreibt. William Griggs, der örtliche Arzt, ist sowohl mit seinen Arzneien als auch mit seinem Latein recht bald am Ende. So diagnostiziert er schließlich kein medizinisches Problem, sondern ein geistliches: Die Mädchen stünden unter der Hand des Teufels.
Salem Village ist wie die gesamte nordamerikanische Kolonie streng puritanisch geprägt. Etliche Geistliche des Städtchens und seiner Umgebung vermuten, dass die Mädchen verhext sein müssen, und befragen sie, wer ihnen diese Qualen zufüge. Nach einigem Zureden nennen die Befragten in der Tat drei Frauen aus der unmittelbaren Gegend: Sarah Good, Tituba und Sarah Osborne. Am 1. März beginnen öffentliche Vernehmungen der drei. Während Good und Osborne alle Vorwürfe abstreiten, äußert sich Tituba einigermaßen ausführlich. Die mit den Vernehmungen befassten Pastoren werten ihre Schilderungen als Geständnis, das Good und Osborne zugleich mitbelastet. Alle drei werden daher am 7. März nach Boston in das dortige Gefängnis gebracht, wo Osborne kurz darauf stirbt.
In den folgenden Wochen setzt eine erste größere »Welle«1 von Anschuldigungen ein. Immer mehr Menschen sehen sich dem Vorwurf der Hexerei ausgesetzt – vor allem Frauen, jedoch auch einige Männer wie der frühere Pastor von Salem Village, George Burroughs. Er gilt als Kopf dieser »teuflischen Kirche«. Einerseits entsteht eine perverse Anreizstruktur, weil den Beschuldigten, die ihre Mitstreitenden nennen, zugesichert wird, dass sie am Leben bleiben werden. Andererseits beginnt auch in anderen Ortschaften der Kolonie die geistlich geförderte Hexenjagd.
Ende Mai setzt der Gouverneur von Massachusetts, William Phips, ein Sondergericht ein, das über die mittlerweile zahlreichen Inhaftierten entscheiden soll. Es nimmt am 2. Juni seine Arbeit auf und lässt dabei auch eine ganze Reihe ansonsten unüblicher Beweismittel zu, darunter das fehlerhafte Aufsagen des Vaterunsers (da angenommen wird, das Hexen dieses Bekenntnis unmöglich vollbringen können) oder Aussagen von Personen, die ihr Ungemach auf die Beschuldigten zurechnen, weil sie ihnen als Geist erschienen seien (spectral evidence). Die Anschuldigungen ebben nun zunächst ab, zwischen Juli und September gibt es jedoch eine zweite Welle, die ähnlich groß ist wie im April und Mai. Gleichzeitig mehren sich die öffentlich geäußerten Zweifel sowohl an der Beweisführung als auch an der Zahl und Zusammensetzung der Beschuldigten. Es sind mittlerweile nicht nur die sonst eher üblichen sozialen Außenseiter oder Meinungsabweichler in Haft oder durch den Strick gestorben, sondern auch einige lokale Notablen. Ende Oktober löst Phips das Sondergericht wieder auf. Es hat zu diesem Zeitpunkt 19 Todesurteile gefällt und niemanden freigesprochen. Mitte Dezember nimmt ein neues Gericht seine Arbeit auf. Es spricht 49 Angeklagte frei und verurteilt drei Personen, die Phibs jedoch zusammen mit fünf anderen, bereits früher Verurteilten begnadigt. Er entlässt zudem alle noch in Haft befindlichen Beschuldigten und erlässt eine Generalamnestie für all diejenigen, die zu diesem Zeitpunkt noch der Hexerei verdächtigt werden. Nach 1692 gibt es in Neu-England praktisch keine Verfahren mehr wegen eines solchen Verdachts, auch wenn der Glaube an Hexerei nicht verschwindet.
Im 16. und 17. Jahrhundert ist der Verdacht der Hexerei in Alt-England und in Kontinentaleuropa nichts Ungewöhnliches, ebenso gibt es in Neu-England seit seiner Besiedlung ab den 1620er Jahren immer mal wieder entsprechende Verfahren. Doch ist die Hexenverfolgung von Salem Village in diversen Hinsichten bemerkenswert. Nehmen wir allein, wie ansteckend es offensichtlich war, andere der Hexerei zu beschuldigen. Oder denken wir an das hohe Engagement, das viele Beteiligte – Geistliche und Laien – an den Tag legten, andere der Hexerei zu überführen. Oder dass in den Prozessen plötzlich Beweise zulässig waren, die zuvor in den Kolonien wegen geringer Glaubwürdigkeit nicht in die Entscheidungsfindung einbezogen wurden. All das hatte es vor 1692 nicht in Massachusetts gegeben – und auch nie wieder danach. Warum ereigneten sich also diese Vielzahl an Hexerei-Prozessen genau innerhalb dieses einen Jahres?2
Maximale Interpretationen
Die Hexenprozesse (Salem witch trials) gehören zu den bekanntesten Episoden, die sich Menschen über die Zeit der kolonialen Landnahme durch puritanische Siedlergemeinschaften in der Massachusetts Bay erzählen.3 Nicht zuletzt sind die Prozesse historiografisch überaus detailreich untersucht.4 Es ist daher kaum verwunderlich, dass sie zugleich zu so etwas wie einem »Modellfall«5 der Soziologie abweichenden Verhaltens geworden sind – insbesondere infolge von Kai T. Eriksons viel zitierter Beschäftigung mit den »widerspenstigen Puritanern« in Massachusetts und seiner These, dass die Etikettierung bestimmter Personen als »deviant« den normativen Zusammenhalt einer Gemeinschaft garantiert, der sich eine Bevölkerungsmehrheit zurechnet.6
In Interpretation und Sozialtheorie kümmert sich Isaac Ariail Reed nun in beeindruckender Weise darum, dass die Salem witch trials noch breitere Spuren in der Sozialforschung hinterlassen – breiter als »nur« in der Devianzsoziologie. Um Missverständnisse zu vermeiden: Interpretation und Sozialtheorie ist keine empirische Studie über die Ereignisse in der Massachusetts Bay. Dafür lohnt sich der Griff zu diversen Aufsätzen, in denen sich Reed kenntnisreich und innovativ mit diesem historischen Fall befasst hat.7 Es ist vielmehr ein Buch darüber, wie soziale Phänomene idealerweise untersucht werden können und sollten: Phänomene wie eben die Vorgänge in Salem Village, auf die Reed im Laufe seiner Argumentation immer wieder zu sprechen kommt, um seine Überlegungen zu untermauern.
Zuspitzend formuliert macht Reed den Vorschlag, möglichst an »maximalen Interpretationen« zu arbeiten, um zu überzeugenden Erklärungen rätselhafter sozialer Phänomene zu gelangen. Ausgangspunkt dafür sind Übereinkünfte darüber, welche Kenntnisse über ein soziales Geschehen als (einigermaßen) gesicherte Fakten gelten können – von Reed »minimale Interpretationen« genannt. Es geht dann darum, diese Fakten mithilfe theoretischer Konzepte zu »überzeugenden Narrativen«8 zu verdichten, die nicht nur ein »tiefes Verständnis« dieses Geschehens eröffnen, sondern es kausal erklären. Maximale Interpretationen seien also nichts anderes als »interpretative Erklärungen«. Vorbilder gebe es genug, Reed erörtert zum Beispiel Marx’ Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte, Clifford Geertz’ »dichte Beschreibung« der balinesischen Hahnenkämpfe und Susan Bordos feministische Analyse von Essstörungen. Oder zeitgenössischer: Paul Lichtermans Studie über die Gemeindearbeit von kirchlichen Gruppen im Mittleren Westen der USA oder George Steinmetz’ Untersuchung der wilhelminischen Kolonialpolitik.
Die vermeintlichen Hexen von Salem Village und ihre unnachgiebigen Verfolger begegnen uns in Interpretation und Sozialtheorie schon nach wenigen Seiten.9 Genauer gesagt: an einer ersten Schlüsselstelle. Reed präsentiert hier die Vorgänge von 1692 als geradezu paradigmatischen Fall, dass sich interpretative Ansätze der Sozialforschung nicht damit begnügen sollten, die Ereignisse und die Bedeutung (meaning), die Beteiligte mit ihnen verbanden, nur zu beschreiben, sondern sich auch darum bemühen sollten, Ursachen und Konsequenzen der Geschehnisse begreiflich zu machen. Die Fragen, die sich mit Blick auf Salem Village stellen – »Wer fühlte sich durch die Hexen bedroht? Zu welchen Handlungen trieben die Ängste die Menschen, und welche sozialen Prozesse konnten sie auslösen, damit getan wurde, was ihrer Meinung nach getan werden musste? Welche nicht intendierten Nebeneffekte hatten diese Entwicklungen?«10 – stehen Reed zufolge exemplarisch dafür, mit welchen auf Erklärungen abzielenden Fragen sich Forschende befassen sollten, die vornehmlich interpretativ arbeiten. »Wie gelangen Symbole in die soziale Welt und haben Einfluss auf soziales Handeln – Einfluss, den der Forscher oder die Forscherin zudem verstehen und durch die Konstruktion einer Erklärung anderen mitteilen kann?«11 Kurzum, Reed plädiert im Kern für interpretativ angelegte Kausalanalysen.
Darin hat sich die Alchemie des Falls jedoch für Reed noch nicht erschöpft. Es gibt zwei weitere Schlüsselstellen in Interpretation und Sozialtheorie, an denen er sich ihrer bedient. Zum einen erläutert er mit ihrer Hilfe (genauer gesagt mit Blick auf die Diagnose des örtlichen Arztes, dass die Mädchen von Salem Village, die sich merkwürdig benähmen, spirituell bedingte Qualen litten), dass die beiden »Rohstoffe« von maximalen Interpretationen, raum- und zeitgebundene »Fakten« und konzeptuelle »Theorien«, beides Deutungen eines Geschehens seien – und zugleich zwei sorgsam zu unterscheidende Bedeutungssysteme.12 Das Beschreiben der Fakten, »establishing the phenomenon«, wie Reed mit Blick auf Robert K. Mertons einflussreiche Notizbuchfragmente schreibt13, sei zwar äußerst harte Arbeit. Das eigentliche Geschäft der Sozialforschung beginne aber im Grunde erst mit ihrer theoretisch inspirierten Analyse: mit der Arbeit an maximalen Interpretationen, im Zuge derer das nachvollziehbare Wechselspiel von Theorien und Fakten nicht nur zu tieferen Verständnissen der interessierenden Vorgänge führe, sondern zu kausalen Erklärungen.
Zum anderen tauchen die vermeintlichen Hexen und ihre Verfolger erneut, dann aber ein letztes Mal, auf, wenn Reed sich mit dem Realismus als einem »Erkenntnismodus«14 auseinandersetzt, der aus seiner Sicht zu sehr durch eine Logik naturwissenschaftlicher Experimente geprägt sei, um die versteckten Mechanismen des sozialen Lebens zu identifizieren.15 Dem sich historisch ständig wandelnden Symbolgebrauch im sozialen Leben und seinen politischen, wirtschaftlichen oder ganz alltäglichen Konsequenzen sei aber nur schwerlich mit einer Form des Naturalismus beizukommen, der damit rechne, dass die nicht so ohne Weiteres erkennbaren Kräfte, die dieses soziale Leben prägen, unabhängig von diesem Symbolgebrauch existierten, die Existenz dieser »allgemeinen gesellschaftlichen Wirklichkeit«16 aber experimentell und mithilfe der in diese Experimente einfließenden Konzepte und Theorien feststellbar sei. Was das mit den Salem witch trials zu tun hat? Nun, Reed gibt augenzwinkernd zu bedenken, dass in dieser Logik die Ereignisse ja durchaus als erfolgreiches Experiment zu werten wären. Hätten sie nicht bewiesen, dass das Konzept »Hexe« eine nicht so ohne Weiteres erkennbare Kraft des sozialen Lebens bezeichne? Schließlich seien ja einige Personen erfolgreich überführt worden, im Besitz dieser Kraft zu sein.17
Dieser Realismus ist dabei nur einer von drei Erkenntnismodi, mit denen sich Reed in Interpretation und Sozialtheorie ausgiebig und äußerst instruktiv befasst. Ebenso diskutiert er einen Normativismus18, den er dafür kritisiert, dass hier bei aller Faszination für Utopien nicht selten ein noch tieferes Verständnis des momentanen sozialen Lebens sinnvoll wäre, um argumentativ zu überzeugen, sowie einen Interpretivismus19, der zwar dieses tiefere Verständnis erlaube, dessen Interpretationsleistungen aber nicht als Erklärungen angelegt sind. Die Rekonstruktion dieser drei Modi hat für Reed einen doppelten argumentativen Stellenwert. Er umreißt mit ihrer Hilfe einerseits epistemologische und ontologische Problemlagen der Sozialforschung in einer schon länger andauernden Ära diverser »Posts«, darunter »Postpositivismus, Poststrukturalismus, Postmoderne, Postkolonialismus«.20 Sie träfen sich vor allem im Streit darüber, ob und wie Forschende so etwas wie Fakten feststellen könnten. Die wichtigere Kontroverse sieht Reed jedoch darin, wie sie diese Fakten überzeugend deuten, erklären und kritisieren können. Darauf sollte sich der erkenntnistheoretische Streit konzentrieren, und auf einen entsprechenden Vorschlag konzentriert sich Reed in Interpretation und Sozialtheorie. So nutzt er andererseits die Diskussion der drei genannten Erkenntnismodi, um seine eigene Argumentation vorzubereiten, es also insbesondere mit interpretativen Kausalanalysen zu versuchen.
Kausale Erklärungen
Der zugleich simple und äußerst voraussetzungsvolle Clou seines Vorschlags, interpretative Erklärungen zu erarbeiten, besteht darin, die lokal- und momentspezifischen Bedeutungen von zwei generischen Aspekten des sozialen Mit- und Gegeneinanders zu untersuchen, die in der Sozialtheorie oftmals mithilfe der beiden »heuristisch nützlichen Fiktionen«21Motive und Mechanismen umrissen werden.22 Reed wirbt dabei dafür – Aristoteles steht Pate –, zwischen formenden und zwingenden Ursachen eines sozialen Vorgangs zu unterscheiden: Der Grundgedanke dieses Erklärungsansatzes ist, dass sich Motive, die Menschen haben und äußern, und Mechanismen im Sinn von Regularitäten sozialen Handelns nur dann als zwingende Ursachen begreifen lassen, wenn die konkret an einem sozialen Phänomen Mitwirkenden sie qua Bedeutung, die sie ihnen geben, zu diesen formen. »Ohne die formgebenden Kapazitäten von Bedeutung sind diese Theorien sinnlos«, skizziert Omar Lizardo diesen Ansatz in seiner Besprechung des Buches.23 Erst die Ortsgebundenheit und das Timing von Bedeutungszurechnungen – Reed spricht von »Signifikationen« – formt aus potenziellen Ursachen zwingende. In dieser Perspektive arbeiten Forschende dann im Grunde an »Resignifikationen«24 der Ereignisse, für die sie sich interessieren. Dazu bedienen sie sich solcher Theorien und Konzepte, die ihnen zu verstehen helfen, warum vergleichsweise allgemeine, nicht an bestimmte Orte und an bestimmte Zeiten gebundene Aspekte des sozialen Lebens – »Motive« und »Mechanismen« – aufgrund ihrer Indexikalität kausales Gewicht haben.25
Simpel ist dieser Clou, weil Reed sich damit gar nicht weit von den Erkenntnismodi entfernt, die er zuvor rekonstruiert und kritisiert. Er setzt ihre, sagen wir, grundsätzlichen Anliegen – die Strukturen einer allgemeinen sozialen Realität zu theoretisieren (Realismus), gesellschaftliche Verhältnisse zu kritisieren, indem die utopischen Gehalte bestimmter historischer oder zeitgenössischer Diskursformationen zum Maßstab erhoben werden (Normativismus), und zu tiefen Verständnissen lokal- und momentspezifischer Alltagsphänomene zu gelangen (Interpretivismus) – nur recht unkonventionell zu einem Entwurf zusammen, der Sozialforschung primär als soziohistorisch sensible Hermeneutik begreift und nicht an Modellen naturwissenschaftlichen Erklärens orientiert. Die situativen Bedeutungen, die Menschen einander, sich selbst und den sie umgebenden Dingen und Vorgängen zumessen, sind in dieser Perspektive nicht »auch« relevant, um soziale Phänomene zu erklären, im Grunde also nur Beiwerk, die im besten Fall auf Tiefenstrukturen des sozialen Lebens schließen lassen. Nein, Reed dreht die Perspektive um. Erst die lokal- und momentspezifischen Bedeutungszurechnungen sind es, durch die »Motive«, darunter nicht zuletzt utopische Projekte, und »Mechanismen« ihren kausalen Stellenwert erhalten!26 Sich nicht an naturwissenschaftlichen Modellen zu orientieren, bedeute daher keinesfalls, nicht das gleiche Forschungsethos zu teilen.27
Das ist insofern voraussetzungsvoll, weil es Forschende vor die Aufgabe stellt, sozialtheoretisch nicht nur mit »Motiven« und »Mechanismen« zu rechnen, sondern die symbolische, bedeutungsvolle Umgebung zu verstehen, in denen sich die interessierenden Phänomene ereignen, in die soziales Handeln konkret eingebettet ist. Reed nennt diese soziohistorisch spezifischen Umgebungen »Bedeutungslandschaften«, in denen die Beteiligten sich und andere orientieren (oder es versuchen). Es handelt sich um eine Art »sensibilisierende Metapher«, die er nicht auf die mittlerweile so gebräuchliche Vorstellung reduziert wissen will, Sozialität ereigne sich auf »Feldern«28. Bedeutungslandschaften können sicherlich in vielen Fällen eine feldähnliche Topologie haben. Das Cover des US-amerikanischen Originals von Interpretation und Sozialtheorie spielt nicht zuletzt mit Motiven von Bruegels Gemälde Die Kornernte, das Reed auch erwähnt, weil das Malen eines Landschaftsbildes aus seiner Sicht eine treffende Analogie dafür ist, dass die Arbeit an Erklärungen sozialer Phänomene aus seiner Sicht damit beginnt (und elementar davon abhängt), soziohistorisch spezifische Bedeutungsformationen zu entdecken. Das heißt dann ebenso, sich die eigene Positionalität in Bedeutungslandschaften und die politischen Implikationen der eigenen Aussagen vor Augen zu führen – bzw. damit zu rechnen, dass andere diesen Aussagen utopische oder dystopische Bedeutung zumessen.29
Begeisterte Skepsis
Der Forschungsansatz, für den Reed wirbt, könnte ambitionierter kaum sein. Vordergründig trägt Interpretation und Sozialtheorie fast schon imperialistische Züge, indem er sich zutraut, eine Post-»Posts«-Synthese aus realistischen, normativen und interpretativen Überlegungen zu formulieren. Es lohnt sich aber, genauer hinzuschauen. Sicher, das Buch provoziert. Vor allem zum Nachdenken und zur Reflexion über das eigene Arbeiten.
Ironischerweise liegt seine vermeintlich imperiale Ambition jedoch vor allem darin, gleichsam gegen zu geringe und zu hohe Ambitionen in der Sozialforschung zu argumentieren. Zu gering sei der Anspruch, nur zu rekonstruieren, was passiert, mithin bei »minimalen Interpretationen« zu verweilen. Für zu hoch gegriffen hält Reed dagegen ein Streben nach der einen kohärenten Mastersozialtheorie. Er rät vielmehr zu einer gepflegten Theorienpluralität, hält »Theorie« somit nicht für eine Königsdisziplin der Sozialforschung, sondern für etwas, das sich in maximalen Interpretationen beweisen muss. Und wenn es, wie Geertz es bei den balinesischen Hahnenkämpfen vormacht, diverser theoretischer Konzepte bedarf, um sich diverse Aspekte eines Geschehens begreiflich zu machen – ja, wo ist das Problem? »Pluralität in der Theorie, Einheitlichkeit in der Bedeutung, Historizität in der Erklärung.«30 Es geht Reed um kohärente Narrative mit Erklärungswert, nicht um kohärente Theorie.31
Das alles erörtert Reed in einem entspannten, fast schon »therapeutisch«32 anmutenden Ton – entfaltet jedoch sukzessive eine Wucht, die es mir schwer gemacht hat, das Buch aus der Hand zu legen. Interpretation und Sozialtheorie ist natürlich kein Krimi, aber zwischendurch habe ich mich schon gefragt, ob die Sache einigermaßen gut endet. Wie wird es ihm gelingen, die verschiedenen Stränge zu dem in der Einleitung angekündigten Ansatz einer »kausalen Hermeneutik« zu verstricken? – Souverän, würde ich sagen. Und zwar weil Reed hier keine Diskussion über gute, epistemologisch versierte Sozialforschung zu ihrem Abschluss bringen möchte. Er macht im Grunde eine Art »Eröffnungszug«33 für ein Spiel, in dem es darum geht, die Vielzahl an »Posts« hinter sich zu lassen und in möglichst breiter Runde an überzeugenden Erklärungen zu arbeiten, die an lokalen Bedeutungen der interessierenden Phänomene ansetzen.
Bücher sind oftmals dann »groß«, wenn sie tiefgreifende Fragen nicht nur aufwerfen, sondern geradezu provozieren. Ich meine damit nicht, Leser*innen ratlos zurückzulassen, sondern das Gegenteil: Sie dazu anzuregen, sehr präzise ihre Skepsis zu formulieren, die durchaus mit Begeisterung gepaart sein kann. Kein Wunder also, dass die in Reviews und Symposien geäußerten Fragen an Interpretation und Sozialtheorie durch die Bank zwar sympathetisch, aber gravierend sind. Ich greife nur einige heraus: Wie können wir uns semiotisch begreiflich machen, wie Dinge, Menschen und Vorgänge ihre Bedeutung erhalten?34 Reed lenkt das Augenmerk vor allem auf sprachliche Signifikationen – wie trägt der Ansatz Materialitäten und nicht menschlichen Akteuren, Affekten und Affordanzen Rechnung?35 Ließe sich das recht statisch geratene Bild der Bedeutungslandschaft nicht mithilfe von Paul Ricoeurs Idee der Sedimentation dynamisieren?36 Müssen wir uns eigentlich noch mit zwingenden Ursachen befassen, wenn wir die Formung von Ursachen kennen? Verabschiedet sich Reed nicht ein wenig zu voreilig von den analytischen Potenzialen allgemeiner Theorie?37 Ist das Buch in normativer Hinsicht nicht zu harmonisch und undialektisch geraten, da Dystopien, Handlungsbeschränkungen, Gewaltsamkeiten und andere Schattenseiten der Aufklärung vergleichsweise wenig Aufmerksamkeit erfahren – trotz der relativen Prominenz der Salem witch trials?38 Müsste Reed dem soziopolitischen Kontext, wie Interpretationen und Erklärungen ihre (vermeintliche) Überzeugungskraft erlangen, nicht wesentlich expliziter Rechnung tragen?39 Ist die Metapher der Bedeutungslandschaft nicht etwas zu offen geraten, um tatsächlich forschungsleitend zu sein?40 Ich selbst habe mich gefragt, warum Reed den seit Jahrzehnten eher entspannt-kritischen Umgang der Chicagoer Soziologie mit soziologischen Erklärungen beiseitelässt, scheint es mir doch einige mögliche Verwandtschaftsbeziehungen in Sachen qualitative Kausalanalyse zu geben.41 Wie auch immer, die zahlreichen Fragen an das Buch sind zusammengenommen eine einzige Einladung, sich selbst ein Bild zu machen.
Ist das Bild eines Eröffnungszugs aber wirklich treffend? Darüber ließe sich ebenfalls streiten. Denn ebenso gut ließe sich behaupten, dass Reed 2011 ein Spielfeld betrat, das schon recht gut bevölkert war42 – von einigen leider bereits verlassen wurde43 – und in den Folgejahren weitere Mitspieler sah44. Gerade in der US-amerikanischen Soziologie gibt es spätestens seit den 1990er Jahren eine zunehmende Lust, an schlagkräftigen Erklärungsansätzen im interpretativen Register zu arbeiten. Interpretation und Sozialtheorie ist in dieser Perspektive nur ein Teil einer breiteren Bewegung, aber ein bedeutender. In der deutschsprachigen Soziologie ist die Rezeption dieser Bewegung eher verhalten, insbesondere im Vergleich dazu, dass es immer starke, gleichsam affirmative und kritische Rezeptionstrends der US-amerikanischen Sozialtheorie gegeben hat – denken wir nur an die Modernisierungstheorie und den Strukturfunktionalismus in den 1960er und 1970 Jahren, das interpretative Paradigma und insbesondere die Ethnomethodologie seit den 1970er Jahren, Theorien rationaler Wahl verstärkt seit den 1990er Jahren oder Netzwerktheorien insbesondere in den 2000er Jahren. Berücksichtigen wir jedoch, dass Anwendung und Anwendungsbereich des Makro-Mikro-Makro-Modells der soziologischen Erklärung umstritten sind45, die Mechanismen-Diskussion reif ist, zu einer sozialtheoretisch inspirierten Prozessanalyse weitergeführt zu werden46, und die laufende Arbeit an prozessualen, erzähltheoretisch inspirierten Erklärungsansätzen einen möglichen Anlehnungskontext bietet47, dann stehen die Zeichen für eine breitere Rezeption vielleicht gar nicht so schlecht. Es wird aber womöglich eher von den materialen Ergebnissen interpretativer Kausalanalysen abhängen, ob und wie sie auch die Bedeutungslandschaft der deutschsprachigen Sozialforschung mitgestalten.
Salem witch trials, revisited
Während Reed 2007 in seinem preisgekrönten Aufsatz Why Salem Made Sense vor allem nach den sozialen Bedingungen dafür fragt, warum sich 1692 die Hexerei-Anschuldigungen in der Massachusetts Bay überproportional häufen, und insbesondere die in der Forschung kaum thematisierten Patriarchalstrukturen diskutiert, legt er 2015 eine weitere Studie zu den Salem witch trials vor. Deep Culture in Action ist eine faszinierende maximale Interpretation, die von der Frage geleitet ist, wie sich die sozialen Bedingungen für eine moral panic – eine Bevölkerungsmehrheit macht einen bestimmten Personenkreis für eine gesellschaftliche Situation verantwortlich und fordert Konsequenzen48 – zu einer tatsächlichen moral panic mit tatsächlichen Konsequenzen für Leib und Leben der Bezichtigten auswachsen. Reed lässt die Leser*innen tief in das Geschehen eintauchen. Er erörtert insbesondere das »performative Timing«49 von Predigten puritanischer Geistlicher – Samuel Parris, Lawson und Cotton Mather. Sie formen die seit einigen Jahren um sich greifende Endzeitstimmung in den puritanischen Siedlungen immer wieder aufs Neue zu einer Situationsdefinition, die es nicht nur erlaubt, die mysteriösen Verhaltensweisen der Mädchen als Teufelswerk zu deuten, sondern insbesondere zu raschem Handeln gegen die mutmaßlichen Hexen und ihre Unterstützer drängt. Durch die mythologische Resignifikation der Ereignisse, die den Pastoren zu Zeitpunkten großer Beunruhigung gelingt, überzeugen sie eine kritische Masse in der lokalen Bevölkerung in entscheidenden Momenten, dass die vermeintlichen Hexen für alle Übel stehen, die den puritanischen Siedlungen seit Jahren widerfahren.50 Dazu zählen der unsichere politische Status der Gebiete, nachdem der englische König die Gründungscharta der Siedlungen und die damit verbundenen Landrechte 1684 außer Kraft gesetzt hatte, der bedrohliche Krieg im nahe gelegenen Maine (»King William’s War«) und – implizit – der schwindende Einfluss des puritanischen Glaubens und der puritanischen Geistlichen insbesondere auf die jüngere Bevölkerung. Die Salem witch trials erweisen sich somit einmal mehr als Modellfall, nun aber insbesondere für eine stärker prozessual angelegte Form der interpretativen Kausalanalyse, für die Reed wirbt. Zusammen mit einem weiteren Aufsatz von 2016, der auch die Salem witch trials verarbeitet51, und eher methodologischen Beiträgen, viele in Ko-Autorschaft,52 arbeitet Reed hier praktisch an dem vorgeschlagenen Erklärungsansatz weiter – nur eben nicht mehr in Buchform.
Fallen Interpretation und Sozialtheorie und seine Aufsätze zu den Ereignissen in der Massachusetts Bay in seine Zeit als Professor an der University of Colorado-Boulder (2007–2016), lehrt er mittlerweile Soziologie an der University of Virginia in Charlottesville. Seine Produktivität ist ungebrochen. Zusammen mit Claudio Benzecry und Monika Krause gibt er 2017 Social Theory Now heraus, das schon in kurzer Zeit als Standardwerk für alle gelten kann, die sich für den Stand aktueller sozialtheoretischer Debatten (nicht nur in den USA) interessieren.53 2020 erscheint seine zweite Monografie Power in Modernity. Agency Relations and the Creative Destruction of the King’s Two Bodies.54 Natürlich haben auch hier die vermeintlichen Hexen von Salem Village ihren Auftritt. Diesmal begegnen sie Oscar Wilde. Es gibt bei Reed noch einiges zu entdecken!
1 Isaac Ariail Reed, »Deep Culture in Action: Resignification, Synecdoche, and Metanarrative in the Moral Panic of the Salem Witch Trials«, in: Theory and Society 44/1 (2015), S.77.
2 Isaac Reed, »Why Salem Made Sense: Culture, Gender, and the Puritan Persecution of Witchcraft«, in: Cultural Sociology 1/2 (2007), S.212.
3 Je nach Blickwinkel sind die Ereignisse dann für gewöhnlich in eine heroische Saga verpackt oder kennzeichnen das Ende einer eigentümlichen Siedlungsutopie: Sie offenbaren dann die moralische Aushöhlung eines Projekts, das ursprünglich einmal das neue spirituelle (und vor allem reine) Zentrum der Christenheit sein sollte und bis heute im Gründungsmythos eines »exzeptionellen Amerikas« der Toleranz, des Ausgleichs und der Harmonie nachwirkt; Kai T. Erikson, Die widerspenstigen Puritaner. Zur Soziologie abweichenden Verhaltens, Stuttgart 1978, S. 141; Richard Latner, »Salem Witchcraft, Factionalism, and Social Change Reconsidered: Were Salem’s Witch-Hunters Modernization’s Failures?«, in: The William and Mary Quarterly 65/3 (2008), S.423.
Arthur Miller popularisierte die Prozesse Anfang der 1950er Jahre durch sein Stück Hexenjagd (The Crucible), in dem er die Ereignisse allegorisch nutzte, um Kritik an der sogenannten Kommunistenjagd in den USA zu üben. Wer heute den Ausdruck Hexenjagd nutzt, um soziale Angriffe auf eine oder mehrere Personen anzuprangern und zu delegitimieren, bezieht sich damit mehr oder weniger direkt auf die Vorgänge in Salem Village.
4 Siehe nur stellvertretend für zwei grundlegend verschiedene historiografische Ansätze Marion L. Starkey, The Devil in Massachusetts. A Modern Inquiry into the Salem witch trials, New York 1949; Paul S. Boyer und Stephen Nissenbaum, Salem Possessed. The Social Origins of Witchcraft, Cambridge, Mass. 1976.
5 Monika Krause hat mit diesem Begriff jüngst solche Untersuchungsgegenstände bezeichnet, denen sich Sozialwissenschaftlerinnen immer wieder aufs Neue zuwenden. Es handele sich in dieser Perspektive um »privilegierte materiale Forschungsobjekte«, die in der Biologie schon lange als »model systems« behandelt werden und in der Sozialforschung als »model cases« begriffen werden sollten. Sie fokussierten Aufmerksamkeiten in Forschungskollektiven (und lenkten sie gleichsam von anderen Fällen weg). Außerdem versorgten sie analytische Kategorien mit Inhalt: Sie seien oftmals maßgeblich dafür, was die theoretischen Konzepte, die Forschende zur Untersuchung des Modellfalls adaptieren oder erfinden, inhaltlich aussagen sollen; Monika Krause, Model Cases. On Canonical Research Objects and Sites, Chicago/London 2021, insb. S. 30.
6 Erikson, Die widerspenstigen Puritaner. Die Salem witch trials sind einerseits indirekt Thema, wenn sich die betreffenden Autoren auf Eriksons Studie beziehen; William J. Chambliss und Milton Mankoff, Whose Law? What Order? A Conflict Approach to Criminology, New York 1976, S. 15–16; Nachman Ben-Yehuda, »The European Witch Craze of the 14th to 17th Centuries: A Sociologist’s Perspective«, in: American Journal of Sociology 86/1 (1980), S. 24; ders., »Problems Inherent in Socio-Historical Approaches to the European Witch Craze«, in: Journal for the Scientific Study of Religion 20/4 (1981), S. 335; Erich Goode und Nachman Ben-Yehuda, Moral Panics. The Social Construction of Deviance, Chichester/Malden, MA 2009, S.56, 62; Julia M. Garrett, »Dramatizing Deviance: Sociological Theory and ›The Witch of Edmonton‹«, in: Criticism 49/3 (2007) S.327–375. Oder die Prozesse sind selbst der Untersuchungsgegenstand: Gary F. Jensen, The Path of the Devil. Early Modern Witch Hunts, Lanham 2007, S. 179–224; Richard Weisman, Witchcraft, Magic, and Religion in Seventeenth-Century Massachusetts, Amherst 1984.
7 Reed, »Why Salem Made Sense«; ders., »Deep Culture in Action«; ders., »Between Structural Breakdown and Crisis Action: Interpretation in the Whiskey Rebellion and the Salem Witch Trials«, in: Critical Historical Studies 3/1 (2016), S.27–64; ich werde abschließend genauer auf diese Studien eingehen. Lesenswert ist zudem eine kritische Auseinandersetzung mit Clifford Geertz’ Interpretivismus, in der Reed die Salem witch trials andiskutiert: Isaac Ariail Reed, »Maximal Interpretation in Clifford Geertz and the Strong Program in Cultural Sociology: Towards a New Epistemology«, in: Cultural Sociology 2/2 (2008), S. 187–200.
8 Siehe dazu in diesem Band: Kapitel 1, »Wissen«, S.68.
9 Siehe dazu in diesem Band: »Einleitung«, S. 36–37.
10 Ebd., S.37.
11 Ebd., S.37.
12 Siehe dazu in diesem Band: Kapitel 1, »Wissen«, S. 42–46. Die einen – Fakten – sind indexikal und knüpfen möglichst daran an, wie die konkret Beteiligten die sie umgebende Welt betrachtet und das interessierende Ereignis mit- und gegeneinander gestaltet haben. Reed spricht daher auch von »sozialen Fakten«. Als Faktum zählt dann, dass ein Arzt, der sich selbst als ein solcher begriff und auch in den Augen anderer als solcher anerkannt war, Teufelswerk erkannte und damit insbesondere bei einigen Geistlichen des Ortes auf Zustimmung stieß (nicht aber, nebenbei bemerkt, bei der bis dato geachteten Martha Corey, die dann am 19.März 1692 selbst der Hexerei beschuldigt wurde). Das Faktum selbst ist gleichsam deutungsbasiert, da es sich um eine heutige Übereinkunft dessen handelt, was seinerzeit passiert ist, und diese Übereinkunft wiederum auf einem geteilten Verständnis beruht, was die Menschen damals meinten, wenn sie jemanden als Arzt und jemand anderen als »unter böser Hand« identifizierten. Die anderen – Theorien – sind demgegenüber abstrakt und erlauben es in Form eines »Metakommentars« (siehe dazu in diesem Band: Kapitel 1, »Wissen«, S. 45), Fakten analytisch zu betrachten, Forschungsfragen zu formulieren und bereits existierende theoretische Interpretationen von Fakten zu hinterfragen. Ist es tatsächlich überzeugend, die Salem witch trials, wie in mancher Studie geschehen, als »Ausdruck der wirtschaftlichen Transformation im frühen Amerika« zu begreifen? Oder »als eine der letzten gewalttätigen Episoden in der ausgedehnten Struktur des frühmodernen europäischen Patriarchats«? Oder »als frühen Ausdruck des amerikanischen Populismus«? (siehe dazu in diesem Band: Kapitel 1, »Wissen«, S.49)
13 Robert K. Merton, »Three Fragments From a Sociologist’s Notebooks: Establishing the Phenomenon, Specified Ignorance, and Strategic Research Materials«, in: Annual Review of Sociology 13/1 (1987), S. 1–29.
14 Siehe dazu in diesem Band: »Einleitung«, S. 32.
15 Reed bezieht sich dabei insbesondere auf zwei zentrale Werke von Roy Bhaskar: A Realist Theory of Science (Classical texts in critical realism), London; New York 2008 (ursprünglich 1975); The Possibility of Naturalism. A Philosophical Critique of the Contemporary Human Sciences, New York 1998 (ursprünglich 1979).
16 Siehe dazu in diesem Band: Kapitel 2, »Realität«, S.77.
17 Siehe dazu in diesem Band: Kapitel 2, »Realität«, S.95.
18 Hier diskutiert er Jürgen Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft, Frankfurt am Main 1990 (ursprünglich 1962); Leela Gandhi, Affective Communities: Anticolonial Thought, Fin-de-Siècle Radicalism, and the Politics of Friendship, Durham 2006.
19 Dazu setzt er sich mit Clifford Geertz, Dichte Beschreibung: Beiträge zum Verstehen kultureller Systeme, Frankfurt am Main 1987, und Susan Bordo, »Anorexia Nervosa: Psychopathology as the Crystallization of Culture«, in: dies., Unbearable Weight. Feminism, Western Culture and the Body, Berkeley 1994, S. 139–164, auseinander.
20 Siehe dazu in diesem Band: »Einleitung«, S.28.
21 Siehe dazu in diesem Band: Kapitel 5, »Erklärung«, S.214.
22 Ebd., S. 198.
23 Omar Lizardo, »Review of Interpretation and Social Knowledge: On the Use of Theory in the Human Sciences«, in: American Journal of Sociology 118/2 (2012), S.498; eigene Übersetzung.
24 Siehe dazu in diesem Band: Kapitel 1, »Wissen«, S.60.
25 Siehe dazu in diesem Band: Kapitel 5, »Erklärung«, S. 198.
26 Siehe dazu in diesem Band: Kapitel 5, »Erklärung«, S.209.
27 Isaac Ariail Reed, »Response to Critics of Interpretation and Social Knowledge«, in: Trajectories 24/2 (2013), S. 13.
28 John Levi Martin, »What Is Field Theory?«, in: American Journal of Sociology 109/1 (2003), S. 1–49.
29 Insbesondere Marek Skovajsa macht auf eine entsprechende Lesart von Interpretation und Sozialtheorie aufmerksam: Marek Skovajsa, »Introducing the Symposium on ›Interpretation and Social Knowledge‹ by Isaac Ariail Reed‹, in: Sociologický Časopis/Czech Sociological Review 51/3, Institute of Sociology of the Academy of Sciences of the Czech Republic (2015), S.473–474.
30 Siehe dazu in diesem Band: Kapitel 5, »Erklärung«, S.217.
31 Reed, »Response to Critics of Interpretation and Social Knowledge«, S. 14.
32 Jim Livesey, »How Will I Know?«, in: Trajectories 24/2 (2013) TH, dig S.9.
33 Andrew Abbott, Methods of Discovery. Heuristics for the Social Sciences, New York 2004, S.4.
34 Andrea Cossu, »Isaac Ariail Reed, Interpretation and Social Knowledge. On the Use of Theory in the Human Sciences, Chicago: University of Chicago Press, 2011, 216 pp.«, in: Sociologica /1/2012 (2012).
35 Dominik Bartman´ski und Werner Binder, »Being and Knowledge: On Some Liabilities of Reed’s Interpretivism«, in: Sociologický Časopis/Czech Sociological Review 51/3 (2015), S.507–508; Eeva Luhtakallio, »Hands in the Peat, or on the Metaphors of Meaning«, in: Sociologický Časopis/Czech Sociological Review 51/3 (2015), S.492.
36 Luhtakallio, »Hands in the Peat, or on the Metaphors of Meaning«, S.490.
37 Hendrik Vollmer, »Meaning, Commensuration, and General Theory«, in: Sociologický Časopis/Czech Sociological Review 51/3 (2015), S.512–517. Siehe dazu auch den Zweifel an tragfähigen Begründungen eines Theorienpluralismus, den Richard Biernacki äußert; »Reading Scholarship with Reed«, in: Trajectories 24/2 (2013), S. 2–6.
38 Livesey »How Will I Know?«, S. 11.
39 Craig Browne, »Book Review: Isaac Ariail Reed, Interpretation and Social Knowledge: On the Use of Theory in the Human Sciences«, in: International Sociology 28/2 (2013) S.230–233.
40 Andreas Glaeser, »Review Interpretation and Social Knowledge: On the Use of Theory in the Human Sciences«, in: Contemporary Sociology 42/6 (2013) S.867–869.
41 Howard S. Beckers und Irving L. Horowitz’ zuspitzende Beschreibung von »guter Soziologie« geht mir hier durch den Kopf: »Good sociology is sociological work that produces meaningful descriptions of organizations and events, valid explanations of how they come about and persist, and realistic proposals for their improvement or removal. Sociology based on the best available evidence should provide analyses that are likely to be true in the linguistic sense of not being falsifiable by other evidence, and also in the ontological sense of being ›true to the world‹«; Howard S. Becker und Irving Louis Horowitz, »Radical Politics and Sociological Research: Observations on Methodology and Ideology«, in: American Journal of Sociology 78/1 (1972) S.50; siehe dazu auch Howard S. Becker, Soziologische Tricks. Wie wir über Forschung nachdenken können, Hamburg 2021.
42 Larry J. Griffin, »Narrative, Event-Structure Analysis, and Causal Interpretation in Historical Sociology«, in: American Journal of Sociology 98/5 (1993), S.1094–1133 ; Jack Katz, »From How to Why: On Luminous Description and Causal Inference in Ethnography (Part I)«, in: Ethnography 2/4 (2001) S.443–473; Jack Katz, »From How to Why: On Luminous Description and Causal Inference in Ethnography (Part II)«, in: Ethnography 3/1 (2002) S.63–90; Peter Abell, »Narrative Explanation: An Alternative to Variable-Centered Explanation?«, in: Annual Review of Sociology 30 (2004), S.287–310; Andreas Glaeser, »An Ontology for the Ethnographic Analysis of Social Processes: Extending the Extended-Case Method«, in: Social Analysis 49/3 (2005), S. 16–45; George Steinmetz, Devil’s Handwriting: Precoloniality and the German Colonial State in Qingdao, Samoa, and Southwest Africa., Chicago 2007; Neil Gross, »A Pragmatist Theory of Social Mechanisms«, in: American Sociological Review 74/3 (2009), S. 358–379; Andrew Abbott, Zeit zählt. Grundzüge einer prozessualen Soziologie, Hamburg 2020.
43 Thomas Hoebel und Stefan Malthaner, »Warum Tilly lesen?«, in: Charles Tilly, Why? Was passiert, wenn Leute Gründe angeben … und warum, Hamburg 2021, S. 7–29.
44 John Levi Martin, The Explanation of Social Action, New York 2011; Iddo Tavory und Stefan Timmermans, »A Pragmatist Approach to Causality in Ethnography«, in: American Journal of Sociology 119/3 (2013), S. 682–714; Matthew Norton, »Mechanisms and Meaning Structures«, in: Sociological Theory 32/2 (2014), S. 162–187.
45 Thomas Kron und Lena M. Verneuer, »Struktur? Physis? Situation? Zur Erklärung von Gewalt«, in: Berliner Journal für Soziologie 30/3–4 (12.2020), S. 393–419; Thomas Hoebel, »Aspektverluste. Warum der Vorschlag von Thomas Kron und Lena M. Verneuer, die soziologische Gewaltforschung zu erneuern, nicht weiterführt«, in: Berliner Journal für Soziologie 31/3–4 (2021), S.531–545.
46 Frank Nullmeier, Kausale Mechanismen und Process Tracing. Perspektiven der qualitativen Politikforschung, Frankfurt am Main/New York 2021.
47 Wolfgang Knöbl, Die Soziologie vor der Geschichte. Zur Kritik der Sozialtheorie, Berlin 2022, insb. Kap. 6 und 7.
48 Klassisch: Stanley Cohen, Folk Devils and Moral Panics. The Creation of the Mods and Rockers, Abingdon; New York 2011 (ursprünglich 1972).
49 Reed, »Deep Culture in Action«, S.87.
50 Ebd.
51 Reed, »Between Structural Breakdown and Crisis Action«.
52 Siehe nur Daniel Hirschman und Isaac Ariail Reed, »Formation Stories and Causality in Sociology«, in: Sociological Theory 32/4 (2014), S. 259–282; Isaac Ariail Reed und Mayer N. Zald, »The Unsettlement of Communities of Inquiry«, in: Richard Swedberg (Hg.), Theorizing in Social Science: The Context of Discovery, Stanford 2014, S.61–84; Paul Lichterman und Isaac Ariail Reed, »Theory and Contrastive Explanation in Ethnography«, in: Sociological Methods & Research 44/4 (2015) S.585–635; Carly R. Knight und Isaac Ariail Reed, »Meaning and Modularity: The Multivalence of ›Mechanism‹ in Sociological Explanation««, in: Sociological Theory 37/3 (2019) S.234–256.
53 Claudio E. Benzecry, Monika Krause und Isaac Reed (Hg.), Social Theory Now, Chicago 2017.
54 Isaac Ariail Reed, Power in Modernity: Agency Relations and the Creative Destruction of the King’s Two Bodies, Chicago 2020.
ISAAC ARIAIL REED
Einleitung
I
Unser Verständnis davon, was wir über Soziales wissen und wie wir es wissen können – kurz: unser Verständnis sozialen Wissens –, bedarf einer gewaltigen Veränderung. Die Auseinandersetzungen einer ganzen Generation über Postmoderne und Wissenschaft, Relativismus und Objektivität haben unsere Sicht getrübt; beharrlich wurde eine Verbindung zwischen Diskursanalyse und einer Haltung der philosophischen Skepsis und ironischen Distanz gezogen; regelmäßig wurde die Möglichkeit kausaler Erklärungen bestritten, was die Interpretation von Kulturen beeinträchtigt hat; die überwältigende Tendenz, das Problem des sozialen Wissens als eine Frage zu behandeln, ob die Sozialwissenschaften wie die Naturwissenschaften werden können, hatte zur Folge, dass wir uns wesentliche Fragen nicht mehr stellten. Der Raum für epistemologische Argumente in der Sozialtheorie wird mittlerweile durch »Posts« und ihre Gegensätze definiert: Postpositivismus, Poststrukturalismus, Postmoderne, Postkolonialismus. Unabhängig davon, was die »Posts« tatsächlich sind oder nicht sind, ist das Nachdenken über soziales Wissen in dieser manichäischen Darstellung ein Disput darüber, ob die Wissenschaft (und vielleicht die Moderne) gut oder schlecht ist.
Die Forschenden, die tatsächlich eine Form des sozialen Wissens produzieren wollen, erfahren die Dispute von Sozialtheorie und Philosophie oft nicht so unmittelbar, sondern sublimiert in verdrehten Verlautbarungen über Methodik: qualitative gegen quantitative Methoden; strukturierte gegen nicht strukturierte Interviews; teilnehmende Beobachtung gegen Befragungen; kurz gesagt, Tiefe gegen Allgemeinheit. Und so tauchen metatheoretische Auseinandersetzungen über die Konstruktion und Begründung sozialen Wissens als Debatten über gelebte soziale Wirklichkeiten und darüber, mit welchem Forschungsdesign sie erfasst werden sollen, wieder auf.
Die Diskussionen über die Methode sind ganz zweifellos real: Sie markieren signifikante Divergenzen darüber, wie in der Sozialforschung Belege (evidence) gesammelt und zusammengefügt werden. Doch in ihren Konnotationen enthalten sie alle das gleiche erkenntnistheoretische Dilemma. Von einem Standpunkt aus gibt es klar und rigoros quantifizierbare, verifizierbare Wahrheiten über soziale Phänomene, und es gibt diejenigen, die es aus welchen Gründen auch immer vorziehen, ihre eigenen interpretierenden Fantasien auf idiosynkratische Daten zu stützen, die sie auf idiosynkratische Weisen gesammelt haben. Vom entgegengesetzten Standpunkt aus bemühen sich »Objektivist*innen« und »Positivist*innen« nicht wirklich um Objektivität, sondern tragen sie lediglich zur Schau. Aus der Sicht der Letzteren verhindert die hartnäckige Orientierung großer Teile der Humanwissenschaften an den Naturwissenschaften ein echtes Verständnis des sozialen Lebens; dieses könne nur erreicht werden durch die von gewissenhafter Humanität getragene Beobachtung, was Menschen tatsächlich tun, sagen, denken und denen erzählen, die Interviews mit ihnen führen.1
Aber vielleicht sind die starken Gefühle von Verzweiflung und Déjà-vu, die solche Dilemmata erzeugen, gar nicht nötig. Wir können neu nachdenken. Beginnen wir also mit der Frage: Lassen sich all die Probleme, die wir als Forscher*innen und Theoretiker*innen haben, als Unterschiede in den Methoden begreifen, konkret verstanden als das, was wir tun, um faktische Aussagen über das soziale Leben, ob breit gefasst oder eng, treffen zu können? Oder holen Dispute über Methodik, wenn sie gründlich geführt werden, andere Probleme ans Licht, Probleme, die sich nicht auf Messverfahren und Technik reduzieren lassen, sondern die auf tiefe Spaltungen bei unserer grundsätzlichen Vorstellung hindeuten, wie eine Gemeinschaft von Forschenden etwas über andere menschliche Gemeinschaften und ihre verschiedenen Dynamiken erfahren kann?2 Ich frage mich beständig, ob man die Welt der Sozialforschung wirklich aufteilen kann in jene, die an die Existenz sozialer Fakten in einem quantitativen Sinn glauben, und die anderen, die das nicht tun, oder ob diese Aufteilung womöglich ihren heuristischen Nutzen verloren hat. Anders ausgedrückt: Sollten die großen Kontroversen über Natur und Zweck von Forschung in den Humanwissenschaften auf der Ebene der Fakten ausgefochten werden? In einer Hinsicht lautet die Antwort ja: Bevor wir etwas anderes tun, müssen wir einen Weg finden, um »das Phänomen festzustellen« (establishing the phenomenon).3 Aber in anderer Hinsicht ist die Antwort nein: Debatten über Methoden enthalten oft implizite Meinungsverschiedenheiten über Natur und Zweck der Untersuchung, über die Struktur des sozialen Lebens selbst und über die Rolle, die der oder die kritische Intellektuelle oder der oder die Sozialforschende bei dessen Verständnis spielt. Wenn wir diese Meinungsverschiedenheiten explizit machen, sehen wir, dass sie sich nicht nur um die Methodik im strengen Sinn drehen, sondern auch darum, wie Wissensbehauptungen aus konzeptuellen Innovationen entwickelt, in Publikationen verteidigt und als unzutreffend oder unwahr kritisiert werden (oder, um das so ärgerlich vieldeutige Wort zu benutzen, »problematisiert« werden).
Tatsächlich haben wir unterschiedliche Meinungen nicht nur darüber, wie wir die schiere Existenz dieses oder jenes sozialen Phänomens feststellen, sondern auch, wie wir den Anspruch erheben können, es korrekt und wirksam zu erklären, zu kritisieren oder zu interpretieren. Nach meinem Verständnis stehen im Mittelpunkt der Kontroversen über soziales Wissen diese letztgenannten Meinungsverschiedenheiten und weniger die, ob es so etwas wie soziale Fakten gibt oder nicht. Und deshalb müssen wir diese Meinungsverschiedenheiten angehen, wenn wir über die Welt der »Posts« hinausgelangen wollen.
II
In den Diskursen, die es in der und rund um die aktuelle Sozialtheorie gibt, hat der Postpositivismus eine ziemlich klare historische Bedeutung – der Begriff bezeichnet den Bruch mit bestimmten für selbstverständlich gehaltenen Annahmen über die Einheit der Natur- und Sozialwissenschaften, der sich wie so viele andere Brüche irgendwann in »den Sechzigerjahren« ereignet hat.4 Angesichts der Neigung in akademischen Kreisen, intellektuelle Dispute übermäßig zu dramatisieren, sollte es uns nicht überraschen, dass dieser Bruch vor allem in zwanglosen akademischen Unterhaltungen in vage heroischen Begriffen geschildert wird. »Positivist« wird in manchen Bereichen der Humanwissenschaften pejorativ verwendet, weil Positivist*innen die Antagonist*innen der heroischen Protagonist*innen sind, der Postpositivist*innen, die ihre Ketten gesprengt haben und dem Drachen entgegengetreten sind. In diesem Zusammenhang meint »Positivist« oder »Positivistin« eine Person, die so auf reduktionistische Quantifizierungen fixiert ist, dass sie die Realitäten des sozialen Lebens verfehlt – Bösewichte werden in der Wissenschaft immer mit Unwahrheit in Verbindung gebracht.
Aber was könnte mit Positivismus in einer allgemeineren und dennoch praktisch bedeutsamen Weise gemeint sein, wenn das Wort nicht einfach ein pejorativer Signifikant ist, der auf Arbeiten angewendet wird, denen die geheiligten Werte der Forschenden fehlen, die diesen Begriff so beiläufig verwenden? Wahrscheinlich meinen Postpositivist*innen eines von zwei Dingen, wenn sie von »Positivist*innen« sprechen. Erstens kann sich Positivismus auf eine zugrunde liegende philosophische Verpflichtung auf bestimmte Methoden zur Ermittlung sozialer Fakten beziehen – das ist deskriptiver Positivismus. Dabei lautet das positivistische Kernaxiom, dass die Sozialwissenschaften dadurch zur Wissenschaft werden, dass sie beim Umgang mit Daten bestimmte methodische Techniken verwenden, und vor allem weil Einigkeit darüber besteht, dass bestimmte Wege, um durch Quantifizierung und statistisches Schließen Verlässlichkeit und Validität zu erreichen, überlegen sind. Im Kontext der zeitgenössischen Sozialforschung hängt der unmittelbarste Einwand gegen deskriptiven Positivismus mit den Methoden zusammen, die verwendet werden, um zu exakten Beschreibungen sozialer Phänomene zu gelangen. Ist Quantifizierung und speziell die Korrelationsanalyse die richtige Methode, um zu Fakten über das soziale Leben zu gelangen? Tatsächlich ist das Argument häufig zu hören, die Sozialforschung sollte empiristisch sein, aber die Methoden, um empirische Validität zu erreichen, unterscheiden sich signifikant von denen, die in den Naturwissenschaften oder den (vielleicht irregeleiteten) quantitativen Zweigen der Sozialwissenschaften angewendet werden. Zum Beispiel könnte man die deskriptive Produktion von Wahrheit über alles andere stellen, aber darauf beharren, dass die Deskription qualitativ und einzelfallbezogen bleiben muss. Insofern geht die Tendenz der Sozialforschung zum Empirismus weit darüber hinaus, quantitative Methoden aus den Naturwissenschaften zu übernehmen.5Positivismus als methodischer Ansatz und Empirismus als Widerstand gegen Theorie sind keineswegs deckungsgleich. Empirismus kann »antipositivistisch« sein. Außerdem kann »Positivismus« sich auch darauf beziehen, Theorie als Anleitung für Forschung zu entwickeln und zu verwenden.
Die zweite Bedeutung von Positivismus bezieht sich insbesondere darauf, wie man Theorie nutzen kann, um Erklärungen zu formulieren. Hier finden wir die philosophischen Argumente der logischen Positivist*innen, die verschiedenen Versuche, ihr Covering-Law-Erklärungsmodell (die Subsumtion unter ein allgemeines Gesetz) auf die Humanwissenschaften zu übertragen, und die immer gewandteren Erben und Erbinnen des Anspruchs, eine wahrhaft universelle Wissenschaft des Sozialen zu konstruieren. Erklärung ist in dieser Sicht das logische Ergebnis der Kombination eines allgemeinen Gesetzes über das soziale Leben mit besonderen Umständen, was dem Forscher oder der Forscherin ermöglicht, das daraus resultierende Ergebnis entweder zu prognostizieren oder zu »retrodizieren« (dazu später mehr). Nach dem, was wir als theoretischen Positivismus bezeichnen könnten, erstreben wir eine soziale Physik, bei der die Theorie den Weg weist, indem sie allgemeine Gesetze des sozialen Verhaltens aufstellt.6
Ist eine soziale Physik erstrebenswert? Können wir eine erfolgreiche soziale Physik bekommen? Ob erfolgreich oder nicht, wir haben