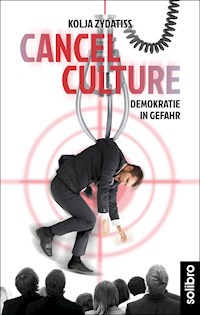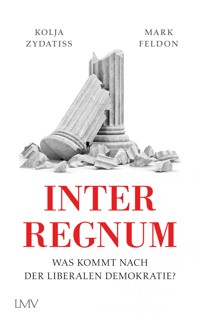
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Langen-Müller
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das liberale Zeitalter endet. Wir leben im INTERREGNUM, der Zeit zwischen zwei politischen Ordnungen. Der Optimismus, der auf den Zusammenbruch der kommunistischen Regime folgte, ist längst einem bedrückenden Gefühl des Niedergangs gewichen. Moralismus, ideologische Frontenbildung und ein aktivistischer Staat treten an die Stelle klassisch-liberaler Werte. Was auf das Interregnum folgen wird, wissen wir nicht. Aber der Blick in andere Länder und Kontinente lässt die Elemente einer neuen Ordnung erkennen: Sozialkonservatismus in Polen, "Disneyland mit Todesstrafe" in Singapur oder ein imperialistisches Russland, das im Bund mit China eine neue antiwestliche Achse bildet. Oder droht uns eine hyperliberale Postdemokratie, in der die Freiheit des Einzelnen neuartigen Staatszielen – Klimagerechtigkeit, Vielfalt, Transhumanismus – untergeordnet wird? Welche Entwicklungen können wir bereits in Deutschland betrachten?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 432
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
kolja zydatiss
mark feldon
INTERREGNUM
was kommt nach der liberalen demokratie?
Widmung
Mark Feldon widmet dieses Buch von Herzen seiner Frau Tina und seiner Tochter Kaya. Und seiner Mutter Rose. Danke!
Kolja Zydatiss widmet dieses Buch seinen Eltern und Großeltern, einfache Menschen, deren Chancen und Möglichkeiten untrennbar mit den Verdiensten der liberalen Demokratie in ihrer Blütezeit verbunden waren. Danke!
Mit dem Urteil vom 12.05.1998 hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass man durch die Ausbringung eines Links die Inhalte der gelinkten Seite gegebenenfalls mit zu verantworten hat. Dies kann, so das Landgericht, nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Wir haben in diesem E-Book Links zu anderen Seiten im World Wide Web gelegt. Für alle diese Links gilt: Wir erklären ausdrücklich, dass wir keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten haben. Deshalb distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten in diesem E-Book und machen uns diese Inhalte nicht zu Eigen. Diese Erklärung gilt für alle in diesem E-Book angezeigten Links und für alle Inhalte der Seiten, zu denen Links führen.
© 2024 LMV, ein Imprint der Langen Müller Verlag GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Sybille Schug
Umschlagmotiv: Rashevskyi Media – stock.adobe.com
Satz: Langen Müller Verlag, Ralf Paucke
E-Book Konvertierung: Satzwerk Huber, Germering
ISBN 978-3-7844-8489-1
www.langenmueller.de
Inhalt
Einleitung: Von der Utopie zum Verfall
Teil I: Aufstieg und Fall des Liberalismus
1. Was war der Liberalismus?
2. Die Geschichte liberaler Demokratien
Teil II: Regime des Hyperliberalismus
3. Vielfalts-Regime
4. Öko-Regime
5. Transhumanismus-Regime
Teil III: Antipoden des Hyperliberalismus
6. Sozial-Konservatismus
7. Der autoritäre Stadtstaat
8. Neofaschismus
9. Revolte und Resignation
Addendum: Notizen aus Nie-Wieder-Deutschland
Schlussbetrachtung: In Zeiten des Interregnums
Epilog: Das Ende liberaler Fiktionen
Literatur
Danksagung
Einleitung
Von der Utopie zum Verfall
»Wir leben in der besten aller möglichen Welten. Alles, was geschieht, ist gut.«
Gottfried Wilhelm Leibniz
Schließen wir die Augen und stellen uns das Ideal einer Liberalen Demokratie vor. Was sehen wir?
Vermutlich sehen wir eine Sammlung aufgeklärter, selbstbewusster und engagierter Bürger, die rege am politischen Leben ihres Landes teilnehmen. Dabei sind ihre individuellen Befähigungen – ihr Wissen, ihr politisches Interesse, ihre Freude am tätigen Leben des Staatsbürgers – keineswegs angeboren, sondern das Ergebnis von Erziehung, Bildung, Geschichte und dem Wirken zahlreicher regelnder und sinngebender Institutionen.
In der Familie und in den Schulen werden Prozesse und Vorzüge der Liberalen Demokratie kritisch und offen diskutiert und in Rollenspielen erprobt. Kein Kind verlässt die Schule, ohne zu wissen, wie ein Gesetz entsteht, wie Wahlen funktionieren, wofür unterschiedliche Parteien stehen und welche Rechte und Pflichten es als Staatsbürger besitzt. Dabei werden auch die Fehler und Schwächen des politischen Systems und seiner Annahmen nicht ausgespart. Man setzt auf den »eigentümlichen zwanglosen Zwang des besseren Arguments«, wie es der Soziologe Jürgen Habermas poetisch formulierte, und auf die Fähigkeit zur gesellschaftlichen Selbstkorrektur.
Man weiß um die inhärente Überzeugungskraft des politischen Systems und vertraut auf die Fähigkeit des Individuums, sich »seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen«, wie die berühmte Formulierung Immanuel Kants in dem Essay »Was ist Aufklärung« lautet. Die liberale Demokratie an sich ist resilient, sie wächst mit ihren Herausforderungen, sie ist, in den Worten des Mathematikers Nassim Nicholas Taleb, »antifragil«. Je mehr Belastung von innen und außen sie erfährt, desto stabiler wird sie. Das verleiht ihr Dauer.
In der Liberalen Demokratie herrscht ein gewisses Misstrauen gegenüber dem Staat, denn dessen zentrale Institutionen werden von Menschen geleitet, die fehlbar sind und den Versuchungen der Korruption erliegen oder die ihnen anvertraute Macht sonst wie missbrauchen können. Der Historiker und Politiker Alexis de Tocqueville beschrieb in seinen Reflexionen über die Demokratie in Amerika eine weitere Gefahr, die demokratisch verfassten Gesellschaften droht: die »Tyrannei der Mehrheit« als Preisgabe des Liberalismus auf demokratischem Weg zum Zwecke der Unterdrückung einer Minderheit. Der Bürger ist aus krummem Holz und gleichzeitig Souverän, weshalb die Institutionen der Liberalen Demokratie eines besonderen Schutzes bedürfen.
Der Staat bleibt ein biblisches Ungeheuer, ein Leviathan, auch wenn sein Körper sich – wie in der ersten Titelillustration des gleichnamigen Buches von Thomas Hobbes – aus der Gesamtheit seiner freien Staatsbürger zusammensetzt. Insofern verbietet sich blindes Vertrauen in seine Fähigkeit, größtes Übel zu verhindern – Gesellschaftsvertrag hin oder her.
Ein politischer Mechanismus namens »Gewaltenteilung« verhindert, dass der Staat sein Gewaltmonopol zu unguten Zwecken nutzt. Dank der strikten Aufteilung in Gesetzgebung, ausführende Gewalt und Rechtsprechung wird die persönliche oder institutionelle Akkumulation von Macht (und deren potenzieller Missbrauch) ausgeschlossen. In den Worten eines berühmten Vordenkers des sogenannten Klassischen Liberalismus, Baron Charles de Montesquieu: »Eine Erfahrung lehrt, dass jeder Mensch, der Macht hat, dazu neigt, sie zu missbrauchen. Deshalb ist es nötig, dass die Macht der Macht Grenzen setzt. Es gibt in jedem Staat dreierlei Vollmacht: die gesetzgebende Gewalt, die vollziehende und die richterliche. Es gibt keine Freiheit, wenn diese nicht voneinander getrennt sind.«
In der Liberalen Demokratie funktioniert die Gewaltenteilung so gut, dass sie der Bürger kaum mehr zur Kenntnis nimmt und jedes autoritär regierte Land als Abweichung von einer anthropologischen Norm sieht. Die Liberale Demokratie erscheint selbstevident, logisch, kohärent.
In der Liberalen Demokratie wird das Zusammenleben der Bürger durch Gesetze geregelt. Zwar kennt der Prozess der Gesetzgebung unterschiedliche Kompetenzen – wer ein Gesetz entwirft, wer es prüft und durch welche Verfahren es gehen muss –, letztlich ist das Gesetz jedoch nicht Ausdruck der Wünsche eines Herrschers oder von Interessen, die nicht demokratisch legitimiert sind oder sich außerhalb des Landes befinden, sondern des Souveräns, also der mündigen Staatsbürger. Eine Verfassung, die in Deutschland Grundgesetz heißt, verhindert, dass die liberale Ordnung auf rechtlichem Wege aufgehoben wird.
Der liberale Staat garantiert nicht nur physische Sicherheit und Schutz vor dem Rückfall in einen Naturzustand, in dem das menschliche Leben in den Worten des Philosophen Thomas Hobbes »einsam, abscheulich, tierisch und kurz« war, sondern auch eine Reihe von Freiheiten, die dem Individuum die Entfaltung seiner natürlichen Anlagen ermöglichen.
Ein mündiger Bürger ist ein wohl informierter Bürger, weshalb die Pressefreiheit einen besonderen Stellenwert genießt. Das schließt natürlich auch neuere Formen redaktionell bearbeiteter Medien mit ein. Nicht anders als die Parteien unterscheiden sich auch die verschiedenen Medienerzeugnisse voneinander. Wer sich am Kiosk mit fünf verschiedenen Tageszeitungen eindeckt, wird mehr als eine Sicht auf ein aktuelles Ereignis bekommen. Auch in der Gewichtung der Inhalte gleichen sich die Publikationen nicht. Das gilt auch und besonders für den mit öffentlichen Geldern finanzierten staatlichen Rundfunk. Hier bekommen die Bürger nicht nur diverse Unterhaltungsprogramme angeboten, die populäre Interessen wie kulturelle Nischen bedienen, sondern auch Nachrichtensendungen, deren inhaltliche Ausrichtung, eingeladene Gäste, Themen und Experten die Vielfalt der Gesellschaft abbilden.
Die öffentlichen Medien sind das Gegenteil der Propagandabehörden, die wir aus Geschichtsbüchern und Berichten aus unfreien Ländern wie Russland oder China kennen. In Deutschland haben sie sich sogar einen Programmauftrag erteilt, der ihre Unabhängigkeit und Integrität als Teil der Vierten Gewalt garantiert: »Auftrag der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ist, durch die Herstellung und Verbreitung ihrer Angebote als Medium und Faktor des Prozesses freier individueller und öffentlicher Meinungsbildung zu wirken und dadurch die demokratischen, sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Gesellschaft zu erfüllen.« Liberale Medien lenken nicht, sie klären auf und begleiten.
Im Unterschied zu anderen politischen Systemen benötigt die Liberale Demokratie keine verbindliche, von oben verordnete, moralische Substanz – etwa in Form einer Staatsreligion –, um Zusammenhalt zu stiften und gegensätzliche Interessen zu versöhnen. Sie kann vielmehr ihr Vertrauen darin setzen, dass die Bürger gemäß der bestehenden Gesetze und der Verfassung handeln und die prinzipielle Überlegenheit des Lebens in einer offenen Gesellschaft anerkennen. Der liberale Bürger ist ein Homo Politicus, dessen rationales Handeln und Eigeninteresse dem System als Antrieb gilt.
Für den Fall, dass die, wie Tocqueville schrieb, »besten Gesetze einer Verfassung nicht ohne Hilfe der Sitten aufrechterhalten« werden können, kann die Gesellschaft auf die Universität zählen, deren Aufgabe darin besteht, die moralische Substanz der säkularisierten Liberalen Demokratie zu bewahren, zu verfeinern und in die Öffentlichkeit zu tragen. Hier wird das eigene zivilisatorische Erbe von »tüchtige[n] und veredelte[n] menschlichen Wesen«, wie der britische Liberale John Stuart Mill sie nannte, gepflegt, gedeutet und kritisch überprüft.
Musik, Literatur, Philosophie und tausend weitere Disziplinen werden in den Seminaren offen und nach den Regeln wissenschaftlicher Lauterkeit studiert und fließen von hier zurück in die breite Gesellschaft, wo sie den Bürgern als moralischer und sinnlicher Kompass dienen. Die staatlichen Institutionen beziehen aus den Universitäten nicht nur Expertise und Anleitungen fürs politische Handeln, sondern auch einen Großteil ihres Personals. Und da beides am besten gedeiht, wenn man den Stätten höherer Bildung größtmögliche Autonomie gewährt, ist das Grundrecht der Freiheit der Wissenschaft, Forschung und Lehre dem Staat auch aus Eigeninteresse heilig.
Neben der Forschungs- und Pressefreiheit wird in der Liberalen Demokratie auch die Freiheit der Rede und der Kunst geachtet. Das deutsche Grundgesetz ist hier eindeutig:
»Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.«
Orwell‘sche Gedankenverbrechen gibt es nur in totalitären Ländern oder in Science-Fiction-Romanen, die den Bürgern der Liberalen Demokratie einen heilsamen Schrecken einjagen. Solange er nicht seine Mitmenschen bedroht oder deren Ruf nachhaltig schädigt, ist der Wissenschaftler lediglich dazu verpflichtet, der Wahrheit zu folgen, auch wenn Teile der Bevölkerung eine Verletzung ihrer privaten Glaubenssätze befürchten. Akademische Veröffentlichungen und Vorträge schließen folglich auch Spott gegenüber Gruppen, Personen der Öffentlichkeit (einschließlich Würdenträgern) und Weltanschauungen, die manchen heilig sind, ein.
Selbstverständlich können auch die Regierung und die Institutionen des Staates zur Zielscheibe für Kritik und selbst Verächtlichmachung werden. Anstatt Satiriker und Kritiker nach Art absolutistischer Monarchien einzusperren oder in die Verbannung zu schicken, lässt die Liberale Demokratie selbst diejenige Rede zu, die ihr die Legitimation abspricht, also auf ihre Fundamente zielt. Auf dem Höhepunkt des Algerienkrieges rief der linksradikale französische Autor Jean-Paul Sartre gemeinsam mit weiteren 120 Intellektuellen französische Soldaten dazu auf, den Dienst an der Waffe zu verweigern. Als der damalige Präsident Charles de Gaulle aufgefordert wurde, den Philosophen verhaften zu lassen, soll er knapp entgegnet haben: »Einen Voltaire verhaftet man nicht.«
Der Liberale Staat zieht es vor, auch in seinen radikalsten Kritikern eine Art außerparlamentarische »loyale Opposition« zu erkennen. Man wird es nie jedem recht machen können und außerdem findet das System seine treuesten und fähigsten Verteidiger in früheren Antagonisten. Wenn aus dem Christenverfolger Saulus der bedeutendste Missionar des Christentums werden konnte, dann kann ein revolutionärer Steinewerfer sich auch als liberaler Außenminister bewähren. Die Liberale Demokratie verfolgt nicht, sie überzeugt und integriert. Zensur gilt ihr als »Slippery Slope«, als abschüssiger Hang, auf dem die Freiheit in den Abgrund zu rutschen droht.
Ein weiteres Prinzip, das aus dem Misstrauen gegenüber dem Staat folgt, ist dasjenige der Subsidiarität. In der Liberalen Demokratie steht das Individuum als selbstbestimmtes und eigenverantwortliches Subjekt im Mittelpunkt. Das Subsidiaritätsprinzip, das sich aus dieser Voraussetzung ergibt, besagt, dass Probleme auf der kleinstmöglichen Ebene gelöst werden sollen. Höhere staatliche Institutionen greifen nur dann regulativ ein, wenn untergeordnete Ebenen nicht über die ausreichenden Kapazitäten – Mittel, Kenntnisse, Zeit – verfügen, um eine Aufgabe zu lösen. Auf diese Weise wird gesichert, dass der einzelne Mensch, Familien und Nachbarschaften ihr besonderes Wissen und ihre Kompetenzen einbringen können, und der Staat nicht autoritär jede Eigeninitiative erstickt. Außerdem sind die Interventionen des Staates oftmals zu grob und die Partizipation der Bürger – ihr tätiges Leben – die Bedingung für Solidarität und soziales Vertrauen.
Eine Gesellschaft, in der das Subsidiaritätsprinzip entwickelt ist, ist auch eine, in der zahllose Bürger sich in ihrer Freizeit in Vereinen, Parteien, Initiativen und sozialen Bewegungen engagieren. In der Liberalen Demokratie herrscht eine Trennung zwischen der Zivilgesellschaft, die manchmal auch Fünfte Gewalt oder Bürgergesellschaft genannt wird, und dem Staat. Alles andere würde dem Auftrag dieser besonderen Gesellschaftsform zuwiderlaufen: die freie Assoziation von Bürgern zur Unterstützung gemeinschaftlicher Anliegen.
Der aktive Bürger übernimmt öffentliche Verantwortung und erfüllt wichtige Aufgaben in kulturellen, sozialen oder kirchlichen Bereichen. Sein ehrenamtliches Engagement kann nur dann dazu beitragen, eine Kultur des Liberalismus zu fördern, wenn der Staat sich damit begnügt, Impulse aufzunehmen. Damit die Zivilgesellschaft ihre Rolle als Korrektiv erfüllen kann und nicht zum bloßen Handlanger wird, darf der Staat keinesfalls bevormundend eingreifen oder bestimmte Bereiche und politische Ausrichtungen favorisieren.
Freiheiten markieren nicht nur den ethischen Kern der Liberalen Demokratie, sondern sind auch der Grund für ihre Prosperität und ihr großes Maß an Gleichheit. Während in den Ländern des sogenannten Globalen Südens die räumliche, ethnische oder politische Nähe zur Herrschaft darüber entscheidet, wer mit Posten, Geld, Einfluss, Sicherheit oder Würden versorgt wird, ist der ökonomische Aufstieg in der Liberalen Demokratie vor allem eine Funktion der individuellen Talente ihrer Bürger. Der vom deutschen Soziologen Ulrich Beck beschriebene Fahrstuhleffekt sorgt für ein hohes Maß an sozialer Mobilität und verhindert die Herausbildung einer homogenen Funktionselite nach Art des mittelalterlichen Adels, die das Land unweigerlich auf den Pfad des Ressentiments und der Dekadenz führt.
In der Liberalen Demokratie gelten die individuellen Freiheiten – der Rede, der Kunst, der Forschung – als Produktivkräfte, die ein System ermöglichen, das zugleich technologische Innovationen, freie Initiative, Vollbeschäftigung, Aufstiegschancen und folglich Harmonie begünstigt. Man hat dieses Modell auf die Namen Rheinischer Kapitalismus, Soziale Marktwirtschaft und, seitdem das Bewusstsein für ökologische Externalitäten auch zum Management durchgedrungen ist, sozialökologische Marktwirtschaft getauft. In ihr nehmen sämtliche gesellschaftlichen Akteure – Kirchen, Interessenverbände, Unternehmer, Lieferanten und Kunden – aktiv am wirtschaftlichen Prozess teil. Die Liberale Demokratie ist eine Meritokratie, die von einem Sozialstaat ummantelt ist.
»Der Bogen des moralischen Universums ist lang, aber er neigt sich der Gerechtigkeit zu.« Mit diesem Satz brachte der Baptistenpastor und Menschenrechtler Martin Luther King sein Grundvertrauen in die amerikanische Republik auf den Punkt. Dabei könnte es sich ebenso um ein Dogma der Liberalen Demokratie handeln: Die Welt bewegt sich aus einem Zustand der Partikularismen und der Unordnung in einen des Universalismus und der Freiheit. Dabei dient der wirtschaftliche Aufstieg als Katalysator der Liberalisierung. Mit dem Reichtum der Nationen nimmt auch ihr Liberalismus zu. Versuche, eine prosperierende Wirtschaft mit einer präliberalen Politik zu erzielen, können höchstens kurz- und mittelfristig funktionieren. Letztendlich können nur die Produktivkräfte der Freiheit die nötigen Innovationen und den sozialen Ausgleich schaffen, der für dauerhaften Wohlstand benötigt wird. Der Telos der Liberalen Demokratie ist auf Befreiung gerichtet.
Verfallsgeschichte
„Wenn das die beste aller Welten ist, wie mögen dann erst die anderen aussehen.“
Voltaire
»Echter Kommunismus wurde noch nie versucht.« Was heute als Spott über die Umsetzbarkeit linker Gesellschaftsmodelle daherkommt, war einst der ernstgemeinte Versuch, elaborierte Theorien nicht in den Dunstkreis ihrer tatsächlichen Folgen zu lassen. Mit einigem Erfolg, möchte man sagen, denn utopische Pläne dominieren den politischen Diskurs des Westens wie seit Langem nicht mehr.
Die von uns skizzierte Liberale Demokratie mit großem »L« hat es natürlich historisch ebenso wenig gegeben wie den »Verein freier Menschen«, die »Assoziation freier Produzenten« oder sonst eine Gesellschaft der »Freien und Gleichen«. Doch anders als die Utopien, die im 19. Jahrhundert erdacht wurden und wenige Jahrzehnte später blutig scheiterten, konnte sich die realexistierende liberale Demokratie als Gesellschaftsmodell präsentieren, das sich im Laufe von Jahrhunderten bewährte, sich stetig verbesserte und sich im Kampf der Systeme schließlich als vermeintlicher Endzweck der Geschichte, als Telos, offenbarte. Die Liberale Demokratie und nicht der Kommunismus galt in den postsowjetischen Jahren, nach einer weiteren berühmten Formulierung von Karl Marx, als das »aufgelöste Rätsel der Geschichte«.
Die realexistierende liberale Demokratie konnte sich durchaus in ihrer bloßen Form wiedererkennen. Das Leben in liberalen Staaten war zweifellos freier, gerechter, sicherer und wohlhabender als im Rest der Welt, und es gab gute Gründe anzunehmen, dass die bestehenden Diskrepanzen zwischen Idee und Realität immer weiter abnehmen würden. Nicht zuletzt die Klasse der Intellektuellen sollte mit ihrer oftmals schneidenden Kritik dazu beitragen, die Kluft zwischen Sein und Sollen zu überwinden. Noch die größte Empörung über Ungerechtigkeiten in den liberalen Nationen diente insofern nicht der »Überwindung« der liberalen Demokratie, sondern der inhärenten Kritik und der Annäherung an ihre Idee. Die zahlreichen Karrieren ehemaliger Linksradikaler in den kulturellen, sozialen und politischen Eliteinstitutionen bezeugen das überdeutlich.
Die Liberale Demokratie ist der Sinn ihrer realexistierenden Erscheinung. So wie die Sowjetunion nicht nur an minderwertigen Konsumgütern und einem unvernünftigen Wehretat zugrunde ging, sondern ebenso am Zynismus der Sowjetbürger (»Sie tun so, als würden sie uns bezahlen, und wir tun so, als würden wir arbeiten.«), so setzt der Bestand der liberalen Demokratie ebenso den Glauben in die eigenen Erzählungen voraus wie die Fähigkeit, ausreichend liberal denkende Bürger hervorzubringen – trotz der, in den Worten Arnold Gehlens, »Pluralität von Interessen, moralischen und wertorientierten Überzeugungen und der daraus sich ergebenden Unvermeidbarkeit machtgestützter politischer Auseinandersetzungen«.
Ob das gelingen wird, ist keine akademische, sondern eine höchst praktische Frage. Benötigt die liberale Demokratie ein normatives Fundament, eine »Leitkultur«? Kann sie in Zeiten abnehmenden Wohlstands bestehen? Setzt sie eine bestimmte liberale Mentalität voraus, die eine Bevölkerung durch einen langwierigen Prozess der »Psychogenese«, wie es der Soziologe Norbert Elias ausdrückte, erwirbt? Nähern wir uns dem Ideal der Liberalen Demokratie an, oder entfernen wir uns von ihm? Hat sie überhaupt eine Zukunft? Falls nicht, was könnte auf sie folgen? All das sind Fragen, die, so glauben wir, in Kürze beantwortet werden.
Es dürfte den Leser kaum überraschen, dass wir zum Zeitpunkt der Niederschrift, also im Herbst 2023, wenig Grund zum Optimismus sehen. Und mit dieser Sicht sind wir nicht allein. Ein paar rezente Beispiele: Ein »Exzellenzcluster« an der Freien Universität Berlin erforscht, ob das »liberale Skript« noch zu retten ist (wobei die Degradierung eines politischen Modells, das sich als Erbe der Aufklärung versteht, zum »Skript« die Antwort bereits preisgibt). Die Heinrich-Böll-Stiftung organisiert eine Konferenz mit dem Titel »Wettbewerb der Systeme: Zur globalen Krise liberaler Erzählungen«, die Jahreskonferenz des Forschungsinstituts Gesellschaftlicher Zusammenhalt treibt die Frage um, wie das Land durch die »epochale Krise« steuern wird und die Akademie für Politische Bildung Tutzing lädt zur Tagung »Demokratie auf dem Prüfstand« (kein Fragezeichen).
Nicht anders sieht es auf dem Buchmarkt und in den Medien aus. Zeitungsessays und Bücher sonder Zahl behandeln die Krise des Kapitalismus, der Repräsentation, der Demokratie, des Westens, mal im kulturpessimistischen Jargon (Alain des Benoist), mal als Weckruf (Timothy Snyder, Francis Fukuyama), mal als Abgesang (Houellebecq). Postliberale Autoren wie Patrick Deneen, David Goodhart, Rod Dreher oder Mary Harrington haben nicht nur einen wachsenden Einfluss auf amerikanische und britische konservative und rechte Parteien, Thinktanks und politisch-religiöse Gruppen, ihre Ideen werden auch in deutschen Redaktionen, Sozialen Medien und Kommentarspalten diskutiert. Man findet verwandte Gedanken auch in den Schriften des Medienwissenschaftlers Norbert Bolz, des Philosophen Alexander Grau, in den Büchern der Ethnologin Susanne Schröter oder des ehemaligen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts Hans-Jürgen Papier, die das Vertrauen in Institutionen, den gesellschaftlichen Zusammenhalt oder den Rechtsstaat als fundamental bedroht sehen.
Auch zahlreiche empirische Untersuchungen legen den Schluss nahe, dass sich der Bogen des moralischen Universums nicht zur Gerechtigkeit, sondern zur Unordnung neigt. Laut einer aktuellen Forsa-Umfrage vertrauen nur noch rund 30 Prozent der Befragten dem Bundeskanzler und der Bundesregierung. Auch Bundestag, Bundespräsident und Bürgermeister verzeichnen im Vergleich zu 2022 Einbußen an Vertrauen von über 10 Prozent. Das Vertrauen in die Europäische Union (31 Prozent) und Parteien (17 Prozent) ist ebenfalls extrem gesunken. Eine weitere repräsentative Umfrage von Infratest kommt zum Ergebnis, dass das Vertrauen in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk seit 2019 kontinuierlich abgenommen hat. 21 Prozent stimmen der Aussage zu, die Medien würden »mit der Politik Hand in Hand« arbeiten »um die Meinung der Bevölkerung zu manipulieren«.
Laut einer Umfrage der Friedrich-Ebert-Stiftung vertraut nur noch eine Minderheit der Befragten (48,7 Prozent) der Demokratie, und dem Freiheitsindex 2022 des Allensbach-Instituts ist zu entnehmen, dass weniger als die Hälfte der Befragten (48 Prozent) findet, dass sie ihre Meinung frei äußern kann. Aus einer Allensbach-Untersuchung von 2020 erfährt man, dass für 25 Prozent der Hochschullehrer »Gendersprache« Pflicht und die »Leugnung des Klimawandels« verboten sein sollte. Eine Untersuchung der Otto-Brenner-Stiftung in Bezug auf die mediale Behandlung der Migrationskrise von 2015 kommt zum Schluss, dass »große Teile der Journalisten ihre Berufsrolle verkannt und die aufklärerische Funktion ihrer Medien vernachlässigt haben«. Zum Zeitpunkt der Niederschrift ist die einzige signifikante Partei mit dezidiert illiberalem Programm, die Alternative für Deutschland, zur zweitstärksten Partei Deutschlands aufgestiegen.
Schließlich gingen in die folgenden Zeilen auch die persönliche Erfahrung von uns Autoren, der Austausch mit Personen aus Politik, Kultur und sozialen Bereichen, Jahrzehnte des politischen Engagements in Gruppierungen, die mit fortschreitendem Alter immer weniger links wurden, die Lektüre von Büchern, Zeitschriften und Blogs kluger Zeitgenossen und endlose Debatten in Berliner Kneipen mit ein. Debatten über eine progressive Kulturrevolution, die sich durch moralische Erpressung, aggressive Rhetorik und Marketing-Psychologie die Institutionen des Westens Untertan macht.
Parawissenschaften wie antirassistische Mathematik und Medizin, postkoloniale Geschichte, queere Philosophie, feministische Geographie, antikapitalistische Klimawissenschaften, kritische Rechtswissenschaften (an dem Zusatz »critical« sollt ihr sie erkennen!) haben längst ihren Weg von den linken WG-Küchen und alternativen Kulturzentren in die Seminare der Eliteuniversitäten und von dort in die Ministerien, Behörden und Stiftungen gefunden. Die beschwichtigende Formel »Was an der Uni geschieht, bleibt an der Uni« war bereits falsch, als ein wohlmeinender Liberaler sie das erste Mal aussprach.
Was noch? Die Verelendung unserer Großstädte und der ehemals prosperierenden Industrieregionen. Die Massenmigration aus Ländern, in denen Säkularismus und Liberalismus als Sünde betrachtet werden, in denen man den Starken bewundert und Selbstkritik als Schwäche verachtet, in einen Sozialstaat, der ebenso beständig wächst wie der Mangel an Wohnraum, Kitas, Schulen und Krankenbetten. Worte wie »Assimilation« oder »Leitkultur« fallen seit Jahren nicht mehr, selbst Integration wird als bevormundend bis rassistisch diffamiert und der Westen gerät immer mehr in den Ruf, ein Synonym für die Herrschaft des alten, weißen Mannes zu sein.
Nicht zu vergessen die massiven Eingriffe in die Freiheitsrechte der Bürger zur Zeit der Pandemie. Die öffentliche Anprangerung von dissidenten Laien und Experten durch Medien, Wissenschaftler und Politiker, deren Verlautbarungen zur Unbedenklichkeit von Impfstoffen (Karl Lauterbach: »nebenwirkungsfrei«), zur Genese und Gefährlichkeit des Virus, zur Wirksamkeit von Lockdowns und sozialer Isolation sich teils als strittig, teils als falsch erwiesen haben, werden die an den Pranger Gestellten vermutlich so bald nicht vergessen. Sie haben einen Staat kennengelernt, dem der Bürger zum potenziellen »Krankheitsvektor« wurde und der soziale Missstände durch steuerfinanzierte Schenkungen zu mildern versuchte, während Kinder in die Depression stürzten und Eltern ihre Existenz verloren. Manchen war der »Ungeimpfte« mehr verhasst als das Virus.
Die vermeintlichen Experten folgen dabei einem Skript, das bereits Bundeskanzlerin Angela Merkel erfolgreich durch die Migrationskrise brachte – von »wir schaffen das!« zu »jetzt sind sie halt da« –, weshalb weder Aufarbeitung noch personelle Folgen zu erwarten sind. Zu diesem Skript gehört auch die Abwertung von Staatsbürgern zu Menschen-die-schon-länger-hier-leben, die aggressive Propagierung einer linken Queer-Ideologie – eines fahnenschwenkenden und dauerparadierenden »übertragenen Nationalismus« in den Worten George Orwells – durch Staat und internationale Unternehmen.
Dazu gehört weiterhin das wuchernde Geflecht von Nichtregierungsorganisationen, die durch Gefälligkeitsstudien und Kampagnen eine Kreislaufwirtschaft mit dem Staat bilden, der machtpolitische, steuerfinanzierte »Kampf gegen rechts«, der immer mehr zu einer Mobilmachung gegen alles Nicht-Linke mutiert, die Einrichtung von sogenannten »Meldeportalen« zur Denunziation von Abweichlern, und die an einen Polizeistaat gemahnende Ächtung von Kritik als »Delegitimierung des Staates«.
Schließlich beinhaltet das Skript die Implementierung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes, das selbst Zensurforderungen aus China und dem Iran umsetzt, und die arrogante Zurechtweisung osteuropäischer Länder, während die absolutistisch agierende Kanzlerin per Machtwort eine demokratische Wahl annulliert. Das Ergebnis ist eine Republik, die nicht zur Ruhe kommt, der eine Wende (Energie, Verkehr, Heizung, Ernährung …) nach der nächsten verordnet wird, während die Bürger sich auf ein Leben des Mangels und der Unsicherheit in Vierteln, die ihnen fremd geworden sind, einstellen.
Wer möchte leugnen, dass die liberale Demokratie ein miserables Bild abgibt? Braucht es noch die von Walter Russell Mead beschriebene »Rückkehr der Geopolitik«, das Entstehen der antiwestlichen Achse Russland-China-Iran und den Export ihrer revanchistisch-imperialistischen, totalitär-technokratischen und radikalislamischen Weltanschauungen mittels Agenturen, die sich längst diesseits der sprichwörtlichen Tore befinden?
Während sich die Debatte um das mögliche Ende der liberalen Demokratie und den möglichen Beginn einer neuen Ordnung in Deutschland noch in ihrer akademischen und abstrakten Phase befindet, ist der Postliberalismus als Analyse, Kritik und politisches Programm in anderen Ländern längst praktisch geworden. Dies trifft vor allem auf Nationen zu, die auf die älteste liberale Tradition zurückblicken und in denen populistische Bewegungen politische Erfolge erzielten – etwa die Wahlsiege Donald Trumps und der niederländischen Bauern-Bürger-Bewegung, Brexit, Proteste gegen die Fragmentierung in Frankreich oder auch der Aufstieg rechtskonservativer und migrationskritischer Parteien in Schweden und Dänemark. Die Krise der liberalen Demokratien ist eine Krise des Westens. Kein Land bleibt verschont, nirgends ist eine Renaissance von Rechtsstaatlichkeit, Freiheit, Wohlstand und Sicherheit in Sicht. Wie man sich bettet, so liegt man.
Interregnum
»Nur wer sorglos in die Zukunft blicken konnte, genoß mit gutem Gefühl die Gegenwart.«
Stefan Zweig
Der lateinische Begriff des Interregnums hat in den letzten Jahren eine erstaunliche Karriere gemacht. Als Bezeichnung der Übergangszeit zwischen zwei Herrschaftssystemen war er zunächst vor allem unter Mediävisten, Sinologen und Historikern, die sich für das römische Kaiserreich und dessen Zerfallsprodukte interessierten, im Gebrauch. Das Wort wird heute vor allem in einer angepassten modernen Bedeutung verwendet, was auf den Mitgründer der Kommunistischen Partei Italiens (PCI), Antonio Gramsci, zurückzuführen ist.
Ein berühmter Satz, den dieser 1930 in seine Gefängnishefte notierte, lautet:
»Die Krise besteht genau daran, dass das Alte stirbt und das Neue nicht zur Welt kommen kann; in diesem Interregnum erscheinen eine ganze Reihe von morbiden Erscheinungen.«
In der Übersetzung des slowenischen marxistischen Philosophen Slavoj Žižek:
»Die alte Welt liegt im Sterben, die neue ist noch nicht geboren. Es ist die Zeit der Monster.«
Als Gramsci diese Zeilen zu Papier brachte, war die Welt, die er kannte, längst Geschichte und die versprochene neue wollte sich nicht materialisieren. Selbst die Partei, diese ideelle Ersatzwelt der kommunistischen Ideologen und Straßenkämpfer, war ihm keine echte Heimat mehr.
Nach der sogenannten »Dritten Periode« der Dritten Internationale durch den Genossen Stalin stramm auf Sowjetlinie gebracht, begann seine PCI die gleichen weltanschaulichen Dogmen wie ihre Schwesterorganisationen in Frankreich, Deutschland und anderswo zu predigen: Die Zeit ist reif für die Revolution, der Hauptfeind ist die Sozialdemokratie, allein der Wille des Parteimenschen zählt.
»Morbide Erscheinungen« gab es also nicht nur im vom Mussolini regierten korporatistischen Italien, sondern auch in der »Bewegung«, von der man sich versprach, die Geburtshelferin einer neuen Gesellschaft zu sein.
Die »Welt von Gestern«, wie sie der brillante Stefan Zweig nannte, gab es nicht mehr. In Italien saß die Partito Nazionale Fascista, angeführt von einem ehemaligen Chefredakteur des Zentralorgans der Sozialistischen Partei, fest im Sattel. 1929 stürzte der Wall Street Crash die Weltwirtschaft in die Große Depression, die bis dato tiefste Krise des Kapitalismus. Und während die Großen Ebenen Nordamerikas von Dürren und Staubstürmen heimgesucht wurden, tobte in den Städten Europas der Enzensberger‘sche »molekulare Bürgerkrieg«: Akte der Inzivilität, politische Morde, Ausschreitungen, kurzlebige Regierungen, Repression, Zensur.
Der offiziellen Komintern-Position, wonach die proletarische Revolution kurz bevorstehe, konnte Gramsci wenig abgewinnen. Gleichzeitig konstatierte er, das kapitalistische System hätte die Unterstützung der breiten Masse verloren. Die bestehende Herrschaft sei keine »of the people, by the people, for the people«, wie es Abraham Lincoln in seiner berühmten Gettysburg-Rede formuliert hatte, sondern eine vom Volk entfremdete. Sie führe nicht, sondern dominiere. Sie befinde sich in einer fundamentalen »Krise der Autorität«. Da keine gegen die Bourgeoisie gerichtete Massenbewegung zur Stelle sei, verharre Italien im Interregnum, der Zeit der »morbiden Erscheinungen«.
Von Gramsci haben wir den Begriff des »Interregnums«, jedoch nicht seinen unverbrüchlichen Optimismus. Es fehlt uns die Phantasie und die dem Parteikader eigentümliche Zuversicht, dass die Zeit der Monster immer auch »günstige Bedingungen« für eine bessere Welt schafft. Im vorliegenden Buch beschränken wir uns darauf, die Morbiditäten, derer Deutschland und der Westen so reich ist, und die augenscheinliche Krise der Autorität unserer Eliten zu beschreiben. Eine Krise, deren autoritäre Bewältigung eine morbide Erscheinung auf die nächste folgen lässt.
War das Interregnum in der Römischen Republik ein rechtlich kodifizierter Vorgang, bei dem ein vom Senat bestimmter Interrex, also Zwischenkönig, in Krisenzeiten die Konsulwahl organisierte, besitzen wir weder Mechanismus noch Institutionen für den Übergang eines politisch-sozialen Systems in ein anderes. Deshalb wird die große Transformation, so vermuten wir, ein chaotischer und folglich offener Prozess sein.
Der Mensch der liberalen Demokratie kennt bekanntlich keine Zukunft mehr. Dass das Ende der Geschichte zu Ende gehen könnte, kann er sich nicht vorstellen, nur die Expansion und Vertiefung des Bekannten. Und unsere Institutionen verfolgen nur noch den Zweck, die Verwalter des Interregnums an der Macht zu halten und sie von den Folgen ihres Tuns abzuschirmen. Wir marschieren auf unbekanntem Terrain, hinein in ein Gebiet, vor dem mittelalterliche Karten warnten: Hic sunt dracones. Hier sind Drachen.
Antonio Gramsci starb sechs Tage nach seiner Freilassung in einem römischen Krankenhaus. Stefan Zweig und seine Frau Lotte nahmen sich 1942 in der Nähe Rio de Janeiros das Leben.
Vorschau
In den folgenden zwei Kapiteln werden wir zunächst auf die Geschichte des Liberalismus eingehen. Dabei stellen wir zentrale Protagonisten und deren intellektuelle Beiträge ebenso dar wie relevante historische Ereignisse und Entwicklungen. Die Darstellung kulminiert in einer kurzen Darstellung der Hochphase des Liberalismus in Westeuropa und dem anschließenden Heraufziehen einer Dauerkrise, die lediglich vom kurzen postsowjetischen Siegesrausch übertönt wurde. Es versteht sich von selbst, dass ein Buch dieses Umfangs keine umfassende Auseinandersetzung mit dem historischen Liberalismus, der sich über Jahrhunderte entwickelte, anpasste und neu erfand, leisten kann.
Im Hauptteil beschreiben wir unterschiedliche Regime, die, so erscheint es uns, Teil einer künftigen Ordnung werden könnten. Wir schildern diese zunächst in ihrer fortgeschrittensten Gestalt und ihren bereits beobachtbaren Folgen und gehen dann der Frage nach, inwieweit sie bereits in Deutschland Einzug gehalten haben. Anschließend behandeln wir aktuelle Bewegungen von rechts wie von links, die sich als Alternativen zur spätliberalen Ordnung begreifen, und ein Konzept der inneren Emigration, das der Autor Rod Dreher die »Benedikt-Option« nennt.
Im Schlusswort gehen wir auf die Möglichkeit einer Renaissance der liberalen Demokratie ein. Unter anderem beschäftigen wir uns hier mit dem Versuch westlicher Nationen, eine neue, durch gemeinsame Werte bestimmte Allianz gegen die revanchistischen Mächte China und Russland zu schmieden.
Das Buch endet mit einer Liste verwendeter Literatur, die auch als Anregung für eine weitere Lektüre genutzt werden kann.
Teil I: Aufstieg und Fall des Liberalismus
Die folgenden zwei Kapitel beruhen auf der Annahme, dass Entwicklungen in den fortgeschrittensten liberalen Nationen der englischsprachigen Welt – allen voran den Vereinigten Staaten, aber auch Kanada und Großbritannien – ihren Weg mit leichter Verzögerung auch zu uns finden. Das liegt nicht zuletzt daran, dass die Produktion und Transmission hyper-liberaler (oder woker) Ideen vor allem durch Soziale Medien, Großkonzerne, NGOs, Stiftungen, Kulturindustrie und Universitäten erfolgt, also Institutionen, die vor allem im anglophonen Markt agieren und seiner Kultur entspringen.
In welchem Maße gesellschaftliche Prozesse von Diskursen aus Amerika und Großbritannien beeinflusst sind, erkennt man zum Beispiel überdeutlich an der nahtlosen Übertragung von Begriffen (Whiteness), Parolen (Black Lives Matter), Forderungen (Decolonize) und Theorien (Critical Race Theory) aus dem Kontext amerikanischer Rassenbeziehungen oder der Kolonialgeschichte Großbritanniens auf Deutschland. Dass diese intellektuellen Importe bereits in ihren Ursprungsländern augenscheinlich dazu beigetragen haben, bestehende Spannungen zu verschärfen und potenziell unlösbar zu machen, hindert progressive Aktivisten nicht daran, sie hierzulande zu implementieren. Warum auch, ihr destruktives Potenzial macht sie schließlich so attraktiv.
1. Was war der Liberalismus?
»Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf.«
»Der Mensch ist dem Menschen ein Gott.«
Thomas Hobbes
Das Dilemma historischer Abhandlungen über den Liberalismus: Wo beginnen? Beim Menschen selbst und seinem angeborenen, ihn von anderen Primaten unterscheidenden Sinn für Gerechtigkeit? Bei den freien Staatsbürgern der Römischen Republik, den Schriften Ciceros und der Etymologie des lateinischen Wortes »liber«, wie es die Historikerin Helena Rosenblatt in »The lost History of Liberalism« tut? Im frühen Christentum vielleicht? Für den Historiker Tom Holland, der von sich behauptet, den Glauben in den Liberalismus verloren zu haben, sind das gesamte »liberale Projekt« und seine grundlegenden Werte – Säkularismus, Universalismus, Fortschrittsglaube, Rationalismus, Toleranz – eine Folge des Wirkens Jesu, Paulus‘ und späterer christlicher Theologen.
Der Evolutionsbiologe Joseph Henrich sieht im Christentum und seinen mittelalterlichen sozialen Geboten und Tabus – Monogamie, Kleinfamilie, Inzestverbot – den Grund für die Entstehung eines psychologischen Menschentypus, der nicht nur besonders kreativ, unternehmerisch und belesen ist, sondern auch auf einzigartige Weise liberal. Auch die Verabschiedung der Magna Carta, die die Macht des englischen Königs begrenzte, oder die kirchliche Reformation des 16. Jahrhunderts und die anschließende Schwemme evangelischer Bewegungen werden von Historikern als wichtige Etappen in der Geschichte des Liberalismus angesehen.
Der Beginn
Die meisten zeitgenössischen Darstellungen lassen ihn jedoch mit den Schriften eines englischen Mathematikers und Philosophen beginnen, der sich für den absolutistischen Staat einsetzte – so ziemlich das Gegenteil einer liberalen Gesellschaft. Der englische Philosoph und Mathematiker Thomas Hobbes (1588–1679) ist heute vor allem für einen Ausspruch bekannt, der leider nur in seiner stark verkürzten Fassung bekannt ist. Das berühmte Zitat über den menschlichen Wolf lautet aber in seiner Gänze:
»Es besteht kein Zweifel, dass beide Formeln wahr sind: der Mensch ist dem Menschen ein Gott und der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Die erste, wenn wir die Bürger untereinander vergleichen, die zweite, wenn wir die Staaten untereinander vergleichen. Hier erreicht der Mensch durch Gerechtigkeit und Nächstenliebe, die Tugenden des Friedens sind, Gott ähnlich zu werden. Dort müssen selbst die guten Menschen wegen der Verderbtheit der Bösen, wenn sie sich schützen wollen, auf die kriegerischen Tugenden Kraft und List zurückgreifen, d. h. auf die Raubgier der Tiere.«
Der Mensch ist zu Mord und Totschlag ebenso fähig wie zu einem Handeln nach den höchsten Idealen christlicher Moral. In seiner Autobiografie machte Hobbes gar den Angriff der Spanischen Armada auf sein Heimatland für seine Frühgeburt verantwortlich: »[Meine Mutter] brachte Zwillinge zur Welt: mich und die Furcht.« Dass Hobbes Zeuge des englischen Bürgerkrieges (1642–1649) wurde, trug nicht gerade dazu bei, diese Furcht zu mindern. Im Gegenteil, sie wurde zu einem bestimmenden Motiv seiner Theorie des Staatsvertrages.
Noch über dreihundert Jahre später begründete die Politikwissenschaftlerin Judith Shklar (1928–1992) ihren »Liberalismus der Furcht« als ein politisches Programm, das nicht Vernunft, Autonomie, Glück oder Selbstverwirklichung zum Ausgangspunkt hat, sondern Grausamkeit und die Verletzbarkeit der Menschen. Das war ein minimalistischer und negativer Liberalismus, ein nicht utopisches Programm, das wenig von dem Pathos sozialer Gerechtigkeit in den Schriften John Stuart Mills (1806–1873) oder John Rawls (1921–2002) hatte.
Hobbes‘ Leviathan war das erste Buch, das eindeutig liberale politische Ideen enthielt. In ihm erscheinen die Mitglieder eines politischen Gemeinwesens als gleiche Individuen, die von Geburt an mit bestimmten Rechten – Naturrechten – ausgestattet sind. Angesichts der Knappheit von Ressourcen sollen sich die Menschen zunächst in einem Zustand permanenter Konkurrenz befinden, der notwendig in Gewalt ausarten muss. Es ist eine bedrohliche Freiheit, die sie hier genießen. Das Menschenbild Hobbes‘ setzt nicht beim immer schon politischen Subjekt der Antike an, sondern beim vorpolitischen (fiktiven) Naturzustand, in dem das Leben »einsam, arm, gemein, roh und kurz« ist. Um dem zu entkommen und ihre Interessen verteidigen zu können, gehen die »Mängelwesen« (Arnold Gehlen) einen Vertrag mit einem absoluten Herrscher ein, der ihnen Sicherheit um den Preis unbedingten Gehorsams bietet. Dieser Leviathan, den Hobbes auch einen »sterblichen Gott« nennt, wacht darüber, dass die Freiheiten der Subjekte nicht durch einen Rückfall in den Naturzustand bedroht werden. Sollte dies jedoch geschehen, sind die Subjekte jeder Verpflichtung dem Souverän gegenüber entbunden.
Die Staatstheorien von John Locke (1632–1704), einem Zeitgenossen und Landsmann von Hobbes, setzen ebenfalls einen Naturzustand voraus, der aber weniger von Grausamkeit geprägt ist und in dem Menschen ein natürliches Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit besitzen. Für Locke, der sein Menschenbild aus dem Studium der Bibel entwickelte, sind Staaten ebenfalls das Ergebnis eines Abkommens freier Vertragspartner. An deren Spitze soll jedoch kein absoluter Herrscher stehen, sondern eine durch eine Verfassung begrenzte Regierung, die ihre Legitimität aus der Fähigkeit zieht, die Naturrechte der Bürger zu schützen. Scheitert sie hierin, haben die Untertanen das Recht, gegen sie zu rebellieren und sie durch eine andere zu ersetzen.
In der einflussreichen Schrift, in der er diese Gedanken entfaltete, den »Zwei Abhandlungen über die Regierung«, nennt Locke eine weitere Bedingung einer »wohlgeordneten Regierung«: die Gewaltenteilung. Sie beruht auf der Vorstellung menschlicher und staatlicher Fehlbarkeit und einem hieraus resultierenden Misstrauen:
»Bei der Schwäche der menschlichen Natur, die stets bereit ist, nach der Macht zu greifen, würde es jedoch eine zu große Versuchung sein, wenn dieselben Personen, die die Macht haben, Gesetze zu geben, auch noch die Macht in die Hände bekämen, diese Gesetze zu vollstrecken. Dadurch könnten sie sich selbst von dem Gehorsam gegen die Gesetze, die sie geben, ausschließen und das Gesetz in seiner Gestaltung wie auch in seiner Vollstreckung ihrem eigenen persönlichen Vorteil anpassen.«
Es waren Ideen, die inhaltlich und rhetorisch einen maßgeblichen Einfluss auf die Glorious Revolution in England 1688/89 und den englischen Parlamentarismus, die amerikanische Unabhängigkeitserklärung und später die Verfassungen westlicher Nationen besaßen.
Im niederländischen Exil verfasste Locke zuvor seinen »Brief über die Toleranz«, in dem er diese als eine christliche Tugend begründete, in die sich der Staat, der mit weltlichen Dingen zu tun hat, nicht einmischen darf. Die Rettung der Seele fällt nicht in die Zuständigkeit einer nationalen Kirche, da Seelenheil ausschließlich eine Sache des persönlichen Glaubens sein kann. Religionsfreiheit soll jedoch weder für Katholiken, die bereits einer anderen Herrschaft ihre Loyalität erklärt haben, noch für Atheisten, denen aufgrund ihrer Gewissenslosigkeit ohnehin nicht über den Weg zu trauen ist, gelten.
Bedeutungswandel
Bis Hobbes und Locke ihre einflussreichen Schriften veröffentlichen konnten, mussten einige historische Brüche vollzogen werden und der Begriff »liberal« seine frühere Bedeutung ablegen und von einem Kanon an Werten und Haltungen zu einem politischen System werden. Nahezu zwei Jahrtausende lang, so die Historikerin Helena Rosenblatt, war derjenige liberal, der gemäß den Tugenden eines Staatsbürgers handelte, sich für das Gemeinwohl einsetzte und sich seinen Mitbürgern gegenüber selbstlos verhielt. In der Römischen Republik bedeutete dies, weder der Willkür eines Herrschers noch der Kontrolle eines anderen Bürgers unterworfen zu sein, was für vollwertige römische Bürger nur unter dem Schutz der Gesetze und der Verfassung Roms als möglich galt.
So schrieb Cicero in seinem späten Werk in »Vom pflichtgemäßen Handeln«, die Menschen würden »nicht allein für sie selbst geboren«, sondern auch, um durch gute Taten, Mühe und Güter den gesellschaftlichen Bund zu stärken. Liberale Bildung und Erziehung sollte folglich den Heranwachsenden mit den Tugenden, Pflichten und Traditionen eines vorbildlichen Staatsbürgers vertraut machen. Liberalität war eine Sache des Bürgers, nicht des Staates.
Auch nach dem Ende der Römischen Republik und der aus ihrer Konkursmasse gebildeten Reiche verstand man unter Liberalität das tugend- und ehrenhafte Verhalten der Staatsbürger. Gleichzeitig wurde der Begriff immer stärker mit christlichen Werten aufgeladen. Der römische Philosoph Macrobius Ambrosius Theodosius (ca. 385–430) beschrieb in einer Abhandlung, die auf Ciceros »Vom pflichtgemäßen Handeln« beruhte, den Wert von Güte, Gerechtigkeit und Wohlwollen für eine prosperierende Gemeinschaft. Mittelalterliche Lexika beschrieben Liberalität als Eigenschaft von offenherzigen, selbstlosen und hilfsbereiten Menschen. Zwar wurde Liberalität besonders bei den höheren Ständen als wichtig angesehen, aber auch weniger gut gestellte Christen wurden dazu angehalten, nach einem liberalen Leben zu streben und es Gott und Christus gleichzutun, die liberal mit ihrer Gnade und ihrer Liebe umgingen.
Revolutionäre Aufladung
Dass die mittelalterliche Ständegesellschaft schließlich ins Wanken geriet, war vermutlich weniger auf das Wirken frühliberaler Philosophen zurückzuführen, sondern auf den Schwarzen Tod, der die familiäre und soziale Ordnung Europas auflöste und so die Bedingungen neuer Gesellschaftsformen schuf. So geht der Historiker David Herlihy davon aus, dass der große Mangel an Arbeitskräften zu einer enormen Steigerung der Produktivität durch Mechanisierung führte. Weitere Folgen der Epidemie waren ein Vertrauensverlust in die Kirche, eine Schwächung des Adels, die Ausweitung des Handels, bessere Beschäftigungsmöglichkeiten, höhere Löhne und neue christliche Bewegungen (etwa die Flagellanten), die die Autorität der Kirche angriffen. Für den Kulturhistoriker Egon Friedell bereitete der Schwarze Tod der Renaissance und den mit ihr verbundenen liberalen Ideen den Weg.
Als die protestantische Revolution Anfang des 16. Jahrhunderts in Deutschland und der Schweiz ihren Ausgang nahm, traf sie auf eine geschwächte Katholische Kirche und eine Gesellschaft, in der Reformbewegungen die Pluralisierung des Christentums bereits vorbereitet hatten. Luthers »Priestertum aller Gläubigen« griff die Autorität der Priesterschaft an und machte die Erlösung zur alleinigen Angelegenheit des persönlichen Gewissens und der individuellen Bibellektüre.
Der vom ehemaligen Verfassungsrichter Udo di Fabio und dem Theologen Johannes Schilling herausgegebene Band »Die Weltwirkung des Protestantismus« argumentiert, das »große Schisma« wäre der entscheidende Antrieb für die folgende Pluralisierung, Ausdifferenzierung, Säkularisierung und Individualisierung in großen Teilen der westlichen Welt gewesen. Auch die Idee von allgemeinen Menschenrechten und Liberalität in religiösen Fragen sei eine Folge des Protestantismus, weshalb es nicht verwunderlich sei, dass der Liberalismus seinen Ausgang bei protestantischen Denkern nahm und auch heute noch stark mit ihm verbunden ist. Der Protestantismus griff einen der beiden Hauptgegner der Liberalen an, die Katholische Kirche, während er den zweiten, die feudale Ständegesellschaft, eher noch stärkte. Ein Teil der Macht der Kirche fiel nämlich den weltlichen Herrschern zu, von denen manche, wie Heinrich der VIII. von England, gleich die Gründung einer eigenen Nationalkirche veranlassten.
Wie zuvor die Glorious Revolution, die Locke begrüßte und die Hobbes sicherlich abgelehnt hätte (schließlich galten ihm Revolutionen nur im Falle der Selbstverteidigung als legitim), strahlten auch die Ereignisse der amerikanischen Unabhängigkeit und das rhetorische Pathos ihrer Erklärungen und Reden auf das Festland, wo sie zur Nachahmung einluden und den Liberalismus weiter revolutionär aufluden.
In Frankreich, wo weiterhin absolutistische Herrschaft, religiöse Konformität und aristokratische Privilegien herrschten, hatte sich zu diesem Zeitpunkt längst ein intellektuelles Milieu etabliert, das nach der Errichtung eines liberalen politischen Systems strebte. Baron de Montesquieu (1689–1755) popularisierte etwa das Konzept der Gewaltenteilung in seiner Schrift »Vom Geist der Gesetze«:
»Es gibt in jedem Staat dreierlei Vollmacht: die gesetzgebende Gewalt, die vollziehende und die richterliche. Es gibt keine Freiheit, wenn diese nicht voneinander getrennt sind.«
Von Voltaire (1694–1778) erschien 1763 die einflussreiche Schrift »Über die Toleranz«, deren Anlass ein Justizmord, nämlich die Hinrichtung des Protestanten Jean Calas war. Das Buch, das bereits zu Lebzeiten ein großer Erfolg war, wurde knapp 250 Jahre später unter dem Eindruck der terroristischen Morde al-Qaidas und des Islamischen Staats in Nizza, Paris und anderswo wiederentdeckt und auf Demonstrationen gegen islamischen Radikalismus wie einst das rote Buch Maos von Liberalen in die Höhe gereckt (dabei war es doch die westliche Toleranz, die es den Mördern ermöglichte, an die Orte ihrer Schreckenstaten zu gelangen).
1789, im Jahr der Französischen Revolution, verabschiedete die Nationalversammlung die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte, die sich streckenweise wie eine Zusammenfassung der liberalen Literatur der damaligen Zeit liest: Freiheit und Gleichheit ab Geburt (Artikel 1), Schutz der Menschenrechte als erster Zweck des Staates (Artikel 2) und der Streitkräfte (Artikel 12), Gesetze als »Ausdruck des allgemeinen Willens« (Artikel 6), Rechtsstaatlichkeit (Artikel 7 und 9), Religionsfreiheit (Artikel 10), Presse- und Meinungsfreiheit (Artikel 11), Rechenschaftspflicht von Beamten (Artikel 15) und Schutz des Eigentums (Artikel 17).
Die Französische Revolution war der Versuch einer aufstrebenden Bourgeoisie, eine absolutistische Monarchie per Handstreich in eine liberale Republik zu transformieren. Der Geist der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte entsprach einer Klasse, die sich durch aristokratische Privilegien an ihrem Aufstieg behindert sah und erkannt hatte, dass ihre Zeit gekommen war. Fortan sollte das Prinzip der Meritokratie dafür sorgen, dass ausschließlich diejenigen gesellschaftlich reüssieren, die es auch kraft ihrer Talente und ihrer Bildung verdient haben.
Es sei noch zu früh, die Folgen der Französischen Revolution zu benennen, soll der chinesische Premierminister Zhou Enlai dem Nationalen Sicherheitsberater der USA Henry Kissinger 1971 erklärt haben. Manche behaupten, der chinesische Kommunist hätte nicht »La Grande Révolution« im Sinn gehabt, sondern die bescheidenere von 1968, aber zumindest für die weitere Geschichte des Liberalismus gilt, dass 1789 und seine Vorgeschichte schwerlich überbewertet werden können.
Angefangen bei vorrevolutionären Geheimbünden und Salons, die versuchten, die kommende Gesellschaft vorwegzunehmen (und so den absolutistischen Staat moralisch schwächten, wie es der Historiker Reinhard Koselleck in seinem Buch »Kritik und Krise« beschreibt), zeitigte die Französische Revolution Entwicklungen, über die Historiker noch heute debattieren: Personenkult, Tugendterror, Kulturkampf, revolutionäre Justiz und ein Klima der Denunziation und des allgemeinen Misstrauens. Und nicht zuletzt den Versuch, das spirituelle und emotionale Vakuum, das nach der Entchristianisierung zurückblieb, durch eine neue, staatlich verordnete Religion – den deistischen Kult der Vernunft – zu ersetzen.
Der Tugendterror, in den die Erste Französische Republik gestürzt wurde, führte der Welt vor Augen, welche Folgen ein revolutionärer Umsturz haben kann, selbst wenn er von einem liberalen Programm und von liberalen Akteuren getragen wird. Noch bevor der Wohlfahrtsausschuss den »Schrecken« institutionalisiert hatte, erschien die Schrift »Bemerkungen über die französische Revolution« des englisch-irischen Philosophen Edmund Burke (1783–1785), die die Folgen des moralischen Rigorismus und selbst den Aufstieg eines »neuen Herren eurer gesamten Republik«, also Kaiser Napoleon I., prophezeite.
Burke beschrieb Gesellschaften als »Partnerschaft der Toten, der Lebenden und der noch nicht Geborenen«. Institutionen galten ihm als fragil, bitter erkämpft und von unschätzbarem Wert, weshalb jeder gegen sie gerichtete Angriff die Möglichkeit eines zivilisatorischen Rückfalls enthalte. Burke, für den Sitten und Kultur den Vorrang über Gesetzen besaßen, war jedoch keineswegs ein illiberaler Vertreter des Ancien Régime, sondern vielmehr ein Kritiker der sozialen Revolution. In seiner Heimat setzte er sich etwa für politische Reformen ein und er befürwortete die amerikanische Unabhängigkeit und die Abschaffung der Sklaverei.
Trotz phasenweise erfolgreicher Versuche, die alte Ordnung wiederherzustellen und der Katholischen Kirche durch das Konkordat wieder zu altem Einfluss zu verhelfen, konnte sich der Liberalismus in Frankreich bewähren und schließlich zur dominierenden Doktrin in Europa und Nordamerika werden. Dabei lag es nicht selten an den imperialistischen Feldzügen Napoleons, der Hegelschen »Weltseele zu Pferde«, dass liberale politische Programme (vor allem der Code Civil, der ein einheitliches nationales Zivilrecht schuf) Verbreitung fanden. Unter dem Eindruck der Erfolge der Grande Armée entstanden die ersten Bewegungen und Parteien, die sich explizit »liberal« nannten: etwa die Liberale Partei Schwedens (über die wenig bekannt ist) und die Liberale Partei Spaniens, die 1810 nach der Rebellion in Cádiz eine erste Regierung bildete.
Obwohl die spanische Monarchie wenig später restauriert und die Bezeichnung »liberal« anschließend bei vielen Menschen zum Schimpfwort wurde, hatte das Experiment großen Einfluss auf politische Zirkel in Frankreich, dem englisch- und spanischsprachigen Amerika und Großbritannien. Noch auf dem indischen Subkontinent und den Philippinen wurde die kurzlebige liberale Verfassung debattiert.
Angesichts der negativen Folgen der Industrialisierung und der beschränkten Möglichkeiten der Arbeiterklasse, sich politisch einzubringen, wuchs nach der französischen Julirevolution (1830) der Einfluss sozialistischer Theorien, die sich teils als Gegensatz zum Liberalismus, teils als seine konsequente Weiterführung verstanden. Die neue Überrepräsentation der »aufgeklärten« bürgerlichen Klasse in politischen, sozialen und kulturellen Institutionen führte zu einer Zunahme radikaler Textproduktion, zu Demonstrationen und Streiks, die nicht selten von der liberalen Presse denunziert und vom Staat gewaltsam niedergeschlagen wurden – was bestehende Differenzen verschärfte – und die Radikalisierung weiter vorantrieb. Gleichzeitig führte die augenscheinliche zunehmende Verarmung des neuen Industrieproletariats Versäumnisse der Sozialpolitik des Liberalismus und der marktwirtschaftlichen Prinzipien des Laissez-Faire und des Doux Commerce, also der Vorstellung einer friedensstiftenden und zivilisierenden Wirkung des Handels, vor Augen.
Zivilisierung und Negation
Das Scheitern der »Europäischen Revolution« im Jahr 1848 restaurierte vielerorts die Allianz aus illiberalem Staat und Kirche und ließ den Traum einheitlicher Nationalstaaten – die von vielen als Vorbedingung jeder weiteren Liberalisierung angesehen wurde – platzen. Als schließlich Napoleon III. im Dezember desselben Jahres von einer überwältigenden Mehrheit (man hatte in der Zwischenzeit das allgemeine Männerwahlrecht eingeführt) zum Präsidenten gewählt wurde, nahm das ohnehin bereits große liberale Misstrauen gegenüber der Demokratie weiter zu. Nicht erst sei 1848 herrschte unter liberalen Denkern und Politikern eine große Skepsis hinsichtlich der »Masse«, die man häufig als irrational, gewalttätig und unfähig, die eigenen Bedürfnisse zu erkennen, ansah.
Kein Wunder, dass die meisten Reformer das Wahlrecht auch weiterhin nur den Besitzenden gestatten wollten – allenfalls war man bereit, die nötigen Voraussetzungen zu mindern. Zudem verstand man unter Demokratie zu dem Zeitpunkt weniger die politische Partizipation aller volljährigen Staatsbürger, sondern vielmehr ein System der Rechtsstaatlichkeit unter Anleitung eines Parlaments. Das liberale Programm hatte zwar den Anspruch, universell zu sein – schließlich beruhte es auf der Vorstellung unveräußerlicher Naturrechte –, den ungebildeten und besitzlosen Teil des Dritten Standes, des sich allmählich dem Sozialismus nähernden Proletariats, nahm man jedoch vor allem als Bedrohung war. Die Warnungen John Stuart Mills (der besonders qualifizierten Bürgern mehr Wahlstimmen geben wollte) und anderer Sozialliberaler vor einer »Tyrannei der Mehrheit« erinnern gelegentlich an die Warnungen vor dem Demos in den Anfangstagen der europäischen Integration und vor den populistischen Bewegungen von heute.
Der revolutionäre Schock von 1848 bestärkte manche Liberale in der Ansicht, dass es dem Volk schlicht an intellektueller und moralischer Reife fehle: Die Massen seien ignorant, verstünden nichts von Ökonomie und ließen sich allzu leicht von Demagogen oder ihren eigenen Trieben verführen. Zunächst diskutierten liberale Kreise darüber, wie man den unteren Schichten beibringen könnte, den Wert harter Arbeit, von Disziplin und Selbsthilfe und die positive Wirkung eines unregulierten Marktes und das Übel eines dirigistischen Staates zu erkennen, doch die Laissez-faire-Liberalen verloren rasch die Oberhand. Stattdessen setzte sich eine vormals minoritäre Strömung durch, die später unter Namen wie »Sozialliberalismus«, »Linksliberalismus« oder »sozialistischem Liberalismus« bekannt wurde.
So forderte etwa John Stuart Mill, einer der einflussreichsten liberalen Theoretiker des späten 19. Jahrhunderts, eine »soziale Transformation«. Als er 1866 ins Parlament gewählt wurde, führte er einen persönlichen Kampf gegen den ins Hintertreffen geratenen »klassischen Liberalismus«, der immer häufiger als Grund »sozialer Atomisierung« gesehen wurde. Der neue Liberalismus hingegen sollte stattdessen die Realisierung individueller Anlagen, die Selbstverwirklichung, zum Ziel haben.
Der Staat begann zusehends, sein Stigma als Leviathan, der Schutz zum Preis von Unterwerfung bietet, zu verlieren und erfuhr eine, in den Worten des französischen Publizisten Charles Brook Dupont-White, Wiedergeburt als »Instrument der Zivilisierung«. Mill setzte sich etwa für eine Reihe weitreichender Reformen ein, um den »intellektuellen und moralischen Zustand« der Bürger zu verbessern. Nicht nur sollte eine neue Pädagogik liberale Inhalte verbreiten, auch die Ehe und die Religion sollten von Grund auf transformiert werden. In den Worten der Historikerin Helena Rosenblatt:
»Stattdessen gaben [die Liberalen] der öffentlichen Moral – oder ihrem Mangel – die Schuld. Man hatte die Armen durch Sozialismus verführt. Man hatte sie mit Tricks dazu gebracht, an eine egoistische und materialistische Ideologie zu glauben, die eine Gefahr für die gesamte soziale und politische Ordnung, einschließlich ihrer Existenz und ihrer Lebensgrundlagen, darstellte.«
Hierin stimmten Liberale mit Konservativen überein: Soziale Probleme waren vor allem moralische Probleme. Der stärker werdende Wunsch, die Bevölkerung moralisch zu erziehen, führte zu einer erneuten Betonung der Bedeutung von Familie und religiösen Reformen. In Frankreich erschienen daraufhin explizit antikatholische Lehrpläne und in Deutschland schlossen sich die Liberalen dem Kulturkampf Bismarcks an, der sich ebenfalls gegen den Einfluss des Vatikans richtete.
In den Vereinigten Staaten verstand man unter dem Begriff »liberal« zu der Zeit eine offen atheistische Weltanschauung, die sexuelle Freiheit propagiert und moralischen Verfall herbeiführt. Parallel erfuhr der klassische Liberalismus in der sozialdarwinistischen Theorie des englischen Philosophen Herbert Spencer (auf den die Formulierung »Survival of the Fittest« zurückgeht) eine Zuspitzung.
Deutschlands Beiträge zur Geschichte des Liberalismus bestanden vor allem in der Verbreitung des Protestantismus im 16. Jahrhundert und, so widersprüchlich das zunächst erscheint, im autoritären Staatssozialismus Bismarcks im späten 19. Jahrhundert. Die sozialstaatlichen Programme Deutschlands – Krankenversicherung, Impfpflicht gegen Pocken, Rentenversicherung und viele weitere soziale Reformen – wurden leidenschaftlich in liberalen Kreisen im Ausland diskutiert. Die sichtbaren Fortschritte in Deutschland stärkten die Fraktion der Sozialliberalen, die sich einen aktiven Staat wünschten. Während etwa Herbert Spencer Liberale dazu aufrief, die unbegrenzte Macht der Parlamente zu bekämpfen, wie man es einst mit absoluten Monarchien tat, sah Winston Churchill die Aufgabe des Staates darin, den Menschen am Rande der Gesellschaft zu helfen.
Eine Folge der überwundenen Skepsis gegenüber dem eingreifenden Staat und dem absoluten Aufklärungsglauben war die liberale Begeisterung für eugenische Maßnahmen. Sogenannte positive Eugenik beinhaltete staatliche Programme, die auf die Verbesserung der »Volksgesundheit« zielten, während negative Eugenik danach trachtete, die Vermehrung von Unerwünschten (Armen, Epileptikern, Alkoholikern, psychisch Kranken ...) zu reduzieren oder gar zu verhindern – auch mittels Zwangssterilisierungen oder Eheverboten. Auf diese Weise hoffte man, den Problemen der Kriminalität, der Armut und der »Asozialität« Herr werden zu können.
Der bekannte liberale Theoretiker John Atkins Hobson sah in der freien »Produktion von Kindern« das gefährlichste Versagen, dessen eine Regierung sich schuldig machen könne. Und auch der Kolonialismus fand zahlreiche Unterstützer in liberalen Zirkeln. Helena Rosenblatt beschreibt in »The Lost History of Liberalism«