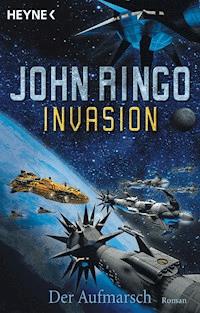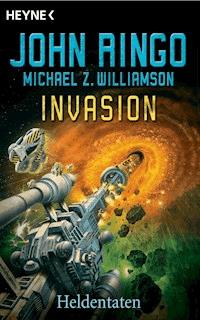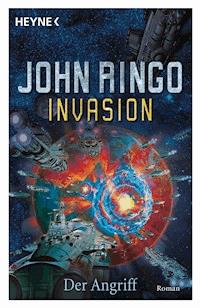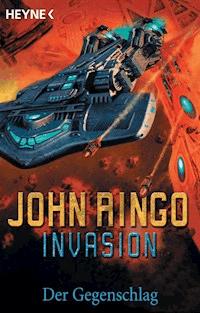8,99 €
8,99 €
-100%
Sammeln Sie Punkte in unserem Gutscheinprogramm und kaufen Sie E-Books und Hörbücher mit bis zu 100% Rabatt.
Mehr erfahren.
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Invasion
- Sprache: Deutsch
Die Posleen tragen den Krieg direkt auf die Erde
Sieg oder Niederlage? Die Menschheit steht vor der alles entscheidenden Schlacht gegen die außerirdischen Posleen. Und sie wird mitten auf der Erde ausgetragen, denn es gibt nur eines, was die USA vor einer Hungersnot und damit der Niederlage bewahrt: der Panama-Kanal. Doch der lange Krieg hat an den Ressourcen gezehrt, und so ist es nur eine Handvoll Marines, die zusammen mit den Einheimischen den Kanal verteidigen. Es mangelt ihnen zwar an Ausrüstung und Unterstützung, aber nicht an Grips und Mut!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1001
Veröffentlichungsjahr: 2009
0,0
Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.
Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Gelbe Augen
Prolog
TEIL 1
Kapitel 1
Provinz Ttckpt, Barwhon V
Logistikstützpunkt X-Ray, Ttckpt-Provinz, Barwhon V
Indowy-Frachter Selbstlose Einigung, auf dem Flug von Barwhon zur Erde
Erdorbit, Indowy-Frachter Selbstlose Einigung
POSLEEN-INTERMEZZO
Kapitel 2
Panama
Pentagon
Weißes Haus, Washington DC
Palacio de las Garzas, Präsidentenpalast Panama City, Panama
David, Chiriqui, Republik Panama
Gebäude des Außenministeriums an der Virginia Avenue, Washington DC
POSLEEN-INTERMEZZO
Kapitel 3
Darhel-Frachter Ertragreicher Firmenzusammenschluss, auf Kurs Sol
Marinewerft Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania
Gorgas Hospital, Ancon Hill, Panama City, Panama
Fort William D. Davis, Panama
Fort Kobbe, Panama
Harmony Church, Fort Benning, Georgia
Gebäude des Außenministeriums, Washington, DC
Gorgas Hospital, Ancon Hill, Panama City, Panama
POSLEEN-INTERMEZZO
Kapitel 4
Marinewerft Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania
POSLEEN-INTERMEZZO
Kapitel 5
Virginia Beach, Virginia
Provinz Darién, Republik Panama
Cristobal, Panama
Poligono de Empire, Republik Panama
Battery Pratt, Fort Sherman, Panama
Palacio de las Garzas, Präsidentenpalast, Panama City, Panama
Vieques, Puerto Rico
POSLEEN-INTERMEZZO
Kapitel 6
Hafenkabine des Captains, CA-134, vor der Insel Vieques, Puerto Rico
Gepanzerte Brücke, CA-139 (USS Salem)
Kapitänssquartier, USS Des Moines
Position 4, Poligono de Empire, Panama
Palacio de las Garzas, Präsidentenpalast, Panama City, Panama
Fort Espinar (ehemals Fort Gulick), Republik Panama
Coco-Solo-Segelflugklub, Coco Solo, Panama
Hotel Central, Casco Viejo, Panama City, Panama
Quarry Heights, Panama City, Panama
Dhahran, Saudi-Arabien
POSLEEN-INTERMEZZO
Kapitel 7
Cristobal, Panama
POSLEEN-INTERMEZZO
Kapitel 8
Außenministerium, Washington DC
POSLEEN-INTERMEZZO
Kapitel 9
Bijagual, Chiriqui, Republik Panama
TEIL 2
Kapitel 10
Erde, Westliche Hemisphäre
Fort Kobbe, Republik Panama
Muelle (Pier) 18, Balboa, Republik Panama
Valparaiso, Chile
POSLEEN-INTERMEZZO
Kapitel 11
Bijagual, Chiriqui, Republik Panama
POSLEEN-INTERMEZZO
POSLEEN-INTERMEZZO
Kapitel 12
Hafenkabine des Kapitäns, USS Des Moines, Cristobal, Panama
POSLEEN-INTERMEZZO
Kapitel 13
Arraijan, Panama
Palacio de las Garzas, Präsidentenpalast, Panama City, Panama
Muelle (Pier) 18, Balboa, Republik Panama
Rio Hato, Panama
Hotel Campestre, El Valle de Anton, Panama
POSLEEN-INTERMEZZO
Kapitel 14
Bijagual, Chiriqui, Republik Panama
POSLEEN-INTERMEZZO
Kapitel 15
Auf hoher See, südlich der Halbinsel Azuero, Republik Panama
Darhel-Konsulat, Panama City, Panama
USS Des Moines
Panama City, Panama
USS Des Moines
Darhel-Konsulat, Panama City, Panama
Remedios, Chiriqui, Republik Panama
USS Des Moines
POSLEEN-INTERMEZZO
Kapitel 16
Im Westen von Aguadulce, Republik Panama
Darhel-Konsulat, Panama City, Panama
POSLEEN-INTERMEZZO
Kapitel 17
Remedios, Chiriqui, Republik Panama
USS Des Moines
Posleen-G-Dek Hinreißende Mahlzeit XXVII
USS Des Moines
USS Texas
USS Des Moines
Remedios, Chiriqui, Republik Panama
POSLEEN-INTERMEZZO
Kapitel 18
Remedios, Chiriqui, Republik Panama
Darhel-Konsulat, Panama City
Nördlich von Remedios, Chiriqui, Republik Panama
Remedios, Chiriqui, Republik Panama
USS Des Moines
Remedios, Chiriqui, Republik Panama
Östlich von Remedios, Chiriqui, Republik Panama
POSLEEN-INTERMEZZO
Kapitel 19
Remedios, Chiriqui, Republik Panama
USS Des Moines
POSLEEN-INTERMEZZO
Kapitel 20
Bijagual, Chiriqui, Republik Panama
Gualaca-Brücke, Rio Chiriqui, Republik Panama
In der Nähe von Hügel 2213, Provinz Chiriqui, Republik Panama
Chiriqui Grande, Provinz Bocas del Toro, Republik Panama
Kreuzung, Kontinentalscheide – Straße nach Chiriqui Grande
TEIL 3
Kapitel 21
USS Des Moines
POSLEEN-INTERMEZZO
Kapitel 22
Palacio de las Garzas, Präsidentenpalast, Panama City, Panama
CA-134, Bucht von Panama
Palacio de las Garzas, Präsidentenpalast, Panama City, Panama
Fort William D. Davis, Panama
Palacio de las Garzas, Präsidentenpalast, Panama City, Panama
USS Des Moines, vor der Isla Cebaco
Santiago, Veraguas, Republik Panama
8 Kilometer nordwestlich von Sona, Republik Panama
POSLEEN-INTERMEZZO
Kapitel 23
La Joya-Gefängnis, Republik Panama
USS Des Moines
La Joya-Gefängnis, Republik Panama
USS Des Moines
Pedrarias-Front, Provinz Veraguas, Republik Panama
USS Des Moines
Darhel-Konsulat, Paitilla, Panama City, Panama
Kapitel 24
Panama City, Panama
USS Des Moines
Panama City, Panama
Palacio de las Garzas, Präsidentenpalast, Panama City, Panama
Montijo, Panama
POSLEEN-INTERMEZZO
Kapitel 25
USS Des Moines
Aguadulce, Republik Panama
Palacio de las Garzas, Präsidentenpalast, Panama City, Panama
Himmitschiff Harmonische Mischung
USS Des Moines
Bridge of the Americas
Bootsrampe, Fort Amador
La Joya-Gefängnis, Republik Panama
Feldlazarett, 1 Mechanized Division
POSLEEN-INTERMEZZO
Kapitel 26
USS Des Moines
Kongresspalast, Plaza de los Mártires, Panama City, Panama
Kommandozentrale, USS Des Moines
Palacio de las Garzas, Präsidentenpalast, Panama City, Panama
USS Des Moines
Palacio de las Garzas, Präsidentenpalast, Panama City, Panama
Fort William D. Davis, Panama
USS Des Moines
Palacio de las Garzas, Präsidentenpalast, Panama City, Panama
TEIL 4
Kapitel 27
Fort William D. Davis, Panama
Santiago, Veraguas, Republik Panama
San-Pedro-Front, Republik Panama
Disco Stelaris, Hotel Marriott Cesar, Panama City, Panama
Rio San Pedro, Panama
Hotel Marriott Cesar, Panama City, Panama
Fort Kobbe, Panama
Santa Fé, Provinz Veraguas, Republik Panama
SOUTHCOM, Quarry Heights, Panama
Paradeplatz, Fort Kobbe, Panama
Haus der Familie Rodriguez, Via Argentin, Panama City, Panama
Santa Fé, Provinz Veraguas, Republik Panama
Hotel Central, Casco Viejo, Panama City, Panama
SOUTHCOM, Quarry Heights, Panama
Veraguas/Provinz Chiriqui, Republik Panama
Muelle (Pier) 18, Balboa, Republik Panama
POSLEEN-INTERMEZZO
Kapitel 28
David (ausgelöscht), Chiriqui, Republik Panama
San-Pedro-Front, Republik Panama
CA-134, USS Des Moines, vor der Isla Cebaco
San-Pedro-Front, Republik Panama
CA-134, USS Des Moines, vor der Isla Cebaco
San-Pedro-Front, Republik Panama
CA-134, USS Des Moines, vor der Isla Cebaco
San-Pedro-Front, Republik Panama
Kapitel 29
SOUTHCOM Headquarters, im »Tunnel« Quarry Heights, Panama
Gefechtsposition Ovalo, Provinz Darien, Republik Panama
Provinz Darién, Republik Panama
SOUTHCOM, der »Tunnel«, Quarry Heights, Panama
POSLEEN-INTERMEZZO
Kapitel 30
Natafront, Republik Panama
Santiago, Veraguas, Republik Panama
USS Des Moines, südwestlich der Natafront
Geschützstellung Miranda, Sante Fé, Provinz Veraguas, Republik Panama
Provinz Darién, Republik Panama
Haus der Rodriguez, Via Argentin, Panama City, Panama
Posleen-Territorium, westlich der Natafront, Republik Panama
Aufmarschzone Pedrarias, östlich der Natafront, Republik Panama
USS Des Moines, südwestlich der Natafront, Bucht von Panama
POSLEEN-INTERMEZZO
Kapitel 31
Natafront, Republik Panama
Santa Fé, Provinz Veraguas, Republik Panama
Natafront, Republik Panama
Aufmarschgebiet Pedrarias, östlich der Natafront, Republik Panama
POSLEEN-INTERMEZZO – Provinz Darién, Republik Panama
Kapitel 32
Natafront, Republik Panama
Santa Fé, Provinz Veraguas, Republik Panama
Natafront, Republik Panama
USS Des Moines, südwestlich der Natafront, Bucht von Panama
Santa Fé, Provinz Veraguas, Republik Panama
Todeszone Nata, Republik Panama
POSLEEN-INTERMEZZO
Kapitel 33
Nata Todeszone, Republik Panama
San Pedro, Republik Panama
Santa Fé, Provinz Veraguas, Republik Panama
Pedrarias Aufmarschzone, östlich der Natafront, Republik Panama
Santiago, Veraguas, Republik Panama
Provinz Darién, Republik Panama
POSLEEN-INTERMEZZO
Kapitel 34
San-Pedro-Front, Republik Panama
POSLEEN-INTERMEZZO
Kapitel 35
Vor der Isla Cebaco
POSLEEN-INTERMEZZO – Provinz Darién, Republik Panama
Kapitel 36
Santa Fé, Provinz Veraguas, Republik Panama
Stellung Lundy’s Lane, Provinz Darién, Republik Panama
San-Pedro-Front, Republik Panama
CA-139, USS Salem
Iglesia del Carmen, Panama City, Panama
Epilog 1
Epilog 2
Nachwort
Glossar
Copyright
JOHN RINGO: INVASION
Bd. 1: Der Aufmarsch Bd. 2: Der Angriff Bd. 3: Der Gegenschlag Bd. 4: Die Rettung Bd. 5: Heldentaten Bd. 6: Callys Krieg Bd. 7: Die Verräter Bd. 8: Die Rückkehr
JOHN RINGO: DIE NANOKRIEGE
Bd. 1: Der Zusammenbruch Bd. 2: Der Anschlag Bd. 3: Die Sturmflut Bd. 4: Die Flucht
Für die Besitzer, die Geschäftsführung und dieDamen des Ancon Inn (Panama City) und desEl Moro (Colon). Ich danke euch. Wir sollten dasirgendwann einmal wieder machen.
Und, wie immer:
Für Captain Tamara Long, USAFGeboren: 12. Mai 1979Gefallen: 23. März 2003, AfghanistanDu fliegst jetzt mit den Engeln.
Gelbe Augen
Du wirst das Fieber haben: Gelbe Augen! In etwa zehn Tagen von heute an werden sich eiserne Bänder um deine Stirn legen; deine Zunge wird aussehen wie geronnene Sahne, mit einem rostfarbenen Streifen in der Mitte; dein Mund wird nach Dingen schmecken, für die es keine Worte gibt, mit Klauen und Hörnern und Flossen und Schwingen; dein Kopf wird eine Tonne wiegen oder auch mehr und vierzig Orkane werden in ihm brüllen!
In etwa zehn Tagen von heute an wirst du dir geschwächt die Frage stellen, wie es sein kann, dass all deine Knochen auseinanderbrechen und so schnell wieder zusammenwachsen! Du wirst das Gefühl haben, man treibt dir Dutzende von Nägeln in die Schläfen! Du wirst dich fragen, ob dir ein Schuss die Leber zerrissen hat oder was sonst! Du wirst dich fragen, ob diese Hitze nicht der Hades ist – und noch mehr! Und dann wirst du schwitzen, bis du am Ende schwächer – bist – als – ein – kleines – Kätzchen!
Und in etwa zehn Tagen von heute an darfst du dich vor deiner Gesundheit verbeugen und dich von ihr verabschieden. Denn du wirst das Fieber haben: GELBE AUGEN!
James Stanley Gilbert, »Panama Patchwork 1909«
Prolog
Von seinem Platz ganz hinten in der voll gepackten Versammlungshalle sah Guanamarioch, wie der goldbetresste Erinnerer zum Rednerpult hinaufstieg. Das Geschnatter der dicht gedrängten Kessentai verstummte, als der Priester – die Erinnerer galten bei den Posleen als so etwas wie die Geistlichkeit – zweimal mit geübter Klaue auf das steinerne Rednerpult schlug.
Wenn man von seinem Alter und seinen Narben absah, war der Erinnerer – so wie Guanamarioch – ein durchschnittlich aussehender Posleen, ein krokodilähnlicher Zentauroide mit gelber Haut und ebensolchen Augen, mit einer Schulterhöhe von etwa einem Meter fünfzig, mehreren Reihen scharfer, elfenbeinfarbener Zähne und einem gefiederten Kamm, den er auf Wunsch aufstellen konnte und der dem Kopfschmuck eines Sioux-Indianers auf dem Kriegspfad glich.
»Wir wollen uns erinnern«, rief der Geistliche und legte den Kamm aus Respekt für die Zeremonie um.
All die Hunderte versammelter Kessentai kreuzten die Arme über ihrem mächtigen Brustkasten und blickten nach oben zu der innen und außen mit einer dicken Schicht aus purem Gold verkleideten Spitze der Pyramide und riefen im Chor: »Wir erinnern uns. Wir erinnern uns.«
Der Erinnerer streckte eine Klaue aus, woraufhin ein Helfer ihm eine locker gerollte Schriftrolle hineinlegte. Sie wurde auf dem steinernen Rednerpult ausgerollt, und der Helfer legte »Haltesteine«, kunstvoll geschnitzte Briefbeschwerer, auf die Ecken, um die Rolle festzuhalten. »Aus der Rolle des Flugs und der Besiedlung«, verkündete der Erinnerer.
»Wir erinnern uns«, hallte es erneut von den Kessentai zurück.
Die pyramidenförmige Versammlungshalle erzitterte, als just in diesem Augenblick in der Nähe eine hyperschnelle Lenkwaffe eines rivalisierenden Clans einschlug. Guanamarioch konnte sich, jung wie er war, kaum zurückhalten, die Halle zu verlassen und mit seinen Untergebenen in den Kampf zu ziehen. Das eifrige wutentbrannte Zittern und Murmeln der anderen verriet ihm, dass sie Ähnliches empfanden. Der Erinnerer beruhigte die Versammlung, indem er den Blick über die Anwesenden schweifen ließ. Er war einer der Ältesten von ihnen, ein Kessentai, der in jüngeren Tagen zu den ersten Kriegern des Clans gehört hatte, inzwischen aber zum Kenstain geworden war. Keiner der anwesenden Jungen wollte sich vor den Augen dieses alten Helden Schande machen, also beruhigten sie sich wieder.
»Vers Fünf: Die neue Heimat«, fuhr der Erinnerer fort.
Wieder tönte die Gruppe im Chor: »Wir erinnern uns.«
»Und auf seiner Flucht aus der zerstörten Heimat erreichte das Volk mit seinen neuen Schiffen eine neue Welt, und die war reich und wimmelte von Leben. Und die Schiffe waren müde, und der Treibstoff war beinahe verbraucht. Und der Anführer des Volkes, er hieß Rongasintas, der Philosoph, führte das Volk in einen öden Landstrich, der unbewohnt war, und dort versuchten sie sich niederzulassen und Nahrung wachsen zu lassen.
Aber das Volk hatte wenig Nahrung, und die Bewohner wollten nicht mit ihnen teilen, sondern forderten: ›Geht weg. Dies ist unsere Welt, nicht eure. Kehrt in die Finsternis zurück, aus der ihr gekommen seid.‹ Und das Herz Rongasintas’ wurde schwer.
Aber das Volk rief: ›Herr, gib uns Nahrung, denn wir hungern‹, und Rongasintas gab zur Antwort: ›Esst die noch nicht vernunftbegabten Jungen.‹<
Und weinend aß das Volk seine Kinder, aber es war nicht genug. Wieder riefen sie: ›Herr, gib uns Nahrung, denn wir hungern.‹«
»Wir hungern«, wiederholten die Versammelten.
Der Erinnerer nickte mit seinem großen Krokodilschädel, nickte mit unendlicher Würde und fuhr fort: »Und der Lord Rongasintas, der Philosoph, antwortete: ›Wählt einen von zwanzig unter den Normalen und esst sie.‹ Immer noch weinend wählte das Volk aus seiner Zahl einen von zwanzig, auf dass die ganze Schar leben und nicht untergehen möge. Und eine kurze Zeit hungerte das Volk nicht. Aber dennoch weinten sie, denn noch war es nicht die Art des Volkes, sein eigenes Fleisch zu essen.
Schließlich ging der Lord des Volkes zu den Bewohnern des Ortes und flehte sie an: ›Wir haben getan, was wir können. Wir haben unsere eigenen Jungen gegessen. Gebt uns Nahrung, auf dass unser Volk nicht untergehe.‹ Und die Bewohner des Ortes häuften Schmach auf Rongasintas und sagten: ›Verlasst diesen Ort oder esst euresgleichen, bis keiner von euch mehr übrig ist. Uns ist das gleichgültig.‹ Und der Herr und Philosoph begab sich an einen hohen Ort, um zu meditieren. Und nach seiner Rückkehr verkündete er: ›Die Aldenat’ haben uns so gemacht, wie wir sind, wir hatten in dieser Sache keine Wahl. Sie hoben uns über die niedrigen Tiere und gaben uns Vernunft. Sie gaben uns den Drang zur Vermehrung und sie gaben uns Medizin und Wissen, auf dass wir nicht jung sterben. Unter ihrer Herrschaft ist das Volk gediehen und gewachsen. Lob und Preis gebührt den Aldenat’.‹«
»Und wir haben die Aldenat’ gepriesen«, hallte es ihm aus der Versammlung entgegen.
Und der Erinnerer fuhr fort: »Und Rongasintas sagte zum Volk: ›Wir müssen leben. Um zu leben, müssen wir essen. Gehet also hin und esst die Bewohner dieses Ortes. So wie den Aldenat’ alles Lob gebührt, möge ihnen auch die Schuld gebühren.‹« Und das Echo hallte ihm von den versammelten Kessentai entgegen, so laut, dass die steinernen Wände der großen Halle der Erinnerung davon erbebten. »Auf sie möge die Schuld kommen.«
TEIL 1
1
»Wie reiche Waffen in des Tages Hitze, die schützend sengen.«
Shakespeare, »Heinrich IV.«
Provinz Ttckpt, Barwhon V
Kalter, blaugrüner Sumpf unter violettem Himmel. Lieutenant Connors hatte schon eine Menge Sümpfe gesehen, schließlich hatte er ein paar Jahre in »Camp Swampy«, Fort Stewart, Georgia, verbracht.
»Aber diese Scheiße hier ist einmalig«, murmelte er, während er sich alle Mühe gab, nicht zu viel Energie seines gepanzerten Kampfanzugs zu verbrauchen und andererseits nicht bis zur Hüfte im Morast zu versinken. Er regelte die Masse seines Anzugs herunter und gab Energie auf die Schubaggregate, um in Bewegung zu bleiben, obwohl der Boden wie eine schlammige Suppe unter ihm wegglitt, und behielt so die Oberhand. Trotzdem sanken seine Füße bis zu den Knöcheln in den Matsch.
Der GKA, in dem Connors steckte, war ein GalTech-Produkt, nach menschlichen Spezifikationen gebaut. Trotzdem, und obwohl symmetrisch bipedal gebaut – zwei Arme, zwei Beine und mit einer großen Ausbuchtung, wo der Kopf sein sollte -, sah das Ding nicht besonders menschlich aus. Um es genauer zu sagen: Es sah völlig unmenschlich aus. Zum einen hatte sich der Anzug in ein stumpfes Blaugrün verfärbt, um sich der Vegetation des Sumpfes anzupassen, zum anderen fehlten ihm erkennbare Augen und Ohren. Dafür sprossen eine Anzahl Waffenstationen aus allen möglichen Teilen.
Hinsichtlich der Tarnung gab es noch keine endgültige Entscheidung. Man hatte auch schon andere Muster ausprobiert. Das blaugrün fleckige Muster von Connors’ Anzug hatte genauso gut funktioniert wie all die anderen Muster, aber auch kein Jota besser. Die gelben Augen der Posleen waren einfach anders, sowohl in ihrer Struktur als auch in Bezug auf das, was sie sahen.
Der Lieutenant zuckte im Inneren seines Anzugs die Achseln, was mit Ausnahme der Künstlichen Intelligenz, die den Anzug für ihn betrieb, natürlich niemand sah. Er wusste nicht, welche Tarnung funktionieren würde (das wusste das AID auch nicht), und deshalb folgte er einfach dem Rat, den seine Vorgesetzten zu diesem Thema gegeben hatten.
Um ihn hatte sich, ähnlich blaugefleckt gemustert und gleich ihm um einen akzeptablen Kompromiss zwischen Geschwindigkeit und einem langen Leben bemüht, das zweite Platoon der 1st Company 508th Mobile Infantry (GKA) in einem sehr spitzen und schmalen »V« beiderseits eines aufgewühlten Schlammpfades verteilt.
Normalerweise wäre dieser Pfad zumindest auf der Erde für Kontroll- und Orientierungszwecke überflüssig gewesen, denn das GPS konnte einem Soldaten oder auch einer Gruppe Soldaten jederzeit genau sagen, wo sie sich befanden. Nur dass es auf Barwhon kein GPS gab. Außerdem waren die Anzüge zwar selbstständig zur Trägheitsnavigation fähig, was aber im Großen und Ganzen für die feindlichen Posleen nicht galt. Deshalb folgten die Posleen dem Pfad, und deshalb wurden die Infanteristen auf diesen Pfad geführt, um mit ihnen zu kämpfen.
Außerdem stellte der Pfad die kürzeste Entfernung zu einer Kompanie amerikanischer leichter Infanterie dar, die in einigen Meilen Entfernung auf der anderen Seite eines Flussübergangs abgeschnitten waren, mit dem Rücken zum Fluss und keiner Möglichkeit, ihn unter feindlichem Beschuss zu überqueren.
Connors rückte wie die Männer des Second Platoon unter Funkstille vor. Sie konnten die Befehle ihrer Vorgesetzten hören, falls ihre Vorgesetzten es für zweckmäßig hielten, etwas zu sagen. Sie konnten auch die herzzerreißend präzisen Berichte und Befehle hören, die von einem gewissen Captain Robert Thomas ausgingen oder zu diesem gelangten, der die am Flussübergang eingeschlossene Kompanie befehligte. Sie hatten sie jetzt seit Stunden gehört.
Die MI-Soldaten hatten gehört: »Zulu Vier Drei, hier Papa Eins Sechs. Beschuss anpassen, Ende.« Sie hatten gehört: »Echo Zwei Zwei, hier spricht Papa Eins Sechs. Ich habe ein Dutzend Gefallene, ich muss hier dringend raus.« Und sie hatten auch »Captain Roberts, verdammte Scheiße, wir können die nicht alle … AIII!« mit angehört.
Connors hörte, wie Echo Zwei Zwei – der Schlüssel auf seinem Display sagte ihm, dass das die Sanitätskompanie der Brigade war – in Person eines Funkers mit brechender Stimme sagte: »Tut uns leid, Papa. Herrgott, wie es uns leidtut. Aber wir kommen nicht durch. Wir haben es versucht.«
Und von dem Augenblick an wurde es immer schlimmer.
»Echo Drei Fünf, hier Papa Eins Sechs. Wir werden massiv angegriffen, schätzungsweise in Regimentsstärke oder mehr. Wir brauchen Verstärkung, Ende.«
Ein Regiment Posleen, das waren zwei- oder dreitausend Aliens. Eine leichte Infanteriekompanie in voller Gefechtsstärke hatte nicht einmal ein Zwölftel dieser Stärke … vielleicht auch weniger. In diesem Fall war die eingeschlossene Kompanie in Anbetracht der angespannten Personalsituation schwächer. Wesentlich schwächer.
Das da vorne ist ein verdammt guter Mann, dachte Connors in Anbetracht des unglaublich ruhigen Tonfalls eines Mannes, Roberts, der wusste, dass er und seine sämtlichen Männer auf der Speisekarte standen. Viel zu gut, um gefressen zu werden.
Und dann kam die wirklich schlechte Nachricht. »Papa Eins Sechs, hier Echo Drei Fünf« – der Brigadekommandeur – »Lage erfasst. Die Zweite der 198er ist auf dem Vormarsch zu euch in einen Hinterhalt geraten. Wir haben mindestens ein weiteres Regiment …«
Und dann fing die Scheiße endgültig an zu dampfen, auch wenn Connors das auch erst in dem Augenblick erfuhr, als der vorderste Mann seiner Kompanie schrie: »Hinterhalt!« Eine halbe Sekunde, bevor ein Schwarm von Flechettes aus Railguns den Himmel verdunkelte und der Schlamm rings um sie in Geysiren ausbrach, als die Geschosse und Plasmastrahlen der Aliens ihn trafen.
Das Problem, die dämlichen Posleen umzubringen, dachte Connors, während er im Schlamm lag, ist, dass die, die jeweils übrig bleiben, viel, viel schlauer werden.
Über ihm herrschte reger Beschuss. Hauptsächlich aus Railguns, 1-mm-Flechettes, bei denen es höchst unwahrscheinlich war, dass sie die Panzerung eines Anzugs durchschlugen. Um lästig zu werden, brauchte es drei Millimeter. Das war massiv genug, um durchzudringen, zumindest dann, wenn ein Flechette richtig traf. Und tatsächlich hatte es einige Männer seiner Kompanie erwischt.
Die Plasmakanonen und die hyperschnellen Geschosse, HVMs – Hypervelocity Missiles genannt -, die die Aliens hatten, waren da wesentlich unangenehmer. Die durchschlugen die Panzerung, als bestünde sie aus Papier, und verwandelten die Männer im Inneren der GKAs in lebende Fackeln.
Und noch schlimmer waren die Tenar, die fliegenden Schlitten der Anführer der Aliens. Die waren nicht nur mit größeren und stärkeren Versionen der Plasmakanonen und der HVMs ausgestattet, sondern hatten auch mehr Munition, physikalische ebenso wie in den Energiespeichern, und viel bessere Zielsysteme. Außerdem hatten sie einen Höhenvorteil und konnten damit nach unten schießen und damit jede Deckung zunichte machen, die sich seine Leute irgendwie geschaffen hatten. Und die Dschungelbäume, so dick sie auch waren, konnten den Beschuss auch nicht aufhalten. Vielmehr zersplitterten sie oder flammten auf, wenn sie getroffen wurden. Manchmal taten sie auch beides. Jedenfalls kam Connors seine augenblickliche Umgebung so vor, wie man sich in Hollywood vielleicht die Hölle ausgedacht hatte, nichts als Flammen, Rauch, Zerstörung, unvorstellbares Chaos und Durcheinander.
Das einzig Gute, was man über die augenblickliche Situation sagen konnte, war, dass die Posleen allem Anschein nach nur wenige Tenar hatten. Eine andere Erklärung dafür, dass die Kompanie noch überlebte, gab es nicht.
Connors tauschte Schuss für Schuss mit den Posleen. Aber das war eigentlich nicht seine Aufgabe. Andererseits, wenn es einmal richtig heiß wurde, war auch der Job eines Lieutenant nicht sonderlich angenehm.
»Soll ich Artilleriebeschuss anfordern, Lieutenant Connors?«, erkundigte sich sein AID.
»Ja, tu das«, antwortete er und ärgerte sich. Daran hätte ich zuerst denken müssen. »Und zeig mir den Status des Platoons.«
Das AID projizierte mit Hilfe eines Lasers im Helm des Anzugs unmittelbar auf Connors’ Netzhaut eine Grafik. Er hatte den Einsatz mit siebenunddreißig Mann begonnen. Es schmerzte ihn, sehen zu müssen, dass sieben dieser Männer schwarz markiert waren, tot oder jedenfalls so schwer verwundet, dass sie nicht mehr am Kampf teilnehmen konnte. So wie die Dinge lagen, waren sie beinahe mit Sicherheit tot.
Er wandte seine Aufmerksamkeit einer speziellen Markierung der Grafik zu. »Zeig mir Einzelheiten über Staff Sergeant Duncan.«
Sofort baute sich eine andere Karte auf, die die Lebensdaten und eine Zusammenfassung bisheriger Aktivitäten von einem von Connors’ Gruppenführern zeigte. Die Zusammenfassung brauchte er nicht, er kannte seine Männer. Aber die Lebensdaten waren etwas ganz anderes.
Scheiße, Duncan war überladen.
Um das zu erkennen, brauchte es einen erfahrenen Blick. Der erste Hinweis war die von dem AID projizierte Silhouette des Soldaten. Duncan hätte auf dem Boden liegen oder zumindest irgendwo in Deckung sein sollen. Das war er nicht; er kniete und tauschte sein Feuer Schuss für Schuss mit den Posleen. Gegen Normale war das durchaus in Ordnung; die waren gewöhnlich nur leicht bewaffnet. Aber sieht dieser Idiot die gottverdammten HVMs nicht, mit denen sie auf ihn schießen?
Bei näherem Hinschauen wurde es noch schlimmer. Sein Adrenalinpegel war hoch, aber das war normal. Allerdings war die Hirnaktivität verzerrt.
»AID, Frage. Analysieren: Staff Sergeant Robert Duncan. Korrelation für ›Kampfmüdigkeit‹, manchmal auch als ›nervliche Hysterie‹ bekannt.«
AIDs dachten sehr schnell, wenn auch im Allgemeinen nicht sehr kreativ.
»Duncan ist überreif für einen Kollaps, Lieutenant«, antwortete das AID. »Er hat jetzt vierundvierzig Tage ständigen Kampf – und ohne Ruhepause. Insgesamt hat er über dreihundert Tage. Er hat aufgehört zu essen und in den letzten sechsundneunzig Stunden weniger als vier Stunden Schlaf gehabt. Der Verlust wichtiger Kameraden im Verlauf der letzten achtzehn Monate nähert sich der Hundert-Prozent-Grenze. Und gebumst hat er in letzter Zeit auch nicht.«
»Scheiße … Duncan, runter, verdammt«, befahl Connors. Die Silhouette auf seiner Netzhaut regte sich nicht.
»Beschuss«, verkündete das AID ausdruckslos. Dann ging freundliches Artilleriefeuer auf die Aliens nieder, die die Kompanie umgaben. »Passe an.«
Mit Hilfe der Artillerie gelang es, den Angriff abzuwehren. Es machte keinen Unterschied. Die Posleen schwärmten zwischen der Kompanie und ihrem Ziel aus, schwärmten in deutlich mehr als Regimentsstärke aus. Viel mehr.
Duncan war ein Problem. Sie konnten ihn nicht zurücklassen; da waren noch Tausende von Posleen, die ihn sofort überwältigt und gegessen hätten, wenn er allein auf sich gestellt gewesen wäre. Connors hatte den Mann ablösen und dem Führer seines Alpha-Teams den Befehl über die Gruppe geben müssen. Und was noch viel schlimmer war: Dem Sergeant waren bloß zusammenhanglose, einsilbige Wörter zu entlocken.
Und ich kann keinen zurücklassen, um auf ihn aufzupassen. Ich kann nicht einmal den Anzug auf Auto-Programm schalten, um ihn zum Stützpunkt zurückzubringen; so auf sich allein gestellt, würde er das niemals überstehen.
Wenigstens war der Sergeant imstande, einfache Befehle zu befolgen: rauf, runter, nach vorne, zurück, schießen, Feuer einstellen. Während des langen, erbitterten und blutigen Kampfes bis zum Erreichen der Furt hielt Connors ihn in seiner Nähe. Sie erreichten sie natürlich zu spät. Captain Roberts’ Funkgerät war längst verstummt, ehe der erste Soldat der Kompanie den Fluss erreichte.
Zu dem Zeitpunkt musste Connors feststellen, dass er der einzige Offizier war, der in der ganzen Kompanie verblieben war. Nicht weiter schlimm; die Kompanie hatte sich ohnehin auf nicht viel mehr als Platoonstärke verringert.
Connors hörte, wie sein Platoon Sergeant – nein, er ist ja jetzt First Sergeant, oder nicht? – schrie: »Duncan, was zum Teufel bildest du dir eigentlich ein, wo du hingehst?«
Der Lieutenant drehte sich um und sah, wie sein stark beschädigter Sergeant anfing, sich mit dem Körper eines Kameraden in den Armen aus der unmittelbaten Gefahrenzone zurückzuziehen. Ein paar eigene Schweber zogen dicht über dem ölig wirkenden Wasser des Sumpfs dahin, während sie sich daran machten, die Furt zu verstärken.
»Ist schon okay, Sergeant … First Sergeant. Lassen Sie ihn gehen«, sagte Connors müde. »Dort hinten ist es jetzt sicher. Kümmern Sie sich um unsere Flanke, Top.«
Er konnte das dem Sergeant überlassen, und so setzte Connors sich auf den Hügel, den die Posleen errichtet hatten, offenbar um Geist und Körper des gefallenen Captain Roberts zu ehren. Er fing an, einen Brief an Roberts’ Frau zuhause auf der Erde zu verfassen.
»Liebe Lynn …«
Logistikstützpunkt X-Ray, Ttckpt-Provinz, Barwhon V
Auf dem Marsch zu der Furt und in den Kämpfen um sie hatte das Bataillon schwere Verluste erlitten. Die B-Kompanie war auf einen Offizier und einundfünfzig Mann zusammengeschrumpft. Von den einundfünfzig war einer – Staff Sergeant Duncan – praktisch ausgefallen, ein Fall für die Psychiater. Der Rest der Kampfkompanie des Bataillons befand sich in nicht viel besserem Zustand.
Der Bataillonskommandeur war gefallen, damit hatte sein ehemaliger Stellvertreter, Major Snyder, den Befehl übernommen. Nur zwei Kompaniechefs hatten überlebt, und einer davon war Chef der Versorgungskompanie, die normalerweise kaum mit Kampfhandlungen zu tun hatte. Insgesamt hatten vom Offizierkorps des Bataillons ein Major, zwei Captains, ein halbes Dutzend First Lieutenants und bezeichnenderweise kein einziger Second Lieutenant überlebt. Wie die anderen Neuen waren die reihenweise gefallen, ehe sie eine echte Chance bekommen hatten, richtig zu lernen, was hier gespielt wurde.
Connors pries sich glücklich, dass er seinen alten Platoon Sergeant als First Sergeant der Kompanie behalten hatte. Snyder hatte ihn zum Sergeant Major des Bataillons machen wollen.
Irgendwie, dachte Connors, glaube ich nicht, dass Snyder es ausschließlich als Kompliment gemeint hat, mir Martinez zu lassen.
»Sir«, fragte Martinez, als sie allein im Zelt des Kompaniehauptquartiers standen, »was jetzt? Die haben uns so fertig gemacht, dass wir schwerlich wieder angreifen können.«
Das Zelt war grün, obwohl die gesamte Vegetation auf Barwhon V einen bläulichen Ton hatte. Es roch angeschimmelt und auch ein wenig süßlich, was der Dschungelfäule von Barwhon zuzuschreiben war, die sich auf dem Material der Zeltplanen ausgesprochen wohl fühlte, es als angenehmen Nistplatz zu schätzen gelernt hatte.
»Der Major … nein, der Colonel hat gesagt, dass wir auf eine Weile nach Hause gehen können, Top«, antwortete Connors unbeteiligt. »Er hat gesagt, von uns sind nicht genügend Leute übrig, um uns neu zu formieren. Also geht es zurück, und wir bekommen Ersatz, ehe die uns erneut an die Front werfen.«
»Nach Hause?«, fragte Martinez staunend.
»Nach Hause«, bestätigte Connors und dachte an die Frau, die er vor so vielen, langen Monaten dort zurückgelassen hatte.
Indowy-Frachter Selbstlose Einigung, auf dem Flug von Barwhon zur Erde
»Alle mal herhören!«, schnarrte es aus den Lautsprechern über den Köpfen der Soldaten, die aufgereiht in der fremdartig und schwach beleuchteten Versammlungshalle standen.
»Voll besonderem Vertrauen auf den Patriotismus, den Mut, die Treue und die Fähigkeiten von …« Der diensttuende Adjutant der 508th, normalerweise ein Offizier aus dem Zahlmeisterstab, verlas die Namen der verbliebenen Offiziere des Bataillons. Einer der Namen war »Connors, Scott.«
»Captain?« Connors staunte, als die Zeremonie vorbei war. »Wow. Ich hätte nie gedacht, dass ich lange genug leben würde, um Captain zu werden.«
»Lassen Sie sich’s nur nicht in den Kopf steigen, Skipper«, riet Martinez, der wie so viele andere bei Fleet Strike ein dorthin versetzter Marine war.
»Nein, Top«, pflichtete Connors ihm bei. »Wäre nicht gut, wenn einem der Kopf zu dick anschwillt. Allein schon, weil man dann ein zu gutes Ziel abgibt.«
»Die Streifen … sehen gut aus«, sagte Duncan und starrte auf die Wandpartie gegenüber dem Kopfteil seiner Pritsche. Seine Stimme wirkte etwa ebenso interessiert wie seine ausdruckslosen, leblosen Augen. »Die Winkel übrigens auch, Top«, fügte er an Martinez gewandt hinzu.
Wenn sie nicht in ihrem GKA steckten, hätte man Connors und Duncan für Brüder halten können, etwa gleich groß, etwa gleich kräftig gebaut. Obwohl Connors mindestens fünfzehn Jahre älter als Duncan war, wirkte er doch erheblich jünger. Im Gegensatz zu Duncan war er verjüngt.
»Wie ist’s Ihnen denn ergangen, Sergeant Duncan?«, erkundigte sich der frisch gebackene Captain.
»Nicht übel, Sir«, antwortete der ausdruckslos. »Die haben gesagt, dass man mich schon wieder hinbiegen kann … vielleicht. Entweder kann ich in einem Jahr wieder meinen Dienst machen oder ich kann nie mehr kämpfen. Die haben davon geredet, dass sie mich in einen Tank stecken wollen, für die Psycho-Reparatur.«
Connors klopfte dem Unteroffizier auf die Schulter und erwiderte: »Ich bin sicher, dass Sie wiederkommen, Bob.«
»Aber bin das dann immer noch ich?« Duncan rannen die Tränen über sein ausdrucksloses, lebloses Gesicht.
»Herrgott … das weiß ich auch nicht, Bob. Ich kann Ihnen nur sagen, dass mich der Tank innerlich nicht verändert hat.«
»Mich auch nicht, Sergeant Duncan«, fügte Martinez hinzu, dem die Tränen peinlich waren, die er bei dem Jungen gesehen hatte. Martinez wusste, dass Duncan sich an die Tränen erinnern würde und sich noch lange, nachdem er und der Skipper sie vergessen hatten, dafür schämen würde. »Ich bin als ebenso guter Marine wieder herausgekommen wie ich hineingestiegen bin … bloß jünger, stärker und gesünder.
Übrigens, Skipper«, meinte Martinez und wandte sich von Duncans tränenüberströmten Gesicht ab, »was haben Sie denn vor der Runderneuerung gemacht? Ich war vor dem Ruhestand Gunny bei der Infanterie und hab in Jacksonville, North Carolina, herumgehockt und mich gelangweilt … und aufs Sterben gewartet.«
»Oh, als ich die Army verließ, hab ich’ne Menge Scheiß gebaut, Top. Oder haben Sie gemeint, was ich bei der Army gemacht habe? Ich war ein SBT.«
»Was ist das, ein SBT?«
Connors lächelte. »Ein SBT ist ein saublöder Tanker, Top.«
»Und wieso sind Sie dann zur Infanterie gekommen, Sir?«, fragte Duncan und zeigte damit zum ersten Mal etwas Interesse an seiner Umgebung.
»Ich kann diese verdammten Verbrennungsmotoren nicht leiden, Sergeant Duncan. Mir wird da immer speiübel. Als die mich also runderneuert hatten und mich auf die Offiziersschule geschickt haben, ob es mir nun gepasst hat oder nicht, habe ich mir den Arsch aufgerissen, um nach dem Abschluss eine Chance zu haben. Und dann habe ich mich für die Mobile Infantry entschieden, um bloß ja nicht wieder in einen Tank steigen zu müssen.«
Duncan wiegte den Kopf leicht von links nach rechts, und das war ein wesentlich deutlicheres Lebenszeichen, als er eine ganze Weile gezeigt hatte. »Okay … das könnte ich mir auch vorstellen.«
Erdorbit, Indowy-Frachter Selbstlose Einigung
»Zeig mir meine E-Mails, AID«, befahl Connors, jetzt alleine in seiner engen Kabine an Bord des Schiffs.
Die Kabine war etwa zwei Meter siebzig lang und einen Meter achtzig breit, und die Decke war so niedrig, dass Connors den Kopf einziehen musste, wenn er aufstehen wollte, um sich die Beine zu vertreten. Das Bett war aus der Wand geklappt, und ein Klapptisch diente als Schreibtisch, auf dem jetzt das AID lag, eine schwarze Box, etwa so groß wie ein Päckchen Zigaretten.
Das AID sagte gar nichts. Und ebenso wenig erschienen holografisch E-Mails.
»AID?«, wiederholte Connors, und seine Stimme klang jetzt leicht verärgert.
»Die wollen Sie nicht sehen«, antwortete der Apparat entschieden.
»Sag mir nicht, was ich will«, brauste Connors auf und spürte, wie ihm das Blut in den Kopf stieg. »Gib mir einfach die verdammte Post.«
»Captain …«
»Sieh mal, AID, ich hab von meiner Frau kein Wort mehr gehört, seit wir Barwhon verlassen haben. Gib mir einfach meine Post.«
»Also gut, Captain.« Im gleichen Augenblick erschien die E-Mail-Liste als Projektion über dem Schreibtisch.
Connors stellte überrascht fest, dass da nur ein einziger Brief von seiner Frau war. Er öffnete ihn und fing an zu lesen. Er war kurz, bloß fünf Zeilen. Aber wie viele Einzelheiten braucht es schon, um einem zu sagen, dass die eigene Frau von einem anderen Mann schwanger ist und die Scheidung eingereicht hat?
POSLEEN-INTERMEZZO
Die äußeren Verteidigungsanlagen der Stadt waren jetzt im Begriff, in sich zusammenzubrechen, Guanamarioch spürte das. Der Kampflärm – das Donnern der Railguns, das Zischen der Bomasäbel, die Schreie der Verwundeten und der Sterbenden – rückten näher.
Er empfand etwas Neid für jene Kessentai, die dazu auserwählt worden waren, zurückzubleiben und den Rückzug zu den Schiffen und deren Beladung zu sichern. Die Schiffe würden den Clan in ihre neue Heimat tragen. Ihre Namen waren in den Schriftrollen der Erinnerung aufgezeichnet und würden in regelmäßigen Abständen verlesen werden, um das Volk an sein Opfer zu erinnern. Das war das höchste Maß an Unsterblichkeit, das die Po’oslena’ar, das Volk der Schiffe, sich je erhoffen konnte.
Aber anstatt sein Oolt in den Kampf zu führen, führte Guanamarioch sie in seinem Tenar in einer Kolonne, die hundert Posleen tief und vier breit war, zu dem wartenden Schiff. Andere Oolt’os bildeten in ähnlicher Weise lange Marschkolonnen vom Rand der Stadt bis zu dem mit massiven Verteidigungsanlagen versehenen Weltraumhafen.
Der für die Beladung zuständige Kenstain wies Guanamarioch ungeduldig an, seine Schützlinge zu einem bestimmten Schiff zu führen und es an einem bestimmten Tor zu besteigen.
»Und beeil dich«, forderte der Kenstain. »Es ist wenig Zeit, die Schiffe müssen starten.«
Unter normalen Umständen hätte der Kessentai dem Kenstain für diese Unverschämtheit den Kopf abgeschlagen, aber dies war eine Zeit der Verzweiflung, eine Zeit, in der man über geringfügige Unbotmäßigkeiten hinwegsehen musste. Und so führte der Gottkönig auf seinem Tenar seine Normalen gehorsam zu dem ihm bezeichneten Schiff.
Am Schiff wies ein anderer Kenstain Cosslain – eine mutierte Normalenart, die beinahe vernunftbegabt waren – an, Guanamariochs Tenar zu übernehmen und zu verstauen. Der Gottkönig entfernte seine KI aus dem Tenar, hängte sie sich um den Hals und überließ es dem Cosslain, den Flugschlitten wegzubringen.
»Lord«, sagte der Kastellan, »dein Oolt ist das letzte für dieses Schiff. Der Platz für dich und deine Leute ist vorbereitet. Anweisungen sind auf deine Künstliche Intelligenz heruntergeladen worden. Befolge sie, verstaue die Normalen und melde dich dann beim Captain des Schiffs.«
»Wirst du dann auch an Bord gehen?«, fragte Guanamarioch.
Der Kenstain schüttelte den Kopf, vielleicht ein wenig bedrückt.
»Nein, Lord«, antwortete er, wobei seine Zähne in einem traurigen Lächeln sichtbar wurden, und seine gelben Augen blickten noch trauriger. »Ich werde hier bleiben und weiterhin Schiffe beladen, bis es entweder keine Schiffe mehr gibt oder keine Passagiere mehr … oder bis der Feind das letzte Schiff überrannt hat, mit dessen Ladung wir noch beginnen konnten.«
Der Gottkönig hob ein Greifglied und legte es dem Kastellan voll Wärme auf die Schulter. »Dann wünsche ich dir viel Glück, Kenstain.«
»Das, Lord, werde ich bestimmt nicht haben. Es gibt Schlimmeres, als dabei zu sterben, wenn man sein eigenes Volk rettet.«
»Dies ist so«, pflichtete Guanamarioch ihm bei.
2
»Die Vereinigten Staaten und Panama sind Partner in einem großen Werk, das jetzt auf dem Isthmus geschaffen wird. In diesem Unterfangen sind wir gemeinsam Treuhänder für die ganze Welt.«
Präsident Theodore Roosevelt, 1906
Panama
Das Land lag in einer Art femininer S-Kurve da, die sich von West nach Ost erstreckte und den Norden und den Süden des amerikanischen Kontinents miteinander verband. An der Grenze mit Costa Rica beginnend, verlief die Kurve ein Drittel der Strecke mehr oder weniger in ostsüdöstlicher Richtung. Von seiner Grenze mit Kolumbien aus erstreckte sich das Land andererseits im dichten und beinahe undurchdringlichen Dschungel des Darién ein Drittel der Strecke in westnordwestlicher Richtung. Die Taille des Landes, ebenso feminin und schmal, verlief vom Rumpf – der in den Pazifik hinausragenden Peninsula de Azuero – dann ostnordöstlich, und traf dort auf das Land, das von der kolumbianischen Grenze ein Drittel der Gesamtlänge Panamas hinaufreichte.
Eine Bergkette verlief wie ein Rückgrat durch die Landesmitte und wurde nur von wenigen Pässen und noch weniger Straßen überquert. Im Norden dieses Rückgrats, der Cordillera Central, gab es überwiegend Dschungel und nur wenige Städte und Ortschaften. Der Südteil des Landes, zumindest von der costaricanischen Grenze bis zu der schmalen Taille, bestand hauptsächlich aus Weide- und Ackerland. Zwei Durchgangsstraßen, die Panamericana, die überwiegend parallel zur Cordillera auf deren Südseite verlief, und die Inter-American, die die wesentlich kürzere Entfernung von Panama City im Süden nach Colon im Norden überbrückte, erschlossen das Land dem Verkehr.
Mehr als die Hälfte der Bewohner des Landes lebten in den zwei Provinzen von Colon (eine knappe halbe Million) und Panama (etwa eineinhalb Millionen). Die übrigen Panamaer wohnten meist nahe an der Panamericana-Fernstraße zwischen Panama City und der Grenze von Costa Rica südlich der Cordillera Central.
Die Fernstraße zwischen Colon und Panama war nicht die einzige Verbindung zwischen den beiden Städten. Colon grenzte im Norden an das Karibische Meer, Panama City schmiegte sich im Süden an den Pazifik. Dazwischen verband, einem schmaler Gürtel um die schlanke Taille einer Frau gleich, eine künstliche Wasserstraße Colon und Panama City miteinander – eine Verbindung zwischen dem Atlantischen und Pazifischen Ozean und damit der Welt.
Der Panamakanal.
Man hatte ihn durch eine smaragdgrün schimmernde Hölle aus dem lebenden Felsgestein gegraben. Für jeden Meter des Kanals waren zu Hunderten Männer gestorben; an Fieber, an Felsrutschen, an der Malaria, an einem Dutzend Tropenkrankheiten, für die sie keine Heilmittel besaßen und ursprünglich auch kaum Abwehrkräfte. Und auch am Alkohol waren sie gestorben, der sie für das Elend ihrer Umgebung unempfindlich machte.
Einem Versuch der Zähmung hatte sich der Kanal mit Erfolg widersetzt, hatte die Männer zerbrochen, sie zerkaut und ihre Leichen ausgespien und sie verrotten lassen. Die Skelette ihrer verrosteten Maschinen, von Lianen überwuchert und halb im Boden versunken und über die Dschungellandschaft verstreut, erinnerten immer noch daran. Doch die Menschen waren hartnäckig und entschlossen und hatten am Ende gesiegt.
Zwei Generationen lang war der Kanal der strategisch wichtigste Streifen Land der ganzen Welt gewesen. Der Handel aller Kontinente und zahlloser weniger wichtigen Inseln verlief durch ihn, machte ihn zu einer Schlagader des Handels. Die Nation, die den Kanal besaß, hatte die Meere mit der Macht des Handels und mit der Macht des Krieges beherrscht.
Sechshundert Liter Wasser pro Quadratmeter und Jahr reichten gerade aus, um den Durst des Kanals zu stillen. Eine kleine Flotte von Baggern reichte gerade aus, um den Kanal von dem Schlick freizuhalten, den der Regen ständig hineinspülte. Während der Blütezeit des Kanals gab es für siebzigtausend menschliche Wesen kein wichtigeres Ziel im Leben, als dem Kanal zu dienen und ihn zu verteidigen.
Und so alt und verblichen der Kanal auch sein mochte, er blieb doch eine Schönheit.
Aber seine Blütezeit war vorbei. Die Nation, die den Kanal gebaut hatte, hatte das Interesse an ihm verloren, seit die größten Kriegs- und Handelsschiffe für ihn zu groß geworden waren und seit das Volk und die Nation, in der er beheimatet war, die Beleidigung ihrer Souveränität immer weniger ertragen konnte, die darin bestand, dass er Ausländern gehörte. Doch in Wahrheit war die Sicherheit, die der Kanal versinnbildlicht hatte oder zumindest dem Anschein nach versinnbildlicht hatte, einigermaßen überflüssig geworden, seit die großen Feinde – Nazis, Faschisten und Kommunisten – gestürzt waren.
Aber die Zeiten ändern sich. Wahrnehmungen ändern sich.
Pentagon
Tief in den Eingeweiden des »Rätselpalastes«, in einem Raum, von dessen Existenz nur wenige wussten und den noch weniger je besuchten, blickte ein besorgter Mann über die Köpfe von Reihen uniformierter Männer und Frauen, die an ihren Computerterminals saßen, auf eine elektronische Karte der Welt, die auf einem großen Plasmabildschirm leuchtete. In dem Raum gab es drei solcher Bildschirme. Rechts von der Weltkarte war eine Karte der Kontinentalen Vereinigten Staaten und des restlichen Nord-Amerika abgebildet; zur Linken, von einem komplizierten Computerprogramm erzeugt, markierte eine Tabellengrafik den zu erwartenden Rückgang des Welthandels unter dem Einfluss der Posleen-Invasion.
»Wir sind einfach erledigt«, verkündete der Mann, ein zurückgerufener Drei-Sterne-General mit erheblicher Erfahrung in komplizierten Logistikoperationen und wenig Gefühl für den Handel.
Und dann wiederholte er überflüssigerweise »erledigt«.
Während der General auf den Bildschirm sah, weitete sich ein roter Fleck über die Mitte des Bildschirms zur Rechten aus. Und gleichzeitig mit seiner Ausweitung sanken die Zahlen auf der Tabelle, und einige davon wechselten die Farbe, von Grün nach Blau nach Rot und schließlich nach Schwarz. In ein paar Fällen sanken die Zahlen auf null ab und begannen eindringlich zu blinken.
»Wir werden fast verhungern«, murmelte der General zu niemandem Bestimmten. »Selbst mit den GalTech-Lebensmittel-Synthesizern werden wir immer noch verdammt hungrig sein.«
Plötzlich – das Programm arbeitete schneller als Echtzeit – quoll ein kleinerer Fleck in Zentralamerika ost- und südwärts und durchschnitt den Panamakanal. Binnen Sekunden sackte jede einzelne Kategorie auf der Tabellengrafik zur Linken in die Tiefe. Das Bild war jetzt eine Art »Weltuntergangs«-Weihnachtsbaum mit pulsierenden schwarzen Zahlen und Buchstaben.
Ein roter Finger zuckte von Montana nordwärts und zog sich dann wieder südwärts zurück. »Die haben gerade die kanadische transkontinentale Zugverbindung unterbrochen«, verkündete ein Funktionär von seinem Platz hinter seinem eigenen Computer aus.
Augenblicke später fand eine weitere Landung zwischen Belleville und Kingston, Ontario, statt. Die Markierung breitete sich aus. Weitere Finger stießen nach Norden, Osten und Westen vor. Schwarze Punkte erschienen über kritischen Schleusen entlang dem dortigen Kanalsystem.
Eine weitere Landung fand in der Nähe von Saint Catherine, Ontario, statt. Der Welland-Kanal, eine wichtige Verbindung zwischen den inneren Großen Seen und den östlichen Städten Kanadas und der Vereinigten Staaten, wurde schwarz. Ein Verbindungsoffizier der kanadischen Streitkräfte wurde bleich, als die Streitkräfte seines Landes – seit Jahrzehnten bis zur Unkenntlichkeit geschwächt, die Folge einer Mischung aus Vernachlässigung, aktiver Feindseligkeit und Speichelleckerei gegenüber den Vereinten Nationen – immer dünner wurden, schließlich auf dem Bildschirm nur noch einen Schemen darstellten und dann völlig verschwanden.
»Arbeit einstellen«, verkündete der General. »Neu booten. Lagebesprechung in einer halben Stunde.« Die Bildschirme verloschen.
»Ladys, Gentlemen. Ich werde jetzt den Chef aufsuchen.«
Weißes Haus, Washington DC
»Also, können wir dann den Kanal halten, General?«, fragte der Präsident der Vereinigten Staaten den hünenhaften schwarzen Vier-Sterne-General mit der spiegelglatten Glatze, der ihm gegenüber im Oval Office in einem Ledersessel saß.
Der General war groß – riesig, um es genau zu sagen – und besaß so viele Orden, Abzeichen und Kampfspangen, dass er ein paar weggelassen hatte, sonst hätte der ganze Obstsalat selbst auf seinem mächtigen Brustkasten nicht Platz gehabt. Links von General Taylor saß eine sichtlich erregte Frau vom Außenministerium. Die Frau war … streng gekleidet, dachte der General. Eine bessere Formulierung fiel ihm nicht ein.
»Schwer zu sagen, Mr. President«, antwortete der General. »Wir haben keine Soldaten dafür übrig, jedenfalls nicht genug. Neun Divisionen? Zwei oder drei Armeekorps? Im Zweiten Weltkrieg hatten wir dort siebzigtausend Soldaten stationiert und dachten, das würde reichen. Aber diese siebzigtausend hätten schlimmstenfalls – im absolut schlimmsten Fall – einen japanischen Angriff von nicht wesentlich größerer Mannschaftsstärke aufhalten müssen, Einheiten am äußersten Ende einer langen und recht brüchigen logistischen Pipeline und gegen eine der größten Konzentrationen von Küstenartillerie und Luftstreitkräften auf der ganzen Welt. Und darüber hinaus hätten wir einen gewaltigen technologischen Vorteil und kurze Nachschubwege auf Straße, Schiene, in der Luft und auf See gehabt. Jetzt allerdings haben wir keinen dieser Vorteile.«
»Was können wir dann tun?«, fragte der Präsident mit besorgter Miene. Er hatte die Berichte von den Simulationen in den Tiefen des Pentagons gelesen.
»Wir können vielleicht eine Division erübrigen, Mr. President, ein paar Schiffe für die Artillerieunterstützung, ein wenig Artillerie zur Abwehr von Landern und vielleicht ein paar planetarische Verteidigungsstützpunkte. Vielleicht.«
»Aber das wird nicht genug sein?«, fragte der Präsident müde. In letzter Zeit war er immer müde. So viel zu tun … so viel … und so wenig Zeit. Scheiße.
»Nee«, sagte der General mit einem unergründlichen Lächeln. »Die Panamaer werden sich größtenteils selbst verteidigen müssen.«
»Was haben die denn?«
Der General zuckte die Achseln. Es war sein Job, Ruhe und Gelassenheit auszustrahlen, und darauf verstand er sich sehr gut. »Nicht viel. Ein Dutzend Kompanien Militärpolizei. Einige Veteranen aus der Zeit, wo sie noch so etwas wie eine Armee hatten, aber die war selbst damals winzig, etwa Brigadestärke. Eine ganze Anzahl amerikanischer Veteranen, die sich im Laufe der letzten fünfzig Jahre dort niedergelassen haben. Aber sie haben keine nennenswerte Industrie; Panama ist eine reine Dienstleistungswirtschaft. Keine lange militärische Tradition, und was sie davon haben, ist nicht gerade eine Tradition des Erfolgs. Ich glaube, die letzte Schlacht, die sie gewonnen haben, war gegen Sir Francis Drake. Obwohl es ehrlich gesagt schon eine Leistung war, Sir Francis zu schlagen.«
Taylor hielt kurz inne und fuhr dann fort: »Sie erzeugen eine Menge Lebensmittel und könnten noch mehr erzeugen. Ihre Frauen sind verdammt fruchtbar; die Hälfte der Bevölkerung ist unter fünfundzwanzig.« Der General lächelte, alte, angenehme Erinnerungen stiegen in ihm auf: Und verdammt schöne Frauen sind das, ganz anders als diese armselige Tante aus dem Außenministerium. »Die Schulbildung dort ist ausgezeichnet, übrigens deutlich besser als die bei uns. Sie arbeiten hart … wenn es Arbeit gibt. Die Arbeitslosigkeit ist hoch, etwa fünfzehn Prozent, aber das liegt noch ein gutes Stück unter dem allgemeinen Niveau von Lateinamerika. Das Gute daran ist, dass der Großteil der Arbeitslosen junge Männer sind, mit anderen Worten reichlich Kanonenfutter. Aber die haben natürlich keine Chance, sie auszubilden und auch nicht das Geld, um sie auszurüsten.«
Ein Wort kam dem Präsidenten in den Sinn, ohne dass er danach gesucht hätte. Teuer.
»Regierung?«, fragte der Präsident.
Der General schob die rechte Augenbraue hoch und sah zu der Frau links von ihm hinüber. Bei näherer Betrachtung änderte er seine Ansicht. Eigentlich sah sie ja gar nicht schlecht aus. Zumindest, wenn sie sich mehr wie eine Frau kleiden und mehr Sorgfalt auf ihr Gesicht und ihr Haar verwenden würde. Ein bisschen mager, na ja. Ob in Washington Titten vielleicht unwichtig geworden sind?
Ihre Antwort kam etwas widerstrebend: »Wie in ganz Lateinamerika, Mr. President. Eine Kleptokratie, die von etwa hundert untereinander verwandten Familien geführt wird. Von außen sieht das einigermaßen demokratisch aus. Und es ist ja nicht so, dass sie ihre Wahlen tatsächlich fälschen. Aber die Regierung wird immer von diesen Familien dominiert, und Entscheidungen basieren nahezu ausnahmslos auf Schmiergeld- und Familieninteressen. Die einzigen nachhaltigen Ausnahmen von dieser Regel waren immer dann, wenn ein Diktator das Sagen hatte … und auch das war nie viel mehr als eine teilweise Ausnahme. Die Diktatoren waren im Allgemeinen auch korrupt.«
»Ha!«, rief Taylor. »Eine ehrliche Antwort aus dem Außenamt. Wer hätte das gedacht?«
Der Präsident ignorierte die Spitze. »Was halten sie von uns?«, fragte er die Vertreterin des Außenministeriums.
Sie brauchte nicht in ihre Notizen zu sehen; schließlich war sie im Außenamt für die Republik Panama zuständig.
»Gemischt, Mr. President«, sagte sie. »Einige von ihnen sind immer noch verstimmt, weil wir einmal die Kanalzone besetzt hatten. Häufig mischt sich darunter allgemeine Abneigung gegen Gringos, wie man sie überall in Lateinamerika finden kann. Andererseits sind die Panamaer mehr ›Gringo‹ als die meisten anderen Latinos. Eine ganze Menge von ihnen spricht wenigstens etwas Englisch. Viele von ihnen sprechen übrigens ebenso gut Englisch wie Sie oder ich. Ihre Gesetze lassen unseren Einfluss erkennen. Ihre Kultur ist … nun ja, manche würden sagen ›stark kontaminiert‹ … aber, wie auch immer, sie ist jedenfalls stark von der unseren beeinflusst. In mancher Hinsicht ist Panama amerikanischer als Puerto Rico.«
»Hätten sie Einwände, wenn wir zurückkehren?«, fragte der Präsident.
»Einige ganz bestimmt, Sir«, antwortete das Außenamt. »Sir … darf ich Ihnen vielleicht einen kurzen Abriss der Geschichte Panamas und des Panamakanals vortragen?«
Der Präsident nickte; er wusste ebenso wenig über Lateinamerika wie praktisch jeder Präsident in der Geschichte der Vereinigten Staaten vor ihm. Und das war im Allgemeinen wirklich sehr wenig.
Die Frau vom Außenamt sah sich in dem opulenten Büro um und sammelte kurz ihre Gedanken.
»Panama war einmal sehr reich«, begann sie. »Der Reichtum war derselben geografischen Eigenheit zu verdanken, der dem Land heute zu einem der höchsten Lebensstandards in Lateinamerika verholfen hat, die Schmalheit des Isthmus selbst und das, was das für den Handel bedeutet. In der Vergangenheit, in der Audencia von Panama, wanderte praktisch alles Gold und Silber von Mexiko und Peru durch Panama, ehe es nach Spanien verschifft wurde. Es wurde per Schiff nach Panama City gebracht und anschließend auf dem Rücken von Sklaven, Maultieren und Burros nach Portobello an der Karibik geschleppt. Mr. President, damals kamen dort so ungeheuere Reichtümer durch, dass die Lagerräume nur für das Gold ausreichten, das Silber musste auf den Straßen gelagert werden. Und außerdem diente die Audencia als Knotenpunkt für das Sklavenkartell.«
Sie zögerte, sichtlich besorgt, den General zu beleidigen, ehe sie schließlich fortfuhr: »Die meisten Schwarzen in Lateinamerika außerhalb Brasiliens und der Karibikküste können ihre Vorfahren auf Leute zurückführen, die als Sklaven durch Panama hereinkamen.«
Der Präsident hob die rechte Hand und machte eine winkende Bewegung, zweimal, wie um zu sagen: Weiter bitte, zur Sache.
Und die Frau aus dem Außenamt fuhr fort: »Diese Schätze lockten Piraten an, hauptsächlich Englisch sprechende Piraten und immer unter englischem Kommando. Die berühmtesten davon, Sir Francis Drake und Sir Henry Morgan, in der angelsächsischen Welt Helden, aber für Panama leibhaftige Teufel. Portobello und Panama City wurden mehrere Male angegriffen. Beide Städte wurden erobert und geplündert, mit allem, was das bedeutet: Vergewaltigung, Raub, Brandschatzung, Folter, Mord. Ich habe den Eindruck, dass die Panamaer selbst gar nicht wissen, wie tiefe Narben diese weit zurückliegenden Ereignisse in ihrer kollektiven Psyche hinterlassen haben. Das Maß an Xenophobie, das dort herrscht, ist für ein im Allgemeinen kosmopolitisches und liebenswürdiges Volk wirklich bemerkenswert.«
Ihre rechte Hand bewegte sich ruckartig, als wollte sie etwas zerschneiden.
»Ich überspringe ein paar Jahrhunderte. Als das Spanische Imperium zerbrach, wurde Panama Teil Kolumbiens. Aber die Menschen dort haben sich selbst nie als Kolumbianer gesehen, sondern als Panamaer; einfach anders, mit anderen Wertvorstellungen und anderen Interessen. Während Kolumbien seinen Lebensunterhalt im Bergbau und Ackerbau fand, war Panama immer bewusst, dass es seine einmalige Lage – wiederum der Isthmus – für den Handel prädestiniert hat. Als Kolumbien vom Bürgerkrieg zwischen Liberalen und Konservativen zerrissen wurde, das war gegen Ende des 19. Jahrhunderts, breiteten sich die Kämpfe nach Panama aus. Aber während in Kolumbien selbst die Liberalen vernichtet wurden, haben sie in Panama gewonnen. Was der General über den letzten Kampf, den die Panamaer gewonnen haben, gesagt hat, war nicht richtig.«
Der General zuckte die Achseln. »Äh?«
»Jedenfalls war eine kolumbianische Expeditionstruppe auf dem Marsch, um die Rebellion zu zerschlagen, als wir uns eingeschaltet haben. Die Einzelheiten unserer Intervention sind zwar amüsant, aber nicht sehr wichtig. Lassen wir es dabei bewenden, dass wir interveniert haben und dass Panama auf unser Drängen seine Unabhängigkeit erklärt hat. Und dass sie sich sozusagen als implizite Bedingung für unsere Anerkennung und unseren Schutz bereit erklärt haben, die Kanalzone an uns abzutreten.«
Die Gesichtszüge der Frau aus dem Außenministerium nahmen einen leicht angewiderten Ausdruck an. »Mr. President, ich weiß nicht, wie ich das anders ausdrücken soll – wir haben sie ausgenutzt. Der Vertrag, der damals geschlossen wurde, war so unfair gegenüber Panama, dass selbst unser eigener Senat ursprünglich geneigt war, ihn abzulehnen.
Aber wir haben ihn letztlich ratifiziert, weil er uns zumindest das Recht verschafft hat, den Kanal zu bauen … und weil es niemanden gab, der tatsächlich eine fairere Übereinkunft vorgeschlagen hätte. Die Panamaer haben den Vertrag akzeptiert, mit vielen Vorbehalten – zähneknirschend, um es genau zu sagen -, weil wir ihnen sozusagen die Pistole an den Kopf hielten und sie keine andere Wahl hatten.«
Die Frau schüttelte bedauernd den Kopf. »Ich staune oft darüber, wie häufig ein langfristiges Problem in der Geschichte mit einem Mindestmaß von Großzügigkeit vor der Entstehung hätte vermieden werden können. Mit Ausnahme des Vertrags von Versailles gibt es dafür wahrscheinlich kein deutlicheres Beispiel als den ursprünglichen Panamakanal-Vertrag. So wie er angelegt war, konnten die Panamaer nie zufrieden sein, und zum Teil geht das noch auf die Xenophobie zurück, die sie von den englischen Piraten gelernt haben. Und wir selbst haben uns nie ganz wohl dabei gefühlt, die Bedingungen des Vertrages einzuhalten und zu verteidigen; so unfair war der. Wir haben ihn mehrere Male nachverhandelt, in dem Versuch, Panama gegenüber fairer zu sein, aber all die symbolische Fairness konnte die ursprüngliche Beleidigung nicht auslöschen, bis wir uns dann schließlich, wie es 1977 geschah, bereit erklärt haben, das Land zu verlassen.«
Der General räusperte sich. »Wir hätten einfach an dem Vertrag festhalten sollen, und zum Teufel mit Panama.«
Diesmal war es die Frau aus dem Außenamt, die die Achseln zuckte.
»Und heute sind wir fast völlig draußen«, schloss sie.
»Was ist übrig geblieben?«, wollte der Präsident wissen.
Taylor gab darauf die Antwort: »Wir hatten ein Bataillon Luftlandeinfanterie, das wir auf gepanzerte Kampfanzüge umgestellt haben, ehe wir es off-planet geschickt haben. Ich habe sie bereits nach Hause zurückbeordert; die sollten dort ohne Probleme einsetzbar sein, obwohl dieses Bataillon auf Barwhon einiges mitgemacht hat und neu aufgebaut werden muss. Dann wäre da eine Kompanie Special Forces, die überwiegend weiter im Süden im Anti-Rauschgift-Einsatz war. Und dann ist da noch eine kleine Transporteinheit für die Green Berets. Wir haben die Wartung unserer Anlagen dort auf ein Minimum zurückgeschraubt. Nicht einmal die Familien der Soldaten könnten wir unterbringen, weil der größte Teil der Wohnanlagen um ein Spottgeld an panamaische Regierungsfunktionäre verkauft wurde. Das gilt auch für die Zivilunterkünfte für die Leute, die den Kanal verwalten. Wir fangen wirklich praktisch bei null oder noch weniger an, Mr. President; selbst der größte Teil des nutzbaren trockengelegten Landes ist verkauft worden.«
Der Präsident saß einige Augenblicke lang stumm da, die Ellbogen auf dem Tisch und das Kinn in die Hände gestützt, und verdaute das Gehörte, dachte nach. Schließlich fragte er: »Was wird es kosten?«
Der General antwortete langsam und mit Bedacht. »Das kann ich nicht genau sagen, wir arbeiten noch daran. So wie es aussieht … der Unterhalt einer Division unserer eigenen Leute, dazu etwas Marineunterstützung; dreihunderttausend Panamaer, die wir ausbilden und mit Material versorgen müssen; der Wiederaufbau unserer Infrastruktur und die Errichtung einiger massiven Verteidigungsanlagen … nun ja, etwa einhundertsiebzig Milliarden Dollar, verteilt über sieben oder acht Jahre.«
Der Präsident seufzte. »Nicht gerade wenig.«
Taylors Züge wurden ernst. »Nein, Mr. President, nicht gerade wenig«, wiederholte er und nickte dann.
»Wie heißt doch dieser alte Spruch, General? ›Einen Krieg zu gewinnen kostet Millionen; einen zu verlieren kostet alles, was man hat.‹ Fahren Sie mit Ihrer Planung fort; gehen Sie davon aus, dass wir es tun. Ich werde mit Panama darüber reden, was die tun müssen, wenn sie überleben wollen.«
»Und wenn die nicht mitmachen wollen, Mr. President?«, fragte die Frau aus dem Außenamt.
»Sie werden mitmachen«, erklärte der Präsident schlicht.
Palacio de las Garzas, Präsidentenpalast Panama City, Panama
Der amerikanische Botschafter fand, und dies nicht zum ersten Mal, dass das Büro des Präsidenten der Republik einfach … geschmacklos … war. Zu viel Vergoldung, zu viele hässliche Gemälde. Kitsch.
Aber er war nicht hier, um seine Meinung zu Geschmacksfragen zu äußern. Der Botschafter war in das Büro des Präsidenten gekommen, um ein Ultimatum zu übergeben. Er hatte es übergeben, und bei jeder einzelnen Forderung war das Gesicht des Präsidenten ernster geworden.
Presidente de la Republica Guillermo Mercedes-Mendoza, kurz, rundlich, gut genährt und irgendwie schmierig wirkend, hörte dem Botschafter der Vereinigten Staaten scheinbar gefasst zu. Innerlich freilich kochte er. Diese gottverdammten Gringos.
Der Botschafter der Vereinigten Staaten war natürlich höflich, aber er wirkte auch sehr dezidiert: Panama hatte die Wahl, mit den Vereinigten Staaten zu kooperieren oder zuzusehen, wie die Kanalzone aufs Neue besetzt und wesentlich ausgeweitet wurde. In dem Fall mussten sie damit rechnen, dass mindestens die Hälfte der Bevölkerung der Republik unter direkte Kontrolle der USA kam.
»Sie lassen uns also die Wahl, nicht wahr?«, fragte Mercedes.
Der Botschafter blickte bedauernd, als er antwortete: »Wir haben keine Wahl, Señor Presidente. Für uns ist das eine Frage von Leben und Tod … für Sie übrigens auch. Wenn wir uns zusammentun, haben wir eine Chance zu überleben, getrennt können wir nur sterben. Es tut mir leid, es tut mir wirklich von ganzem Herzen leid, aber es gibt keine Wahl.«
Die falsche Gelassenheit wich aus dem Gesicht von Mercedes, und er musterte den Botschafter finster. Der dachte: Man kann es dem Mann ja kaum übelnehmen, wenn man ihm ein solches Ultimatum überreicht. Welcher Patriot könnte das ertragen?
Aber die finstere Miene von Mercedes war nicht etwa auf Patriotismus zurückzuführen. Er dachte vielmehr: Das hat mir gerade noch gefehlt, zwanzig- oder dreißigtausend Gringos, die überall rumschnüffeln und ein Beispiel – zumindest relativ - von Unbestechlichkeit geben und meine kolumbianischen »Geschäftsfreunde« beunruhigen. Und, was das Schlimmste ist, wir müssen die Wehrpflicht einführen und damit die Massen verärgern. Und die guten Familien werden davon auch nicht erbaut sein. Ich habe unmöglich genügend Offiziere für die Art von Armee, von der die sagen, dass wir sie aufstellen müssen und die sie bezahlen wollen, jedenfalls nicht ohne alle möglichen primitiven Bauern in Positionen zu bringen, wo sie etwas zu sagen haben.
»Schildern Sie mir noch einmal die Einzelheiten«, verlangte Mercedes.
Der Botschafter nickte und erklärte dann: »Sehr wohl, Señor Presidente. Zuerst müssen Sie dafür sorgen, dass die Gesetze erlassen werden, in denen wir gebeten – nein, in denen Sie von uns verlangen -, dass wir Ihnen gemäß dem Carter-Torrijos Vertrag von 1977 Hilfe leisten. Aus PR-Gründen ziehen wir es vor, dass das von Ihnen kommt. Gleichzeitig müssen Sie dafür sorgen, dass Ihre Gesetze uns die Benutzung der Anlagen, die wir benötigen, wieder gestatten, kurzzeitig gestatten, also für die Dauer des Notstandes.«
»Und was soll ich mit den Leuten machen, die die Anlagen bereits gekauft haben? Hm?«
Der Botschafter antwortete mit liebenswürdiger Miene: »Die Vereinigten Staaten sind bereit, dafür in vernünftigem Maße Pachtgebühren zu bezahlen, jedoch keine übertriebenen Beträge. Das gilt allerdings nur für Privatpersonen. Wir erwarten, dass uns im Besitz der Regierung von Panama befindliches Land gratis für Bebauung, Ausbildung und Einsatz zur Verfügung gestellt wird. Wir erwarten auch, dass ab sofort keine Besitzübertragungen an Privatpersonen mehr stattfinden. Unser Präsident hat sich in diesem Punkt sehr eindeutig ausgesprochen, Mr. President: Sie werden nicht mit irgendwelchen Tricks die Mieten für uns erhöhen. Außerdem erwarten wir, dass die Regierung von Panama von uns benötigtes Land den Unternehmen, die es jetzt kontrollieren, wegnimmt und uns seine Nutzung erlaubt. Auf einem Teil des Geländes werden dauerhafte Befestigungsanlagen gebaut werden. Betrachten Sie das Ganze als eine Art umgekehrtes Pacht-Leih-Verfahren, ähnlich den Vereinbarungen, die die Vereinigten Staaten im Zweiten Weltkrieg mit Großbritannien, Australien und Neuseeland getroffen haben … und übrigens auch hier in Panama, insbesondere auf der Isla del Rey, San José Island und bei Rio Hato.«
Mercedes’ Schweinsaugen zogen sich noch weiter zusammen. »Und Sie werden unsere Soldaten bezahlen und dafür sorgen, dass sie ausgebildet und mit Waffen ausgestattet werden?«
»Wir werden etwas bezahlen … sogar recht viel. Aber nicht alles, Señor Presidente«, antwortete der Botschafter. »Panama wird einen fairen Anteil davon tragen müssen. Aber machen Sie sich wegen der Kosten keine zu großen Sorgen, Ihre Regierung wird in den nächsten Jahren mit Kanalzöllen ein Vermögen verdienen.«
Wieder verfinsterte sich Mercedes’ Blick, doch dann hellten sich seine Züge gleich wieder auf. Die Gringos werden eine Menge bauen, aber vermutlich werden sie nicht viel Baukapazität übrig haben. Das bedeutet Profit für die richtigen Familien. Und wenn sie Baufirmen hierher schicken? Mein Gott, das wird dann eine Goldgrube für die Familien und für mich selbst: Baugenehmigungen, Beratungsgebühren … da fällt mir ein, ich sollte doch für den wertlosen Bankert von Vetter Maritza einen einträglichen Job besorgen. So viel Geld hätte ich sonst nie verdienen können, nicht einmal mit Geldwäsche für die Kolumbianer.
Dem Botschafter entging der finstere Blick nicht, aber er deutete ihn völlig falsch und spielte seinen letzten Trumpf aus. »Verjüngung für eine Anzahl wichtiger Panamaer wird selbstverständlich auch angeboten. Es gibt dafür ein paar unbequeme Vorschriften, aber der Ermessensspielraum dafür ist ziemlich groß.«
Mercedes tat so, als wäre die Aussicht auf erneuerte Jugend ohne Belang. In Gedanken malte sich el Presidente dabei den mutmaßlichen Ertrag aus und stellte ihn in Relation zu dem Obolus, den man ihm und seiner ausgedehnten Familie wahrscheinlich für ein Asyl off-planet abverlangen würde. Dann malte er sich genüsslich die Freuden zusätzlicher fünfzig Jahre aus, in denen er nicht nur seine eigene Jugend, sondern eine schier endlose Zahl junger Frauen würde genießen können, und erklärte schlicht: »Ich werde der Legislative die entsprechenden Vorschläge machen. In zehn Tagen … versprochen.«
David, Chiriqui, Republik Panama
Das Geräusch des angestrengt arbeitenden Sauerstoffapparats wurde vom Jammern eines halben Hunderts enger Verwandter fast übertönt. Dutzende weiterer Verwandter drängten sich in den Fluren außerhalb der antiseptisch riechenden grün getünchten Intensivstation, in der Digna Miranda, winzig und einhundertzwei Jahre alt, im Begriff war, von dieser Welt in die nächste zu gleiten. Dass sie winzig war, hatte nichts mit ihrem Alter zu tun. Digna war ihr ganzes Leben lang nicht größer als einen Meter fünfundvierzig gewesen.