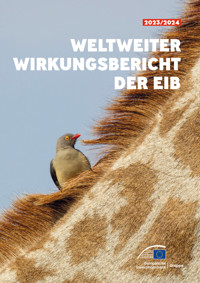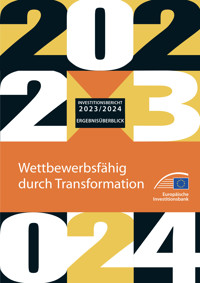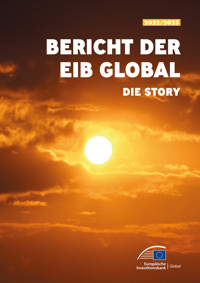Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: European Investment Bank
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Die Europäische Union muss ihre weltweite Führungsposition bei Technologien, Innovationen und sauberen Energien festigen. Wenn Europa die zentralen Herausforderungen angeht und seine Stärken nutzt, kann es wettbewerbsfähiger werden, das Wirtschaftswachstum steigern und der Welt zeigen, wie die Energiewende gelingen kann. Kurz gesagt, Europa muss: - Den EU-Binnenmarkt besser integrieren und den Zugang dazu vereinfachen. Der europäische Markt bietet viele Chancen, doch unterschiedliche Regeln und Strukturen machen es Unternehmen schwer, das volle Potenzial auszuschöpfen. Besonders innovative Firmen stoßen sich daran: Ganze 74 Prozent von ihnen sehen in widersprüchlichen Vorgaben das größte Hindernis für Wachstum. Weniger Bürokratie würde viel bewirken – aktuell verschlingen Vorschriften rund 1,8 Prozent des Umsatzes bei Unternehmen und sogar 2,5 Prozent bei kleinen und mittleren Betrieben. - In innovative junge Unternehmen und die digitale Transformation investieren. Europa verfügt über eine starke Forschungs- und Industriebasis, doch jungen, innovativen Firmen fällt es oft schwer, sich das nötige Kapital für ihre Expansion zu sichern. Auch bei Big Data und künstlicher Intelligenz besteht Nachholbedarf: Der Anteil europäischer Firmen, die diese Technologien nutzen, liegt sechs Prozentpunkte hinter den Vereinigten Staaten. Wer hier aufholt, kann seine Produktivität kräftig steigern. - Die grüne Wende vorantreiben. Europa hat sich ehrgeizige Klimaziele gesetzt, doch es braucht einen realistischen, pragmatischen Fahrplan, damit Unternehmen die Chancen der grünen Transformation nutzen können. Die Energiewende ist in vollem Gange. 2024 deckten erneuerbare Energien fast die Hälfte (48 Prozent) des europäischen Strombedarfs, während die Emissionen durch die Stromerzeugung um 13 Prozent sanken. Europas Klimavorreiterrolle zahlt sich auch wirtschaftlich aus: Die Exporte von klimafreundlichen Technologien sind seit 2017 um 65 Prozent gestiegen. Zum Vergleich: China legte um 79 Prozent zu, die Vereinigten Staaten um 22 Prozent. Durch mehr Zusammenarbeit, gezielte Investitionen und einen kohärenten Regelungsrahmen kann Europa sein nachhaltiges Wachstum vorantreiben und seine Technologieführerschaft und wirtschaftliche Resilienz im immer härteren globalen Wettbewerb behaupten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 31
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Investitionsbericht 2024/25Zusammenfassung
Innovation Integration und Vereinfachung in Europa
Die Europäische Investitionsbank
Die Europäische Investitionsbank-Gruppe ist die Bank der EU und der größte multilaterale Kreditgeber der Welt. Wir finanzieren nachhaltige Investitionen in kleine und mittlere Unternehmen und in Innovation, Infrastruktur, Klima und Umwelt. Seit sechs Jahrzehnten fördern wir die Wirtschaft in Europa. In Krisen stehen wir mit der EU weit vorne, um zu helfen. Wir sind weltweit Vorreiter bei der Klimafinanzierung, und wir investierten in die Entwicklung des ersten Covid-19-Impfstoffs. Bis zum Ende des Jahrzehnts wollen wir Investitionen von einer Billion Euro für Klimaprojekte und ökologische Nachhaltigkeit anstoßen. Etwa zehn Prozent unserer Mittel fließen in Länder außerhalb der Europäischen Union: Mit unserem Geschäftsbereich EIB Global sind wir in den Nachbarländern Europas und weltweit aktiv.
Inhalt
Kernaussagen des Investitionsberichts 2024/25
Zusammenfassung: Marktintegration, Vereinfachung und umfangreiche Investitionen in Innovation
Die europäische Wirtschaft könnte wesentlich stärker in Innovation, Produktivität und Transformation investieren
Die Aussichten auf eine rasche Steigerung der Investitionen sind durchwachsen
Marktintegration
Europäische Unternehmen brauchen eine gewisse Marktgröße, um weltweit wettbewerbsfähig zu bleiben – und größere Kapitalmärkte, um das nötige Risikokapital für Innovationen zu mobilisieren
Vereinfachung verbessert Geschäftschancen
Bürokratiekosten belasten Unternehmen in der EU erheblich
Transformative Investitionen würden beträchtlich von einem Abbau von Hürden und europäischer Unterstützung profitieren
Auf Europas Stärken bauen
Eine starke Grundlage in Industrie, Forschung und Handel bietet die Chance, bei technischen Innovationen in Führung zu gehen und die Produktivität zu steigern
Europas Vorreiterrolle im Klimaschutz zahlt sich aus
Soziale Investitionen können sich wirtschaftlich rentieren und die nötigen Fähigkeiten für eine bessere Wettbewerbsfähigkeit aufbauen
Wirkung der öffentlichen Unterstützung maximieren
Zielgerichtete Instrumente und Koordinierung auf EU-Ebene verbessern die Wirkung
Über den Bericht
Der jährliche Bericht der EIB zur Investitionstätigkeit und Investitionsfinanzierung wird von der Abteilung Volkswirtschaft der EIB erstellt. Der Bericht gibt einen umfassenden Überblick, wie sich die Investitionen in der Europäischen Union entwickeln, was sie beeinflusst und wie sie finanziert werden. Wir analysieren darin die wichtigsten Markttrends und Entwicklungen – jedes Jahr mit einem besonderen Themenschwerpunkt, den wir genauer betrachten. In diesem Jahr liegt der Schwerpunkt auf Europas Fähigkeit, die nötigen Investitionen für die grüne Wende und für Innovationen zu mobilisieren. Der Bericht stützt sich weitgehend auf die Ergebnisse der jährlichen EIB-Investitionsumfrage (EIBIS) und der EIB-Umfrage unter Kommunen. Er verbindet die interne Analyse der EIB mit Beiträgen führender Fachleute auf diesem Gebiet.
Verantwortliche für den diesjährigen Bericht
Verantwortliche Direktorin
Debora Revoltella
Koordination und Prüfung
Laurent Maurin und Atanas Kolev
Beiträge
Kapitel 1: Andrea Brasili, Jochen Schanz (Hauptautoren), Tessa Bending, Giacomo Biolghini, Tran Thi Thu Huyen und Marcin Wolski. Dubravko Mihaljek (Kasten A). Koray Alper, Joana Conde, Pietro Dallari und Luca Gattini (Kasten B).
Kapitel 2: Atanas Kolev (Hauptautor), Andrea Brasili, Diana Lagravinese, Dubravko Mihaljek, Annamária Tüske, Georg Weiers und Wouter van der Wielen.
Kapitel 3: Laurent Maurin, Rozália Pál, Thi Thu Huyen Tran (Hauptautoren), Frank Betz, Antonia Botsari, Chiara Fratto, Salome Gvetadze, Frank Lang, Jochen Schanz und Annamária Tüske. Jose Miguel de Tertre (Europäische Kommission, Kasten A). Giorgio Presidente und Carlo Altomonte (Bocconi-Universität, Kasten C). Matteo Gatti und Wouter van der Wielen (Kasten D).
Kapitel 4: Michael Stemmer, Wouter van der Wielen (Hauptautoren), Tessa Bending, Frank Betz, Marnix Bosch, Chiara Fratto, Jochen Schanz, Emily Sinnott, Annamária Tüske, Marcin Wolski und Václav Žďárek. Nicholas Lazarou (Europäische Kommission, Gemeinsame Forschungsstelle, Kasten A). Carolina Herrero (Kasten B).
Kapitel 5: Julie Delanote, Péter Harasztosi, Christoph Weiss (Hauptautoren), Marine Charlotte André, Ea Dumancic, Bertrand Magné und Julie Callaert (Expertise Centre for Research and Development Monitoring an der KU Leuven), Péter Fákó, Ramón Compañó und James Gavigan (Europäische Kommission, Gemeinsame Forschungsstelle, Kasten A). Pierre Rousseaux (CREST, Kasten C).
Kapitel 6: