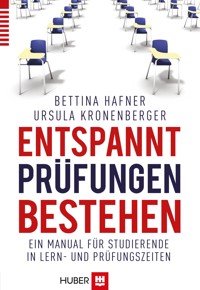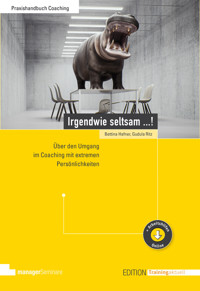
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: managerSeminare Verlags GmbH
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Immer wieder tauchen im Coaching Menschen mit mehr oder weniger stark ausgeprägten Persönlichkeitsstilen und womöglich sogar Störungen auf. Wenn Coachs die sich daraus ergebenden Verhaltensmuster und Dynamiken nicht erkennen, kann dies ungeahnte Folgen haben. Denn diese Klienten erzielen Wirkung beim Coach: Sie bringen ihn extrem ins Arbeiten, machen ihn wütend oder verunsichern ihn. Coachings laufen im schlimmsten Fall gegen die Wand. In diesem Buch stellen hierzu Therapeutinnen aus unterschiedlichen Schulen ihre Erfahrungen und ihr Wissen zur Verfügung. Sie wollen dafür sensibilisieren, wo Fallen im Coachingprozess lauern, wenn Menschen mit extremen Persönlichkeitsstilen vor ihnen sitzen. Und sie geben Methoden an die Hand, wie mit bestimmten Auffälligkeiten hilfreich umgegangen werden kann und wo Grenzen erreicht sind. Dies wird anhand von Interviews und konkreten Fallbeispielen praxisnah illustriert. Mit ergänzenden Online-Arbeitshilfen zum Download
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 422
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bettina Hafner und Gudula Ritz
Irgendwie seltsam …!
Über den Umgang im Coaching mit extremen Persönlichkeiten
managerSeminare Verlags GmbH – Edition Training aktuell
Bettina Hafner, Gudula Ritz
Irgendwie seltsam …!
Über den Umgang im Coaching mit extremen Persönlichkeiten
© 2020 managerSeminare Verlags GmbH
2. Aufl. 2022
Endenicher Str. 41, D-53115 Bonn
Tel: 0228-977910
www.managerseminare.de/shop
Der Verlag hat sich bemüht, die Copyright-Inhaber aller verwendeten Zitate, Texte, Abbildungen und Illustrationen zu ermitteln. Sollten wir jemanden übersehen haben, so bitten wir den Copyright-Inhaber, sich mit uns in Verbindung zu setzen.
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und der Verbreitung sowie der Übersetzung vorbehalten.
Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.
ISBN: 978-3-98856-257-9
Herausgeber der Edition Training aktuell:
Ralf Muskatewitz, Jürgen Graf, Nicole Bußmann
Lektorat und Satz: Vera Sleeking
Zeichnungen: Stephan Pflaum
Cover: ©iStock/gremlin
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH, Rudolstadt
Ihre Download-RessourcenBegleitend zum Buch stehen Ihnen Arbeitshilfen für die persönliche Verwendung zum Download im Internet zur Verfügung. Sie kön-nen die Vorlagen jederzeit in hoher Qualität abrufen und einsetzen.www.managerseminare.de/tmdl/k,278714
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Plädoyer für ein persönlichkeitsorientiertes Coaching
Ansatz und Aufbau dieses Buches
1. Coaching und extreme Persönlichkeitsstile
Coaching
Extreme Persönlichkeit und Persönlichkeitsstörungen
2. Das Vorgehen bei den einzelnen extremen Persönlichkeitsstilen: Cluster B
Cluster B: Narzissmus, Histrionische PKS und Borderline
Ehrgeiziger Stil und Narzisstische Persönlichkeit
Spontaner Stil und Borderline-Persönlichkeit
Liebenswürdiger Stil und Histrionische Persönlichkeit
3. Das Vorgehen bei den einzelnen extremen Persönlichkeitsstilen: Cluster C
Cluster C: Abhängige, selbstunsichere, passiv-aggressive, zwanghafte Persönlichkeit
Loyaler Stil und Abhängige Persönlichkeit
Selbstkritischer Stil und Selbstunsichere Persönlichkeit
Kritischer Stil und Passiv-Aggressive Persönlichkeit
Sorgfältiger Stil und Zwanghafte Persönlichkeit
4. Exkurs: Persönlichkeitspsychologie kompakt
Was ist und was macht Persönlichkeitspsychologie?
Historische Entwicklung der Persönlichkeitspsychologie
5. Exkurs: Die PSI-Theorie
Die PSI-Theorie als funktionsanalytische Meta-Perspektive
Selbststeuerung
Die vier Makrosysteme
Stile abbilden: STAR-Modell und Persönlichkeitstest
Was bedeutet dies für das Coachen extremer Stile?
Anhang
Literaturverzeichnis
Das Team hinter dem Buch
Stichwortverzeichnis
Plädoyer für ein persönlichkeitsorientiertes Coaching
Ein Klient kommt mit einem ganz klaren Ziel ins Coaching und der Arbeitsauftrag ist schnell gefunden. Er ist auch gerne bereit, die geeigneten Tools des Coachs auszuprobieren. Er ist aufmerksam und kooperativ, seine „Hausaufgaben“ zwischen den Sitzungen macht er zuverlässig und dem Erreichen seines Ziels scheint nichts im Wege zu stehen, doch … Jede Methode, die sonst wunderbar funktioniert, bringt diesen Klienten einfach nicht weiter. Alles hat er wirklich versucht, aber nichts funktioniert. Die ressourcenorientierten Methoden laufen bei diesem Klienten nach einem vielversprechenden Anlauf jedes Mal völlig ins Leere. Es ist … irgendwie seltsam.
Es kommt vor, dass im Coaching Menschen bei uns auftauchen, die uns verstören. Menschen, bei denen unsere sonst so hilfreichen Methoden kaum oder gar keine Wirkung zeigen, die vielleicht auch unangenehme Emotionen in uns auslösen. Wir als Coachs fühlen uns womöglich hilflos oder ratlos, fangen an, mit hoher Anstrengung nach Lösungen zu suchen oder werden sogar ärgerlich, weil wir uns sabotiert fühlen. Wir reagieren in jedem Fall anders als gewohnt auf diese Menschen mit extremen Stilen in unserem Praxisraum.
In der Coaching-Ausbildung wird üblicherweise gelernt: Coachs arbeiten mit „gesunden“ Menschen, zumindest gehört die „Heilung von Krankheiten“ nicht zu ihrem Arbeitsfeld. Therapie arbeitet mit psychisch stark belasteten Menschen oder bietet Personen therapeutische Hilfen an, die Störungen mit Krankheitswert aufweisen. Das klingt auf den ersten Blick einleuchtend – klar, für die Arbeit mit psychisch kranken Menschen haben Coachs ja im Regelfall auch gar nicht die Ausbildung. Sie sind ausgebildet, ihre Klienten dabei zu begleiten, ihre beruflichen Ziele zu erreichen, persönliche Ressourcen zu entdecken und zu entwickeln, persönliche Entscheidungen zu treffen, sich selbst besser kennenzulernen. Sie unterstützen ihre Klienten bei Themen wie: Wie komme ich auf der Karriereleiter weiter? Wie löse ich den Konflikt mit meinem Vorgesetzten? Für welches berufliche Angebot soll ich mich entscheiden? Das tun Coachs vor allem, indem sie die Ressourcen ihrer Klienten herausarbeiten, sie begleiten, eigene Ziele zu formulieren und Pläne zu entwickeln, diese Ziele zu erreichen. Sie verfügen über ein großes Repertoire an lösungsorientierten Methoden, ein systemisches Fragenset und Strategien, die Ressourcen und Fähigkeiten des Klienten herauszuarbeiten und für berufliche Herausforderungen nutzbar zu machen. Soweit zur Definition des Arbeitsfels Coachings. In den allermeisten Coaching-Ausbildungen sind die Themen Persönlichkeitspsychologie und Persönlichkeitsstörungen nicht vorgesehen.
Und dennoch tauchen im Coaching Menschen mit mehr oder weniger stark ausgeprägten Persönlichkeitsstilen und womöglich sogar Persönlichkeitsstörungen auf. Wenn man überlegt, dass wir es bei Persönlichkeitsstörungen mit einer Prävalenz von zehn Prozent in der Allgemeinbevölkerung zu tun haben (Ritz-Schulte, 2001, 2005; Kuhl & Kazén, 2009), ist es nicht unwahrscheinlich, dass auch Menschen mit einer solchen Störung einmal im Coaching landen. Und daraus können sich solche Verhaltensmuster und Dynamiken ergeben, wie eingangs beschrieben. Wenn Coachs diese nicht erkennen und verstehen, kann dies ungewollte Folgen für das Coaching, für die Coachs und die Klienten haben. Denn diese Coachees erzielen auf verschiedenen Ebenen Wirkung beim Coach: Sie bringen ihn extrem ins Arbeiten, machen ihn wütend oder verunsichern ihn, die Coaching-Prozesse laufen nicht selten gegen die Wand.
Um die Persönlichkeit der Klienten berücksichtigen zu können, braucht es persönlichkeitspsychologische Grundkenntnisse. Das fängt schon mit der vorangestellten Vorstellung von „gesunden“ oder „kranken“ Persönlichkeiten an: Extreme Persönlichkeitsstile und Persönlichkeitsstörungen sind keine Krankheiten, es sind nur, wenn überhaupt, „Störungen“. Niemand geht zum Psychotherapeuten wegen einer Persönlichkeitsstörung! Menschen mit extremen Persönlichkeitsstilen haben in der Regel kein Bewusstsein darüber, dass ihr Verhalten und ihre Art, Beziehungen zu anderen zu gestalten, Kosten verursacht oder anders ausgedrückt: Probleme bereitet – für die Umwelt und für sie selbst. Sie erleben sich selbst gar nicht als gestört, man spricht bei diesem Phänomen auch von „Ich-Syntonie“. Das bedeutet, die extremen Persönlichkeitsmerkmale sind selbstverständlicher Teil der Persönlichkeit. Diese Klienten erleben sich und auch ihr Verhalten als völlig normal, nicht störend und zu ihnen gehörig.
Die Personen leiden also nicht unter ihrem extremen Persönlichkeitsstil, sondern eher unter den Folgen ihres Persönlichkeitsstils: häufiger Arbeitsplatzwechsel, Beziehungsschwierigkeiten, Suchtaffinität, Stimmungsschwankungen usw. – was wiederum Gründe sein können, ein Coaching aufzusuchen. Auch über den Chef können Aufträge kommen: Der Mitarbeiter soll beispielsweise weniger genau und somit zeitsparender arbeiten, entspannter bei Auftritten reagieren oder besser mit Stress umgehen.
Wer Verhaltensmuster extremer Stile kennt, erkennt und versteht, tappt nicht in die Falle, das übliche – aber in diesem Falle falsche – Methodenrepertoire einzusetzen. Mit einem Bewusstsein für die Dynamiken ist es möglich, auch bei solchen Klienten kleinschrittige Erfolge zu erzielen und Ressourcen und Kompetenzen für die Lösung ihrer Anliegen zu stärken. Und dann kann ein Coaching-Prozess im besten Fall ein erster Schritt sein, sich mit ihren dysfunktionalen Verhaltens- und Denkmustern zu beschäftigen und womöglich in einem tiefer gehenden Therapieprozess weiter zu bearbeiten.
Ansatz und Aufbau dieses Buches
Unser Anliegen ist es, die Persönlichkeitspsychologie auf wissenschaftlicher Basis und trotzdem anwendungsorientiert interessierten Coachs und Beratern näherzubringen. Dabei sind vor allem Theorien über extreme Persönlichkeiten interessant, die im therapeutischen Bereich auch als „Persönlichkeitsstörungen“ bezeichnet werden und die sich mit ihren Entwicklungsaufgaben schwerer tun als ausgeglichenere Persönlichkeiten. Wir wollen Coachs dafür sensibilisieren, wo Fallen im Coaching-Prozess lauern, wenn Menschen mit bestimmten extremen Persönlichkeitsstilen vor ihnen sitzen. Und wir geben Methoden an die Hand, wie mit bestimmten Auffälligkeiten umzugehen ist – damit der Coaching-Prozess für den Klienten hilfreich wird … und der Coach nicht verzweifelt.
Eine wichtige Basis für ein nachhaltiges Coaching ist dessen wissenschaftliche Fundierung, so Greif (2008) sowie Engel & Kuhl (2017). Das Auffinden einfacher Methoden und deren universelle Anwendung kann nicht die Grundlage eines Coachings mit professionellem Anspruch sein. Trotzdem ist das Auffinden einfacher Methoden nicht unmöglich, wenn man sich zunächst der Komplexität der individuellen Person und ihrer Lebenswelt annimmt. Anders gesagt: Mit den wesentlichen Grundkenntnissen können sich auch die einfachen Methoden aus dem Coaching-Methodenkoffer als die richtigen erweisen. Dieses Buch schreibt Coachs keine Methoden vor, sondern vermittelt ein Verständnis, das sie in ihrem Vorgehen und ihrer Methodenauswahl leitet und verhindert, dass sie in Fallen tappen.
In diesem Buch geht es also vor allem um die Funktionsebene, das heißt um die wissenschaftliche Begründung von Coaching-Maßnahmen bei „schwierigen“ Klienten sowie um die Erweiterung der Kenntnisse und des Grundlagenwissen das Thema Persönlichkeit betreffend.
Das erste Kapitel (S. 13 ff.) schafft Verständnisgrundlagen und diskutiert die Aspekte „Coaching“ und „Persönlichkeitsstörung“.
Im Hauptteil, dem zweiten (S. 49 ff.) und dritten Kapitel (S. 131 ff.), werden im Einzelnen die verschiedenen extremen Persönlichkeitsstile konkret beschrieben, die häufiger im Coaching auftauchen können. Es sind sieben Stile (nach DSM-Diagnostik), die durch Praxisbeispiele veranschaulicht werden. Dazu werden die möglichen Vorgehensweisen im Coaching erläutert. Reflektiert wird, was sowohl unter Passungs- als auch unter Enwicklungsgesichtspunkten förderlich oder hinderlich wirkt. Um die „Konfiguration der psychischen Systeme“ zu beschreiben, wird die PSI-Theorie verwendet, welche allgemeine Persönlichkeitspsychologie auf wissenschaftlicher Grundlage bietet und empirisch gestützt ist.
Um das nötige Grundlagenwissen zu fundieren, schließt sich an die anschauliche Darstellung der Stile eine Vertiefung an: Im vierten Kapitel (S. 223 ff.) wird der Kontext zum Thema Persönlichkeit und Persönlichkeitspsychologie vermittelt sowie im fünften Kapitel (S. 257 ff.) die PSI-Theorie, die inklusive des damit verbundenen Persönlichkeitsmodells und Persönlichkeitstests ausführlich erklärt wird.
Uns ist in der Darstellung des Themas wichtig, auch die unterschiedlichen Perspektiven fachlicher Richtungen einzubringen. Daher werden die Kapitel durch Interviews ergänzt: Kenntlich gemachte subjektive Stellungnahmen und Meinungen aus verschiedenen Fachrichtungen: Systemisches Coaching, Tiefenpsychologie, Psychotherapie, Verhaltenstherapie, persönlichkeitsorientierte Beratung, Systemische Therapie und psychosomatische Medizin. Die Interviews zeigen ein Spektrum in der Betrachtung extremer Persönlichkeitsstile und der Arbeit mit ihnen.
Ein Stichwortverzeichnis, ein Literaturverzeichnis und Angaben zu den an diesem Buch beteiligten Personen finden Sie im Anhang (s. S. 293 ff.).
Das nebenstehende Pfeilsymbol weist außerdem auf Download-Ressourcen hin, die zu diesem Buch heruntergeladen werden können. Den Link zu diesen Download-Ressourcen finden Sie in der inneren Umschlagklappe dieses Buches.
1. KAPITELCoaching und extreme Persönlichkeitsstile
INHALT
Coaching
Das Ziel des Coachings bei Menschen mit extremen Persönlichkeitsstilen
Typische Herausforderungen
Arbeit an der Beziehung
Die Ebenen des Coachings aus der Meta-Perspektive
Diagnose als Bestandteil von Coaching
Interview: Perspektiven auf Persönlichkeitsdiagnose und ihren Einsatz im Coaching
Auf den Punkt gebracht …
Extreme Persönlichkeit und Persönlichkeitsstörungen
Interview: Der Blick aus verschiedenen Fachrichtungen auf Entstehung und Charakterisierung der Stile
PSI-Theorie und STAR-Modell
Coaching
Wenn wir im Alltag von der „Persönlichkeit“ eines Menschen sprechen, dann beziehen wir uns auf seine charakteristische Art und Weise, zu handeln, Ereignisse wahrzunehmen und auf sie zu reagieren. „Persönlichkeit“ war bisher kein Thema im Coaching, zumindest nicht offiziell und in den eher methodisch orientierten Ansätzen. In der Praxis, z.B. beim Führungskräftecoaching, spielt die Persönlichkeit des Coachees zumindest implizit eine Rolle. Es gibt traditionelle Persönlichkeitstests, die mit mehr oder weniger ausgeprägter Coaching-Expertise angewendet werden, obwohl Persönlichkeitsdiagnostik eigentlich in psychologische Hände gehört. In der Psychotherapie und Beratung ist das anders, hier spielt die Persönlichkeit der Klienten seit Anbeginn eine explizit wichtige Rolle, sowohl in der Theorie als auch in der Praxis.
Bekommen wir es mit einer Dimension von Persönlichkeit zu tun, die von ausgeprägten Persönlichkeitsstilen über extreme Persönlichkeitsstile bis hin zu Persönlichkeitsstörungen reicht – dann wird Coaching wirksamer und nachhaltiger umgesetzt, wenn die Persönlichkeit des Klienten berücksichtigt wird. Dies gilt in zweierlei Hinsicht:
Rücksichten bei der Methodenauswahl
Zum einen unter dem Passungsgesichtspunktund zum anderen aus der Entwicklungsperspektive.Je extremer der Persönlichkeitsstil eines Coachees oder Klienten ist, umso bedeutsamer ist die Passung an die Klientenvoraussetzungen und umso schwerer hat es der Klient mit der Entwicklung von Selbststeuerungskompetenzen (s. S. 263 ff.).
Das Ziel des Coachings bei Menschen mit extremen Persönlichkeitsstilen
Motivation für ein Coaching
Kommen Klienten mit extremen Persönlichkeitsstilen zu uns ins Coaching, so können wir nicht davon ausgehen, dass die Motivation, sich zu ändern, vorhanden ist. Und zwar nicht, weil diese Klienten das nicht wollen, sondern weil sie kein Bewusstsein der Dysfunktionalität ihres Verhaltens und der damit verbundenen Konsequenzen haben (s. S. 52). Solche Klienten kommen deshalb auch per se nicht zu uns, weil sie ihr Beziehungsverhalten verändern wollen, sondern weil sie unter Symptomen leiden, die sich auf der Basis der Persönlichkeitsstörung entwickeln: Angstsymptome wie Prüfungs- und Auftrittsängste, Verstimmungen bis hin zu Depressionen oder Konflikte, die sich im beruflichen oder familiären Umfeld für sie ergeben. Für uns als Coachs bedeutet das, dass wir uns nicht wundern müssen, wenn der Klient in diesem Fall nicht mit uns ins zielorientierte Arbeiten einsteigt. Denn diese Klienten sind eben zunächst meist nicht änderungsmotiviert. Sie wünschen sich zwar, dass bestimmte Probleme behoben werden – zum Beispiel die Konflikte mit Kollegen – haben aber keine Einsicht, dass diese Probleme durch ihr eigenes Beziehungsverhalten ausgelöst werden. Der Selbstzugang von Menschen mit bestimmten extremen Persönlichkeitsstilen ist in der Regel nicht gut ausgeprägt, insbesondere Menschen mit einem narzisstischen Stil fällt die Selbstreflexion und das Gespür für sich selbst schwer.
Problembewusstsein
Der Coach hat bei Klienten mit extremen Persönlichkeitsstilen die Aufgabe, ein Problembewusstsein zu entwickeln für die persönlichen Selbst- und Beziehungsschemata, die sich meist erheblich dysfunktional im Leben unserer Klienten auswirken. Der Coach sollte verstehen, dass sein übliches ressourcen- und lösungsorientiertes Repertoire zwar durchaus zum Einsatz kommen kann – aber nicht in gewohnter Weise von Anfang an. Denn die Symptome, wie beispielsweise eine zeitraubende Genauigkeit, eine immense Auftrittsangst oder lang anhaltende Erschöpfung, können nicht nur durch Training auf der Ebene der Selbstkompetenzen verändert werden. Bei diesen Klienten liegen Probleme auf der Ebene affektiver (einseitige Stimmungen) oder kognitiver Fixierungen (einseitige persönliche Stile) vor (Ritz-Schulte et al., 2008). Diese Ebenen kann der Coach aber nicht durch reines Training oder durch die Initiierung eines willentlichen Akts beim Klienten verändern, es braucht vielmehr Anregungen, um den Selbstausdruck des Klienten zu stärken, es braucht Methoden, die dem Klienten den Selbstzugang erleichtern und es braucht enorm viel empathisches und im besten Fall auch funktionsanalytisches Verstehen (Ritz-Schulte et al., 2008).
Flexibleres Verhalten ermöglichen
Anders ausgedrückt „geht es um die Fähigkeit des Coachs, neben der Problemerzählung des Klienten auch problematische personentypische Fühl-Denk-Verhaltensmuster wahrzunehmen, über diese mit dem Klienten ins Gespräch zu kommen, ein diesbezügliches Problembewusstsein zu entwickeln und evtl. einen Behandlungsauftrag zu erwirken“. (Wagner et al., 2016, S. 27). Bei einer kaum ausgeprägten Selbstreflexionsfähigkeit kann das Ziel des Coachings maximal sein, dass dieser Klient ein besseres Verständnis seiner selbst gewinnt. Dass er trotz aller Hindernisse Entwicklung und Veränderung erreicht und mit dem Coach zusammen Möglichkeiten erarbeitet, wie er sein Verhalten in bestimmten Kontexten oder Situationen flexibler gestalten kann.
Persönlichkeitsstil und Selbststeuerung
Es ist fast unmöglich und gehört auch nicht zum Arbeitsauftrag, den persönlichen Stil zu ändern, doch Selbststeuerungskompetenzen können die Risiken und Einschränkungen, die mit einem extremen Persönlichkeitsstil verbunden sind, minimieren (vgl. S. 263 ff.). Man könnte sagen, dass jeder extreme Persönlichkeitsstil eine Entwicklungsaufgabe impliziert. Zum Beispiel würde eine extrem ängstliche Persönlichkeit vor der Entwicklungsaufgabe stehen, mehr Selbstsicherheit zu entwickeln. Eine Person mit viel Temperament bräuchte mehr Impulskontrolle, um unter seiner starken Handlungsenergie nicht zu leiden. Die – in diesem Buch noch vertiefte – PSI-Theorie bezeichnet daher Selbststeuerungskompetenzen als „Zweitreaktionen“, während die persönlichen Stile „Erstreaktionen“ genannt werden (Kuhl, 2010, vgl. S. 263 und S. 285). Auch wenn ich in der ersten Reaktion sofort impulsiv handeln will, kann mich meine Zweitreaktion, sofern ich sie gelernt und entwickelt habe, vor unbesonnenen Handlungen schützen. Zweitreaktionen stellen regelrechte Kompetenzen und somit Ressourcen der Person dar, um individuelle Entwicklungsaufgaben zu bewältigen, schwierigen Herausforderungen zu begegnen und extreme Erstreaktionen auszugleichen. Da es sich um Kompetenzen handelt, und nicht um Gewohnheiten, Muster oder Dispositionen, kann man sie auch entwickeln und trainieren, und das macht Zweitreaktionen interessant fürs Coaching.
Bevor Training und Entwicklung ansetzen können, gilt es aber zunächst, richtig die zugrunde liegenden Verhaltensmuster zu erkennen und sich im Coaching-Prozess auf verschiedenen Ebenen darauf einzustellen.
Wenn wir also im Coaching Menschen mit mehr oder weniger ausgeprägten Persönlichkeitsstilen begegnen, geht es also nicht darum, unseren bisherigen systemischen Methodenkoffer über Bord zu werfen, sondern vielmehr um eine neue Herangehensweise.
Typische Herausforderungen
Man muss in der Beziehung zwischen Coach und Klient mit bestimmten Erscheinungen rechnen, weil Menschen mit extremen Persönlichkeitsstilen in der Gestaltung ihrer Beziehungen Besonderheiten aufweisen. Persönlichkeitsstörungen sind immer auch Beziehungsstörungen.
Nach Psychotherapeut Rainer Sachse (2019) weisen diese Klienten folgende bestimmte typische Charakteristika auf, die das Coaching herausfordernder gestalten:
Typische Merkmale extremer Stile
Hohes Misstrauen,die Tendenz, wenig von sich preiszugeben,eine starke Tendenz, Images zu produzieren,schlechte Repräsentation eigener Problemanteile.Tendenzen wie die, Images zu produzieren und eigene Problemanteile nicht darzustellen, führen dazu, dass das Verhalten extremer Persönlichkeitsstile leicht als täuschend empfunden werden kann. Nach Sachse greifen Klienten mit extremen Persönlichkeitsstilen häufiger als andere Klienten auf intransparente und scheinbar manipulative Handlungen zurück. Diese Form der Manipulation ist meist nicht intendiert, sondern findet auf einer sub-volitionalen Ebene statt. Je nachdem, in welchem Ausmaß diese Klienten manipulatives Verhalten aufweisen, verärgern sie andere Menschen damit – und dieses Risiko besteht natürlich auch für uns als Coachs.
Manipulationen und Spiele
Sachse arbeitet sehr stark mit der Metapher von Images und interaktionellen Stilen, um die manipulativen Tendenzen zu verstehen. Insbesondere die emotional-dramatisierenden Persönlichkeitsstile (s. S. 40) können sich als Opfer oder als „armes Schwein“ inszenieren und wollen uns über diese Rolle beeinflussen und ihr Grundbedürfnis nach viel Aufmerksamkeit befriedigen, uns zu bestimmten Handlungen zu veranlassen oder dazu, Verantwortung zu delegieren. Manipulatives Verhalten variiert, je nachdem, welches Störungsbild vorliegt. Insgesamt müssen wir als Coachs auf der Beziehungsebene (s. S. 20 ff.) wachsam sein, ob wir uns in Manipulationen und Spiele verwickeln lassen. Denn wenn wir diese Strategien des Klienten nicht erkennen, fühlen wir uns hilflos oder außer Gefecht gesetzt. Unsere Interventionen verschlimmern dann oft das Problem nur.
Die Psychotherapieforscherin Gudula Ritz (2001) dagegen findet es fraglich, ob Personen mit Persönlichkeitsstörungen tatsächlich manipulieren. Bei histrionischen Persönlichkeiten (s. S. 110 ff.) zum Beispiel dominiert eine ansteckende Begeisterungsfähigkeit, welche andere Personen vielleicht als Manipulation erleben können. Es handelt sich aber nicht um eine willentliche Manipulation, sondern um einen ansteckenden Interaktionsstil, eine Art archaische Gefühlsansteckung, die manchmal ja auch als positives Charisma rüberkommt.
Es besteht – je nach Stil – auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass der Klient den Coach als Gesprächspartner testet, um herauszufinden, ob er wirklich vertrauenswürdig ist oder ob er dem Bild von Beziehung entspricht, dass der Klient aus seinen vergangenen Erlebnissen kennt. Diese Klienten testen, ob der Coach echt ist als Mensch, wie er auf Kritik oder Widerstand reagiert und vor allem: ob er verlässlich ist.
Ganz gleich wie dieses besondere Verhalten bewertet wird: Es ist für den Coach von Vorteil, es zu erkennen und nicht in Beziehungsfallen zu gehen, die den Entwicklungszielen des Coachings zuwiderlaufen.
Arbeit an der Beziehung
Klienten mit bestimmten extremen Persönlichkeitsstilen sind meist beziehungsmotiviert: zum Beispiel beim Borderline-Stil oder beim Histrionischen Stil. Denn, wie bereits erwähnt: Persönlichkeitsstörungen sind immer auch Beziehungsstörungen. Sie wünschen sich deshalb auch eine bestimmte Art von Beziehung zum Coach und senden implizite Appelle auf der Beziehungsebene. Personen mit erhöhtem Borderline-Kennwert suchen Verlässlichkeit und Nähe, histrionische Persönlichkeiten brauchen Aufmerksamkeit, Narzissten suchen Bewunderung. Sie senden Hilferufe nach dem Motto wie: „Ich kann nichts tun, helfen Sie mir! Sie sind doch der Experte!“ Oder: „Kennen Sie noch eine Methode, die hilfreich sein könnte. Es ist ja alles so schwierig.“
Zuerst wird Beziehungskredit aufgebaut
So steht bei Menschen mit starken oder extremen Persönlichkeitsstilen die konsequente Arbeit am Aufbau von Beziehungskredit über die erste Phase des Coachings im Zentrum. In dieser ersten Phase passiert es uns als lösungsorientiert ausgebildetem Coach leicht, dass wir zu schnell zur Lösung eilen wollen. Wenn dann eine unserer Methoden nicht funktioniert, holen wir die nächste hervor – immer im Glauben, es gäbe auch für diesen Klienten noch eine passende Methode. Ein solches Vorgehen ähnelt dann mehr und mehr dem von Versuch und Irrtum. Wahrscheinlich lösen wir dann beim Klienten aber Widerstand oder Frustration aus, schreiben ihm unser eigenes Versagen zu oder verlieren ihn als Klienten.
Menschen mit ausgeprägten Persönlichkeitsstilen erfordern ein anderes Herangehen im Coaching als ausgeglichenere Personen. Von Anfang des Coachings an schnell Methoden anzubieten, läuft bei diesen Klienten meist ins Leere. Vielmehr erleben wir als Coachs dann Widerstand, oder aber strukturelle Defizite wie blinde Flecken aufseiten des Coachees. Unsere Methoden werden einfach nicht angenommen, sie werden links liegen gelassen oder als nicht hilfreich abgetan. Das erzeugt in uns dann Frustration und wir stellen womöglich unser Tun, unsere Methodik in Frage. Menschen mit extremen Persönlichkeitsstilen bringen uns meist sehr ins Rotieren. Wir spüren, dass wir mit unserem gängigen Methodenrepertoire nicht weiterkommen und fangen an, an unserer Kompetenz zu zweifeln. Wobei ein bisschen Demut uns Coachs hin und wieder auch guttun würde. Oder noch schlimmer: Wir übertragen unseren Ärger und unsere Frustration auf den Klienten, der einfach unsere Angebote nicht umsetzt, da er dies ja scheinbar absichtlich macht.
Dabei vergessen wird, dass sein Beziehungsverhalten uns gegenüber exakt die Probleme nachbildet, die seine Störung auch sonst mit sich bringt. Wir müssen an dieser Stelle im Coaching-Prozess also hellwach sein und nie den Blick von der Meta-Ebene vernachlässigen. Das Verhalten des Coachees ist nicht gegen uns gerichtet, sondern ist ein Zeichen der typischen Beziehungsgestaltung des Klienten, die wir sogar zum Thema machen können, sofern wir ausreichend „Beziehungskredit“ aufgebaut haben.
Personen mit Persönlichkeitsstörung unterscheiden sich nicht nur signifikant hinsichtlich ihrer Beziehungsgestaltung von Personen ohne Persönlichkeitsstörung, sondern auch hinsichtlich ihrer Prozesstransaktionen, d.h. der Art und Weise, wie sie mit den Herausforderungen ihres Alltags umgehen. Die Signifikanz ist auf der Prozessebene sogar größer als auf der Beziehungsebene (Ritz-Schulte, 2001, 2005). Das dies in der Fachliteratur und Forschung bisher kaum Beachtung fand hat auch damit zu tun, dass die Prozessebene noch weniger bewusst und sprachlich fassbar ist als die Beziehungsebene. Personen mit Persönlichkeitsstörung nehmen z.B. die Wertschätzung des Coachs nicht in gleicher Weise wahr, wie Personen ohne extremen Stil (Ritz-Schulte, 2001, 2005). Es hilft der Blick auf ein Meta-Modell, um sich diese Ebenen, auf denen das Coaching stattfindet, vor Augen zu führen und aufzuzeigen, wo der Schwerpunkt der Arbeit mit extremen Persönlichkeitsstilen liegt.
Die Ebenen des Coachings aus der Meta-Perspektive
Wo die Unterschiede beim Coaching liegen
Genau zu unterscheiden, was im Coaching-Prozess die Anteile des Coachs sind und welche Dynamik durch die Persönlichkeit des Klienten hervorgerufen wird, ist von großer Bedeutung für die Qualität der Coaching-Arbeit. Es ist zudem für Coachs wichtig, Interaktionen auf der Beziehungs- und Prozessebene, die normalerweise unbewusst und automatisch ablaufen, zu verstehen und darauf zu reagieren. Daher ist zu Beginn eine Meta-Perspektive auf professionelle Entwicklungs- und Veränderungsprozesse sinnvoll. Hierzu wählen wir ein Vier-Ebenen-Modell (Ritz-Schulte, 2011).* Das im Coaching bekanntere Modell von Schulz von Thun (1993) ist mit diesem Vier-Ebenen-Modell kompatibel, es differenziert allerdings nur zwischen Inhaltsebene und drei verschiedenen Formen von Beziehungsebenen. Obwohl alle vier Ebenen in einem ganzheitlichen Prozess interagieren, kann man durch die konzeptuelle Unterscheidung innerhalb dieses Mehrebenen-Modells verschiedene ablaufende Prozesse getrennt analysieren und entsprechend einen korrigierenden Einfluss ausüben. Im Beratungsprozess kann im Hinblick auf die Entwicklungsziele mal die eine, mal die andere Ebene im Vordergrund stehen.
Vier Verstehens- und Handlungsebenen von Veränderungs- und Entwicklungsprozessen
Verstehens- und Handlungsebenen
Inhaltsebene (subjektiv-phänomenale Ebene)Transaktional: BeziehungsebeneTransaktional: ProzessebeneFunktionsebene (objektiv-analytische Ebene)Inhaltsebene
Die Inhaltsebene konstituiert sich aus der subjektiv-phänomenalen Erlebniswelt des Klienten. Auch der Coach kann bestimmte Inhalte abfragen und strukturieren, z.B. den Arbeitsauftrag des Klienten zu Beginn des Coachings. Auf der Inhaltsebene ist der Klient Experte: Er ist Experte für die persönliche Bedeutung der Inhalte, für ihre Priorisierung, für bestimmte inhaltliche Entscheidungen, für seine Ziele, Gefühle, Gedanken usw. Der Coach kann sich in die subjektiven Erlebnisinhalte des Coachees empathisch einfühlen. Die Inhaltsebene ist sprachlich leicht fassbar, obwohl viele Inhalte, insbesondere emotionale Erlebnisinhalte, implizit vermittelt werden. Die Inhaltsebene selbst ist relativ wenig veränderungswirksam, denn viele Coachees wissen genau, was sie ändern wollen, aber die Umsetzung der Änderungsabsicht ist das Problem. Wenn die Klarheit über Inhalte selbst Veränderung und Entwicklung ermöglichen würden, wenn Veränderungen so einfach umzusetzen wären, wären Berater, Coachs, Lehrer, Trainer, Therapeuten überflüssig. Deshalb lohnt sich der Blick auf die weiteren Ebenen, die zum Teil sprachlich nicht so leicht greifbar sind.
Bei Klienten mit extremen Persönlichkeitsstilen und Persönlichkeitsstörungen bedarf es eines besonders kompetenten Vorgehens des Coachs auf der Beziehungsebene und der Prozessebene. Denn solche Klienten sind auf diesen transaktionalen Ebenen besonders auffällig und daher herausfordernd für den Coach, Trainer, Therapeuten (Ritz-Schulte, 2001, 2005; Ritz-Schulte et al., 2008). Dabei geht es wie gesagt nicht um das Was, sondern um das Wie. Und dieses Wie ist in allen Entwicklungsbereichen wichtiger für Veränderung als das Was. Nur dass dieses Wie sprachlich nicht so greifbar ist und normalerweise intuitiv und ohne bewusste Steuerung umgesetzt wird. Genau das ist die Herausforderung professioneller Experten: Viele Klienten wissen zwar, was sie ändern wollen, aber nicht, wie. Diese Transaktionsebenen sind Bestandteil der Expertise eines Coachs: Beziehungskompetenzen, ressourcenorientierte Beziehungsgestaltung sowie Prozesskompetenz.
Die beiden transaktionalen Ebenen sind interaktiver Natur und deren Dynamik verläuft normalerweise unbewusst. Transaktionale Prozesse laufen niemals einseitig ab, sondern sind immer interaktiv und beeinflussen sich wechselseitig. Das ist eine Herausforderung für Coachs, denn sie sind selbst Teil des Systems, was die Erkenntnisprozesse erschwert. Diese unbewussten Transaktionen und Dynamiken wahrzunehmen und – wenn möglich und nötig – im Hinblick auf die Entwicklungsziele zu korrigieren oder zu steuern, ist ein Merkmal professioneller Expertise. Eine Änderung von dysfunktionalen Transaktionen besitzt eine starke Änderungswirksamkeit, ist aber nicht leicht zu haben.
Beziehungsebene
Die bereits angesprochene Beziehungsebene umfasst nonverbale, wechselseitige Aspekte der Interaktion zwischen Coach und Coachee. Die Bedeutung der Beziehungsebene bleibt dabei nicht auf Einzelinteraktionen zwischen Berater und Klient beschränkt, sondern muss vor dem Hintergrund der zeitlich andauernden Art und Qualität der Beziehung gesehen werden (Vertrauen, Tragfähigkeit einer Beziehung). Der Coach kann sich die transaktionale Beziehungsebene bewusst machen und die Aufmerksamkeit auf Merkmale der Coaching-Beziehung richten wie Vertrauen, Bindung, Offenheit, Qualität usw.
Prozessebene
Weit weniger bekannt, aber sehr bedeutsam für Veränderungsprozesse ist die Ebene der Prozesstransaktionen. Unabhängig von den Beziehungen geht es auf dieser Ebene darum, wie ein Klient mit den Herausforderungen seines Lebens umgeht, wie er sie bewältigt. Die Prozesstransaktionen besitzen eine große Nähe zu Selbststeuerungskompetenzen des Klienten, z.B. ob der Klient achtsam sein kann, seine Prozesse verlangsamen kann, sich beruhigen kann oder ob er sich selbst chaotisiert. Deshalb ist der Blick auf die Prozessebene für einen Coach wesentlich, um Blockaden und „Angelpunkte“ für Veränderung zu erkennen.
Man könnte analog zu den bekannten Übertragungen und Gegenübertragungen auf der Beziehungsebene von Prozessübertragungen sprechen (Ritz-Schulte, 2001, 2005). So, wie der Klient im Alltag mit den Herausforderungen aus Beruf und Privatleben umgeht, so zeigt sich das auch im Coaching-Prozess. Auf der Prozessebene kann der Coach mehr oder weniger direktiv und strukturierend vorgehen. Steht die Prozessebene im Vordergrund, dann geht es darum, wie der Klient und/oder der Coach mit einem bestimmten Thema oder Problem umgehen: z.B. ob der Patient Problemen und problematischen Inhalten ausweicht oder sich ihnen stellt, ob der Coach sich an den Bearbeitungsmodus des Patienten anpasst oder den Coachee konfrontiert usw. Sinnvoll sind auf der Prozessebene flexible Regeln, z.B. das Prinzip der minimalen Strukturierung, welches auf den Entwickler der Selbstmanagement-Therapie Frederick Kanfer (2006) zurückgeht.
Funktionsebene
Die vierte Ebene, die Funktionsebene ist die analytische Perspektive vor dem Hintergrund grundlagenwissenschaftlicher Erkenntnisse. Auch diese Ebene ist sprachlich fassbar, ähnlich der Inhaltsebene, aber im Unterschied zu dieser nicht subjektiv-phänomenologisch, sondern objektiv-analytisch aus einer distanzierten Perspektive heraus. Auf der Funktionsebene ist der Coach Experte, hier kann er sein Grundlagenwissen anwenden und Hypothesen aus den Theorien ableiten, die als wissenschaftlich fundiert gelten und seine Coaching-Angebote begründen. Funktionsanalytisch gewählte Methoden passen zu den ursächlichen Faktoren und zu den Entwicklungszielen im Coaching.
Der Vorteil dieser Aufschlüsselung in vier Ebenen liegt darin, sinnvoll von der Inhaltsebene abstrahieren zu können. Die Inhaltsebene selbst hat, wie bereits erwähnt, bei den meisten Klienten wenig Änderungspotenzial, das gilt insbesondere für Klienten mit extremen Persönlichkeitsstilen. Die hohe Schule des Coachings liegt darin, auf den transaktionalen Ebenen Veränderungen anzustoßen und wissenschaftlich begründete wirksame Interventions- und Trainingsmethoden anzubieten.
Dieses Buch unterstützt Coachs sozusagen über die vierte Ebene, die Funktionsebene, indem es Kenntnisse und Grundlagenwissen zum Thema Persönlichkeit erweitert und wissenschaftliche Begründung für die Auswahl geeigneter Coaching-Maßnahmen bietet. Nur wenn ich als Coach über ein Grundwissen an persönlichkeitspsychologischen und persönlichkeitsdiagnostischen Herangehensweisen verfüge, kann ich einschätzen, mit welchem interaktionellen Problem und welchem Problembearbeitungsstil ich im Coaching-Prozess rechnen muss (Ritz-Schulte, 2005). Das schützt mich davor, etwaige Widerstände oder strukturelle Defizite des Klienten, ärgerliche bis aggressive Verhaltensweisen oder Tests, die der Klient an mir vornimmt, persönlich zu nehmen. Ich verstehe und erkenne als Coach ein solches Verhalten dann als Teil einer typischen Beziehungs- und Prozessbearbeitungsstörung.
Wenn ich nachvollziehen kann, wie eine Persönlichkeit funktioniert, habe ich viel mehr Möglichkeiten, sie durch geeignete Methoden in ihrer Entwicklung zu unterstützen. Je mehr ich als Coach von der Persönlichkeit des Coachees verstehe, umso nachhaltiger und effizienter können meine Coaching-Angebote sein. Es geht also um persönlichkeitsorientierte, differenzielle Coaching-Angebote. Persönlichkeitsorientiertes Coaching ermöglicht ein maßgeschneidertes Coaching-Angebot, welches die Ressourcen, Besonderheiten und persönlichen Dispositionen des Klienten in besonderer Weise berücksichtigt. Und deshalb lohnt es sich auch für Coachs, ihr Wissen im Bereich der Persönlichkeitspsychologie und -diagnostik zu erweitern, nicht nur ihr Wissen, sondern auch ihre Kompetenz. Denn mit hoher Wahrscheinlichkeit werden sie immer wieder mit Klienten konfrontiert sein, bei denen die methodenorientierte Arbeit auf der Ebene der Zweitreaktionen (s. S. 285 f.) nicht ausreicht.
Anhand der vier Ebenen lassen sich auch zentrale Aspekte des Coachings und des Entwicklungsprozesses verankern. Im Folgenden finden sich allgemeine Heuristiken für die vier Ebenen des Coaching-Prozesses, die insbesondere für Klienten mit ausgeprägten Stilen von Bedeutung sind.
Inhaltsebene
Coaching-Aufgaben auf 4 Ebenen
Herausstellen von zentralen KonfliktenKlärung und Bewusstmachung fördernKonkrete Problembewältigung unterstützen/anregenPsychoedukationEmpathieBeziehungsebene
Grenzen und RollenklarheitRessourcenorientierte Beziehungsgestaltung (emotionales Mitschwingen, Wertschätzung, persönliche Präsenz)Beziehungsmuster erkennen und für den Entwicklungsprozess nutzenProzessebene
Prozessdirektivität und StrukturierungInternalisierung der PerspektiveVerlangsamung!Vertiefung des Bearbeitungsprozesses (affektive Verarbeitung)Leitfragen für den Prozess (Zielexplikation)angemessene Herausforderung: Klienten nicht über- und unterfordernRollenklarheit: Arbeite nicht für den Klienten!Coaching-Prozesse transparent machen und explizieren, z.B. als didaktische Statements: „In der Beratung ist es wichtig, dass man bei einer Fragestellung bleibt und dass man sich Zeit nimmt.“Bei Ausschweifungen: zentralisieren, z.B. „Was ist der wichtigste Punkt?“Prozessstrukturierung: „Was ist Ihre zentrale Fragestellung?“Geschmeidiger Umgang mit Abwehr/WiderstandFunktionsebene
Berücksichtigung des Persönlichkeitsstils unter Passung- und EntwicklungsperspektiveAnregung antagonistischer SystemeBeeinflussung der SystemdynamikAnregung von Progression oder RegressionFunktionsanalytische Ableitung von MethodenKlärung von Motiven und MotivdiskrepanzenWas bedeutet das fürs Coaching?
Es entspricht den praktischen Erfahrungen, dass ein Coach bei extremen Persönlichkeitsstilen oder Persönlichkeitsstörungen mehr Direktivität und Strukturierung in den Coaching-Prozess einbringen muss als bei ausgeglicheneren Persönlichkeiten. Das Gleiche gilt auf der Prozessebene für Personen mit geringen Selbststeuerungskompetenzen, z.B. im Bereich Substanzmittelsucht. Diese Hinweise gelten nicht nur für die Entwicklungsperspektive. Bei extremen Persönlichkeiten sollte zuallererst die Passungsperspektive bei der Prozessbegleitung berücksichtigt werden. Die Frage des Coachs an sich selbst sollte dann etwa bei einer narzisstischen Persönlichkeit lauten:
Arbeitsperspektive eines Coachs
„Was benötigt der Klient mit narzisstischem Stil, vor allem auf der Beziehungs- und Prozessebene, damit er meine entwicklungsfördernden Coaching-Angebote überhaupt annehmen kann?“
Gerade bei Personen mit narzisstischer Persönlichkeit (s. S. 55 ff.) klaffen die Passungs- und die Entwicklungsperspektive weit auseinander: Das, was unter Entwicklungsgesichtspunkten notwendig ist, nämlich eine (kritische) Selbstreflexion, fällt diesen Personen unter einer Passungsperspektive am schwersten, da sie sehr empfindlich gegenüber Kritik sind. Der Coach sollte also wohl dosiert konfrontieren, oder, wie man sagt, die Konfrontation gut „verpacken“, man spricht bei diesen Interventionen auch von „Trojanischen Pferden“, und auf der Beziehungsebene sehr wertschätzend bleiben, und versuchen, ausschließlich auf der Inhaltsebene kritische Rückmeldung zu geben.
* Das Modell lehnt sich an das Zwei-Ebenen-Modell von Watzlawik (Watzlawik et al., 1993) und das Drei-Ebenen-Modell von Sachse (1999) an und ergänzt diese Modelle um eine vierte Ebene.
Diagnose als Bestandteil von Coaching
In Kapitel zwei und drei dieses Buches werden verschiedene Persönlichkeitsstile dargestellt. Sie beruhen auf einer klinischen Diagnose nach dem „Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders“ (DSM). Zunächst stellt sich aber die Frage, ob und unter welchen Bedingungen im Coaching mit einer Persönlichkeitsdiagnose gearbeitet werden kann. Denn systemische Ansätze – auch im therapeutischen Kontext – tun sich traditionell schwer mit Diagnosen: Es geht doch darum, lösungs- und ressourcenorientiert zu arbeiten! Diagnosen werden wegen des stigmatisierenden Potenzials sowie der Gefahr einer möglichen „Problemhypnose“ abgelehnt.
Der Blick der systemischen Therapie auf Diagnosen
Anders als beispielsweise in der Tiefenpsychologie verfolgt man im Coaching nicht das Ziel, dysfunktionale Muster der Vergangenheit aufzuarbeiten und zu korrigieren. Vielmehr werden Blockaden und Hindernisse in der Aktivierung von Ressourcen und dem konsequenten Verfolgen von Zielen überwunden. Defizitorientierte Beschreibungen – als solche werden Diagnosen ja aufgefasst – oder das Analysieren dysfunktionaler Muster werden tabuisiert und von vorneherein ausgeschlossen. Es geht darum, systemische Zusammenhänge zu erkennen und aus diesen das Verhalten von Personen zu erklären – problematische Eigenschaften werden nicht der Person zugeschrieben, sondern werden als Produkte von Dynamiken verstanden.
Die systemische Vorgehensweise ähnelt in gewisser Weise der Funktionsanalyse, nur eben nicht auf naturwissenschaftlicher Basis, sondern eher aus einer empirisch sozialwissenschaftlichen Sichtweise heraus. Oder anders formuliert: „Während systemische Therapie durch Kontextualisierung und zirkuläre Fragen starre Problemzuschreibungen dekonstruiert, wird bei der Beschreibung einer ‚Persönlichkeitsstörung‘ eine interaktionelle Problematik einer Person zugeschrieben und dabei auch noch Permanenz postuliert/konstruiert, statt nach Ausnahmen, Ressourcen und Lösungen zu suchen.“ (Wagner et al., 2016, S. 15).
Die Frage ist, ob nicht beides geht, denn das eine schließt das andere nicht grundsätzlich aus. Man kann durchaus einen extremen Persönlichkeitsstil beschreiben, erklären und gleichzeitig nach Ausnahmen, Ressourcen und Lösungen suchen. Es gibt stabile Persönlichkeitsmerkmale, die zum Teil extrem und einseitig sind. Diese entstehen aus einer äußeren Dynamik nicht immer wieder neu, sondern sind eng an eine Persönlichkeit gebunden, als dispositionelle Muster.
Ziel der Arbeit mit Diagnose
Es geht gar nicht darum, den extremen Stil zu ändern oder die Störung zu beheben, sondern darum, diese zu akzeptieren und mit mehr Passung, Transparenz und Klarheit weitergehende und differenziell wirksame Trainingselemente anzubieten.
Die Grundsätze, auf denen traditionell systemisches Arbeiten aufbaut, unterscheiden sich von einem auf Störungen ausgehenden Paradigma wie dem der Psychotherapie. Folgende Grundsätze gelten für systemisches Arbeiten im Coaching:
Grundsätze systemischen Coachings
Klienten sollen grundsätzlich nicht durch Zuschreibungen pathologisiert werden.Probleme und dysfunktionale Verhaltensweisen werden immer im systemischen Zusammenhang gesehen und nicht der Persönlichkeit von Klienten zugeschrieben.Verhalten ist aus der systemischen Sicht jederzeit veränderbar.Systemisches Arbeiten erkundet die Funktion und die positive Wirkung von Funktionen.Durch das Fragen nach Ausnahmen – also nach Situationen, in denen das Problem nicht auftaucht – wird untermauert, dass Probleme nicht von Dauer sind, sondern in bestimmten Situationen, Zusammenhängen, Konstellationen konstruiert werden, also immer situativ zu deuten sind.Der Blick geht beim systemischen Arbeiten konsequent in die Zukunft. In der Vergangenheit werden Ausnahmen vom Problem gesucht, um dem Klienten ein Gefühl dafür zu vermitteln, dass er die Ressourcen bereits in sich trägt, um eine Veränderung von Verhalten herbeizuführen.Im systemischen Arbeiten gilt es, Ressourcen und kleine Erfolge zu fokussieren und darüber Veränderung zu bewirken. Das „Cheerleading“ (s. S. 152) des Klienten stellt eine wichtige Intervention dar.Systemische Coachs arbeiten nicht mit persönlichkeitsdiagnostischen Verfahren, sondern konzentrieren sich rein auf den vom Klienten formulierten Auftrag. Intrapsychischen Phänomenen und Störungen wird deshalb traditionell weniger Aufmerksamkeit geschenkt. Der Fokus liegt auf der Grundannahme, dass Menschen Probleme konstruieren und auch in der Lage sind, diese wieder zu dekonstruieren – und zwar völlig unabhängig von ihren persönlichen Dispositionen. Im Fokus steht die Methodik, nicht der persönlichkeitsorientierte Zugang.Betrachtet man diese Postulate genauer, so ähneln diese zum Teil professionellen Glaubenssätzen oder gar Dogmen. Wenn es so wäre, dass „Verhalten immer änderbar“ ist, dann fragt man sich, warum nicht alle Coachings zum gewünschten Erfolg führen oder dieser hin und wieder auf sich warten lässt? Wäre Veränderung einfach, bräuchte man im Grunde kein Coaching.
Was diese Aussagen betonen, ist vor allem eine Absicht, als Coach offen für den individuellen Klienten und seine Möglichkeiten zu bleiben und zugewandt zu sein. Die Absicht, die hinter den Postulaten steckt, schließt die Betrachtung von Persönlichkeitsstilen nicht unbedingt aus. Es besteht beispielsweise durch das Berücksichtigen möglicher Diagnosen keine Notwendigkeit der Pathologisierung. Es kann trotzdem an positiven Ausnahmen, an Veränderung von Verhaltensweisen usw. gearbeitet werden. Ebenso gilt, dass, wer den Kontext berücksichtigt, in dem die dysfunktionialen Verhaltensweisen in der Vergangenheit entstanden sind, damit durchaus einen Blick auf ein „System“ wirft, wie es auch die Postulate fordern. Und nicht zuletzt kann es sehr sinnvoll sein, bei Klienten mit extremem Persönlichkeitsstil ressourcenorientiert zu arbeiten – wenn die Beziehung zum Klienten auf einer guten Vertrauensbasis steht! Das heißt, zu einem späteren Prozesszeitpunkt (s. S. 20).
Es geht also nicht um ein Entweder-oder. Es geht nicht darum, entweder systemisch zu arbeiten oder mit dem Wissen und der Berücksichtigung bestimmter extremer Stile. Der extreme Stil muss noch nicht einmal in jedem Fall expliziert werden, er sollte aber im Coaching-Prozess berücksichtigt werden. Es ist fast unmöglich und gehört auch nicht zum Arbeitsauftrag, den persönlichen Stil zu ändern. Der Klient kann aber lernen, seine Persönlichkeit auf einer Meta-Ebene besser zu verstehen und wertzuschätzen und besser mit seinem extremen Stil zu leben. Er kann lernen, geeignete Zweitreaktionen, d.h. Selbstmanagement-Kompetenzen, zu entwickeln. Hierbei ist wichtig zu wissen, dass in der Regel mehr Geduld erforderlich ist, bis erste kleine Veränderungen sichtbar werden.
Interview: Perspektiven auf Persönlichkeitsdiagnose und ihren Einsatz im Coaching
Bettina Hafner, systemischer Coach; Gudula Ritz, Psychotherapieforscherin und persönlichkeitsorientierte Beraterin; Greta Röd, Ärztin für Psychosomatische Medizin, Verhaltenstherapeutin und systemische Therapeutin; Judith Bahmer, Tiefenpsychologin
Bettina: Über Persönlichkeitsstörungen wird viel Unterschiedliches geschrieben und geredet. In den einzelnen Therapierichtungen ist man sich nicht immer einig, wie nun Persönlichkeitsstörungen zu definieren und zu verstehen sind. Systemische Therapie tut sich generell schwer, von Störungen und Diagnosen zu sprechen. Denn da geht es ja mehr darum, auf die kompetente Bewältigungsleistung und die Ressourcen der Klienten zu schauen – da möchte man stigmatisierende Pathologisierung lieber vermeiden. Wie siehst du das aus der Perspektive der Verhaltenstherapie und Gesprächspsychotherapie?
Gudula: Vielleicht tut man sich in der Praxis grundsätzlich schwer mit dem Begriff der „Störung“. Und überhaupt mit Diagnosen wegen der berechtigten Risiken – wie zum Beispiel der Stigmatisierung. Die „Persönlichkeit“ als Ganzes wäre mit einer Störungszuschreibung ja besonders vulnerabel. Das erlebt jeder als irgendwie unangenehm. Andererseits gibt es das Phänomen der „schwierigen Persönlichkeiten“, und das ist kein unerhebliches Merkmal im Kontext von Beratung und Psychotherapie. Die Alternative – dass man sagt, wir lassen den Begriff weg, aus ethischen Gründen – das ist aus meiner Sicht eine Beschönigung.
Es bringt ja nichts, nur auf die Ressourcen zu schauen, wenn es gravierende Probleme auf der Beziehungs- und Prozessebene in der Beratung oder im Coaching gibt. Gerade das sind die veränderungssensitiven Ebenen, auf denen Personen mit extremen Stilen oder Störungen Auffälligkeiten zeigen. Und wenn jemand in seinen Bewältigungsprozessen und Beziehungen durch bestimmte Muster eingeschränkt ist, dann hat er mehr Schwierigkeiten als andere Klienten, seine selbst gewählten Veränderungen und Entwicklungen umzusetzen. Ich finde Transparenz immer vorteilhaft, das heißt, diese Schwierigkeiten des Klienten auch beim Namen zu nennen. Aus meiner Erfahrung ist das sogar für die entsprechenden Klienten eher entlastend, weil sie ihre Probleme besser nachvollziehen können.
Persönlichkeitsstörungen sind natürlich ein besonders sensibler Begriff, weil sie ja an den Kern der Person rühren und weil tatsächlich bei Persönlichkeitsstörungen eine besondere Kränkbarkeit impliziert ist, dass die Person als Ganzes gestört ist. Man könnte alternativ von extremen Persönlichkeitsstilen sprechen, wie Kuhl und Kazén es in ihrem dimensionalen Ansatz bei der Konstruktion des PSSI tun (1997, s. S. 285). Wenn man den Begriff in dieser Art verwendet, wird das Kränkungsrisiko minimiert. Auch in der Psychotherapie, aber auch in der Beratung gehört der Umgang mit den „Erstreaktionen“, mit den persönlichen Stilen, zu den herausforderungsvollsten Anforderungen an professionelle Entwickler und Begleiter.
Bettina: Wie kommunizierst du denn jemandem, dass er einen extremen Persönlichkeitsstil hat?
Gudula: Das erfordert schon ein besonderes Fingerspitzengefühl, transparent und wertschätzend zu sein, wenn man über extreme Persönlichkeitsstile und ihre Risiken spricht. Ich beschreibe dann oft die Vorteile eines extremen Stils in bestimmten Kontexten und frage den Klienten: „Könnten auch Risiken zu diesem Stil dazugehören?“ Klienten formulieren die Schattenseiten ihres Stils dann häufig selbst und sind nicht auf meine kritische Einschätzung angewiesen. Diese würde ich ohnehin eher im Konjunktiv formulieren, und jede Diagnostizierung vermeiden.
Bettina: Was verstehst du denn unter „Persönlichkeitsstörung“?
Gudula: Ich verstehe eine Persönlichkeitsstörung als extremen Persönlichkeitsstil, wenn eine Person durch ihre Persönlichkeit – das sind ja stabile individuelle Merkmale, die zeit- und kontextstabil sind – beeinträchtigt ist. Die Beeinträchtigung zeigt sich in der Art und Weise, wie sie habituell reagiert und sich verhält – vor allem auf den transaktionalen Ebenen Beziehung und Prozess – und irgendwie seltsam oder schwierig erscheint. Das ist eine Alltagserfahrung und es gibt eben im therapeutischen Bereich ein Konstrukt, was dieses Phänomen beschreibt: „Persönlichkeitsstörung“ oder „Entwicklungsstörung“.
Man hat aufgrund von Erfahrungen die verschiedenen Stile diagnostisch voneinander unterschieden und beschrieben. Dies sind diagnostische Konstrukte, die insofern wertvoll sind, weil sie sehr viel therapeutisches Erfahrungswissen beinhalten. Aber es darf nicht vergessen werden, dass diese Beschreibungen und Aufzählungen noch nichts erklären. Es sind Phänomene, die beschrieben werden, auf dieses Wissen und diese Erfahrung zu verzichten oder sie komplett zu ignorieren, finde ich aus verschiedenen Gründen unprofessionell. Kurz gefasst: Persönlichkeitsstörungen sind extreme Persönlichkeitsdispositionen und -neigungen, die auf einer beschreibenden Ebene als Diagnosekonstrukte zusammengefasst sind. Und im Grunde gehört dieser Begriff in den „Mund“ von Experten – es ist hilfreich, über extreme Persönlichkeitsstile und -störungen im Coaching und in der Beratung Bescheid zu wissen und deren Existenz nicht aus ideologischen Gründen zu leugnen.
Greta: Ja, dieses Wissen ist hilfreich und es ist unbedingt erforderlich, um im Coaching-Kontext nicht auf der Ebene des offenkundigen „Auftrags“ hängen zu bleiben – und im Falle einer Persönlichkeitsstörung mit hoher Wahrscheinlichkeit zu scheitern. Bei einer Persönlichkeitsstörung liegen ja tief gehende dysfunktionale Schemata in Bezug auf das Selbst und in Bezug auf Beziehungen vor, die als „Lösungsversuch“ Verhaltensweisen nach sich ziehen, die – wie schon gesagt – zeitüberdauernd und unflexibel sind, die jedoch im Falle einer Persönlichkeitsstörung zu erheblichem Leiden – bei den Betroffenen oder bei der Umgebung führen. Wenn Coachs und Therapeuten die zugrunde liegende Motivebene nicht im Blick haben, verlieren sie ihren Klienten oder scheitern an anderer Stelle im therapeutischen Prozess.
Bettina: Judith, wie blickt denn die Tiefenpsychologie auf die Persönlichkeitsstörungen?
Judith: In der Tiefenpsychologie geht man davon aus, dass Persönlichkeitsstörungen eine Intensivierung, eine inflexiblere Ausprägung darstellen von dem, was man als Persönlichkeitsstil bezeichnet. Der Begriff „Persönlichkeit“ impliziert ja quasi schon einen differenzierenden Ansatz. Wir Menschen unterscheiden uns in unseren Merkmalen und Charakteristika – jeder Einzelne ist ein Individuum und jeder bringt bestimmte Merkmale mit. Zu einer Persönlichkeitsstörung kommt es dann, wenn diese Charakteristika so stark und so unflexibel ausgeprägt sind, dass sie zu Problemen im sozialen, interaktionellen oder im beruflichen Kontext führen. Oder wenn diese dazu führen, dass jemand aufgrund seiner extremen Persönlichkeit noch andere psychische Erkrankungen oder Beschwerden entwickelt.
Bettina: Jetzt kann man natürlich sagen, dass Persönlichkeitsstörungen nichts im Coaching zu suchen haben. Wie wäre eure Haltung dazu?
Gudula: Meine Haltung ist, dass es immer ein Vorteil ist, diese Zusammenhänge zu erkennen – die Störung zu erkennen und zu benennen. Denn sonst tut man sich als Coach keinen Gefallen, wenn man es ignoriert. Man könnte, wenn einem Klienten schwierig oder seltsam vorkommen, das Coaching ablehnen. Will man das? Der Prozess bewegt sich in solchen Fällen ohnehin nicht optimal – außer, dass man als Coach selbst vielleicht frustriert ist. Und möglicherweise macht man eben auch nicht die adäquaten Angebote für eine nachhaltige Entwicklung, weil man zu wenig versteht. Dass es nicht gibt, was – aus ideologischen Gründen – nicht sein darf, ist für mich noch nie ein Argument gewesen.
Bettina: Du würdest also sagen, allein die Kompetenz eines Coachs zu erkennen, da bin ich mit einem extremen Persönlichkeitsstil konfrontiert – diese Klarheit ermöglicht mir dann, die richtigen Entscheidungen zu treffen für den Klienten?
Gudula: Genau. Und eine therapeutische Begleitung muss nicht unbedingt sein. Denn eine Störung ist nur eine Störung oder ein extremer Stil, und keine Erkrankung. Vor allem gilt es zu schauen: Was sind Entwicklungsaufgaben für diese Klienten vor dem Hintergrund seines extremen Persönlichkeitsstils? Das sind Entwicklungsaufgaben, die diese Personen schon ihr ganzes Leben mit sich tragen. Wie alle Menschen. Nur, dass extreme Persönlichkeiten es vergleichsweise schwerer haben als ausgeglichene Personen.
Bettina: Aus deiner Sicht ist es also ein klares Ziel, das Wissen über Persönlichkeitsstörungen bei Coachs zu erweitern. Wie würdet ihr das sehen?
Judith: Ich würde auch sagen, dass es wichtig ist, dieses Wissen als Hintergrundinformation mitlaufen zu lassen, ohne dass man eine Stigmatisierung oder Kategorisierung vollzieht oder die Betroffenen nur noch unter einem Label, wie zum Beispiel „zwanghaft“ oder „Borderline“ laufen. Auch, weil das Zurückhaltung oder Ängste bei den Coachs hervorruft. Man sieht das auch bei Therapeuten, dass bestimmte Patientengruppen nicht beliebt sind, und Therapeutinnen und Therapeuten davor zurückschrecken, Persönlichkeitsstörungen zu behandeln, weil ihnen diese Prozesse zu herausfordernd erscheinen. Und da würde ich durchaus appellieren, sich das zuzutrauen, sich zu informieren, um das Wissen im Hintergrund mitlaufen zu lassen. Und natürlich auch mit dem Blick für Grenzen und Möglichkeiten, die man mit so einer Problematik hat, den Coaching-Prozess einzugehen und sich dann freuen zu können über kleine Fortschritte oder über das, was letztlich mit dem Klienten erreichbar ist. Und das ist dann, wenn es sich auf so basale Funktionen bezieht, enorm nachhaltig. Wobei es sich lohnt, an Emotionsregulation und an Impulskontrolle zu arbeiten und den Betroffenen kontextunabhängig, also nicht nur im Arbeitsleben, sondern auch für deren zwischenmenschliche Beziehungen, etwas Förderliches mitzugeben.
Sicher ist es aufseiten des Coachs ein sehr anspruchsvolles Arbeiten. Du musst mehr investieren. Du musst mehr regulieren. Du musst von außen mehr steuern, du musst differenzieren, wo der Klient nicht selbst differenzieren kann. Du musst Perspektiven aufmachen, du musst Angebote machen. Da, wo andere Klienten von sich aus in die Selbstreflexion gehen, musst du ein Stück weit mehr Input geben. Du bist als Coach emotional näher dran. Dabei gibt es bei einer Borderline-Störung beispielsweise auch Klienten, die einen emotional sehr fordern, von denen man hineingezogen wird in einen psychodynamischen interaktionellen Prozess. Das ist sicher eine Herausforderung.
Greta: Es ist definitiv wichtig, jede Stigmatisierung zu vermeiden. Meines Erachtens sollte eine Persönlichkeitsstörung nur thematisiert werden, wenn das für den Coaching-Prozess Relevanz besitzt. Und auch auf den Zeitpunkt ist sehr genau zu achten. Das heißt: Wenn eine gute Beziehung etabliert ist und auch klar wurde, dass es sich nicht nur um eine „einfache“ Achse-I-Symptomatik* handelt – dann kann die Arbeit an der Persönlichkeitsproblematik in den therapeutischen Fokus kommen. Durchgängig zentral ist der Fokus auf die Motivebene der Klienten – was sind die frühen Beziehungsmotive. Zu Beginn eines therapeutischen Prozesses muss auf Kongruenz des Therapeuten mit diesen Motiven geachtet werden. Im Verlauf können eventuell – nicht immer – die Problembereiche fokussiert werden.
Bettina: Das klingt für mich so, als wäre man bei Persönlichkeitsstörungen noch mal ganz anders gefordert als Coach? Mehr aus der reinen Begleitung rauszugehen und mehr anzubieten: Ich gehe an manchen Stellen mehr in Führung. Und es klingt auch so, dass viel psychologisches Wissen sich als nützlich erweist.
Judith: Das ist sogar sehr wichtig. Weil man dann weiß, wo Risiken für einen Abbruch des Coachings liegen oder wo Störungen im Coaching-Prozess auftauchen können. Und ich denke, das kann auch ein guter Hinweis sein für die Differenzierung von Persönlichkeitsstil und Persönlichkeitsstörung. Wenn in einem Coaching-Prozess Störungen auftreten und man das Gefühl hat, da sei Sand im Getriebe und es laufe nicht richtig, es gibt Widerstände oder offene Kritik am Coach, oder wenn das Vorankommen sehr zäh ist, dann ist das häufig ein Zeichen für eine Störung. Und Störungen haben in Therapie und Coaching immer Vorrang! Wenn man nicht an diesen basalen Kompetenzen arbeitet, hat man wenig Chancen, an dem eigentlichen Coaching-Thema, beispielsweise einem Arbeitsplatzkonflikt, produktiv zu arbeiten. Das bekommt man dann nicht hin.
Bettina: Und da bräuchte es dann wohl auch ein sehr klares Gespräch mit dem Klienten, weil dann das Ziel noch mal überprüft werden müsste. Also das Ziel, das ja vielleicht ein Auftrag des Unternehmens oder des Chefs war. Da brauche ich dann eine große Klarheit als Coach, um das auf den Punkt zu bringen: dass man einen längeren Prozess oder auch Unterstützung durch einen Therapeuten braucht. Außerdem muss ich meine Kompetenzen klar einschätzen, ob ich überhaupt mit diesem Klienten etwas erreichen, ihm das Adäquate bieten kann.
Greta: Ja, es bleibt eine sehr anspruchsvolle Aufgabe für einen Coach. Und auch die Klarheit, dass man in diesem Coaching-Prozess nur kleine Fortschritte machen und womöglich eine Sensibilisierung für die tiefer liegenden Themen erreichen kann. Ein Coaching-Prozess vermittelt dann im besten Fall eine Idee von weiteren Entwicklungszielen und bietet dem Klienten eine gute Orientierung für seine nächsten Schritte an. Das wäre dann eine sehr wichtige und äußerst hilfreiche Coaching-Arbeit!
* Achse-I-Störungen sind z.B. Ängste und Depressionen. Persönlichkeitsstörungen sind Achse-II-Störungen nach DSM oder ICD. Es können gleichzeitig Achse-I- und Achse-II-Störungen diagnostiziert werden.
Auf den Punkt gebracht …
Die Arbeit geht über genannte Probleme hinaus
Als Coachs sollten wir uns bewusst sein, dass im Umgang mit extremen Persönlichkeitsstilen die Arbeit an den sichtbaren Themen und vom Klienten genannten Problemen nicht ausreicht. Uns sollte klar sein, dass wir womöglich das in der Auftragsklärung formulierte Ziel des Coachings nicht erreichen werden, sondern zunächst stark auf der Beziehungsebene und auch an einem realistischen Arbeitsauftrag arbeiten müssen. Nur, wenn wir ausreichend Vertrauensarbeit geleistet haben, können wir womöglich einen Schritt in Richtung Klärung der innerpsychischen Dynamik wagen: Glaubenssätze hinterfragen, Verhalten analysieren und ein „Stattdessen“ andenken.
Realistische Erwartungen
Da Coaching-Prozesse im Regelfall über zehn Stunden nicht hinausreichen, versteht es sich von selbst, dass wir bestenfalls eine Idee von der Richtung vermitteln könnten, in die sich der Klient entwickeln könnte. Wenn unser Klient diese Erkenntnisse dann annehmen kann und sich möglicherweise therapeutische Unterstützung sucht, haben wir eine wertvolle Arbeit geleistet, ohne unsere Coaching-Kompetenz zu überschreiten. Dies gelingt uns aber eben nur mit einer soliden Basis an Wissen über persönlichkeitspsychologische Zusammenhänge und Störungen. Und klar ist auch: Es ist eine höchst anspruchsvolle Arbeit, die viel Wissen und Erfahrung voraussetzt! Nicht mit jedem Klienten, der extreme Persönlichkeitsstile aufweist, werden wir im Coaching dieses Maß an Klärung und Entwicklung erreichen.
Der extreme Stil muss nicht in jedem Fall expliziert werden, oft wird Klarheit über die eigene Persönlichkeit der Erfahrung zufolge aber als entlastend erlebt (Ritz-Schulte et al, 2008. Als Beispiel für das Vermitteln mit „Fingerspitzengefühl“ s. S. 32). Dass die Probleme, unter denen ein Klient leidet, auch mit der Persönlichkeit zusammenhängen können, ist eine hilfreiche Einsicht. Und an dieser Stelle ist es auch sinnvoll, dem Klienten zu vermitteln, dass diese extremen Fühl-Denk-Verhaltensmuster zu einer anderen Zeit – in der Kindheit, in der Jugend oder in einem anderen Kontext – die bestmögliche Lösung darstellten, die sie oder er bis dahin zur Verfügung hatte. Extreme Persönlichkeitsstile fallen nicht vom Himmel, sie haben häufig entwicklungsgeschichtlich einen Sinn und sehr häufig sogar eine Schutzfunktion. Hier trifft sich dann eben diagnostischer und systemischer Blick in der Überzeugung, dass die Störungen zu einem anderen Zeitpunkt und in einem anderen Kontext zutiefst sinnvoll waren – womöglich eine Überlebensstrategie darstellten – manchmal im wortwörtlichen Sinne.
Der Klient kann lernen, seine Persönlichkeit auf einer Meta-Ebene besser zu verstehen und wertzuschätzen und besser mit seinem extremen Stil zu leben. Er kann lernen, geeignete Zweitreaktionen, d.h. Selbstmanagement-Kompetenzen, zu entwickeln. Hierbei ist wichtig zu wissen, dass in der Regel mehr Geduld erforderlich ist, bis erste kleine Veränderungen sichtbar werden.
Der Coach hat in diesen Fällen also die Aufgabe, ein Problembewusstsein zu entwickeln für die persönlichen Selbst- und Beziehungsschemata, die sich meist erheblich dysfunktional im Leben unserer Klienten auswirken. Der Coach sollte verstehen, dass sein übliches ressourcen- und lösungsorientiertes Repertoire nicht in gewohnter Weise von Anfang an zum Einsatz kommen kann.
Extreme Persönlichkeit und Persönlichkeitsstörungen
DSM III