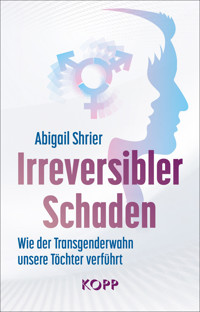
10,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kopp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Nicht wiedergutzumachen
Irreversibler Schaden ist die Erforschung eines Mysteriums: Warum hat sich die Diagnose »Geschlechtsdysphorie« im vergangenen Jahrzehnt von einem verschwindend seltenen Leiden, das fast ausschließlich Jungen und Männer betrifft, zu einer Epidemie unter Mädchen im Teenageralter gewandelt?
Die Journalistin Abigail Shrier präsentiert schockierende Statistiken und Geschichten aus Familien, um zu zeigen, dass die westliche Welt zu einem fruchtbaren Boden für einen »Transgenderwahn« geworden ist, der nichts mit echter Geschlechtsdysphorie, aber alles mit unserer kulturellen Schwäche zu tun hat.
Mädchen im Teenageralter nehmen Testosteron und entstellen ihren Körper. Eltern werden unterminiert. Auf sogenannte Experten wird zu viel vertraut. Andersdenkende in Wissenschaft und Medizin werden eingeschüchtert. Die Rede- und Meinungsfreiheit wird unterdrückt. Abweichlern drohen versteckte oder aber auch ganz unverhohlene, drastische Konsequenzen.
»Warum hat mich niemand davor gewarnt?«
Abigail Shrier hat sich gründlich mit der Transgenderepidemie beschäftigt. Dazu hat sie mit Mädchen gesprochen, mit deren leidgeplagten Eltern sowie mit Beratern und Ärzten, die eine Geschlechtsumwandlung ermöglichen. Auch mit »Detransitioners« hat sie sich ausgetauscht, jungen Frauen, die zutiefst bedauern, was sie sich selbst angetan haben.
Sich als transgender zu outen, steigert schlagartig das soziale Ansehen dieser Mädchen. Doch sind die ersten Schritte auf dem Weg der Geschlechtsumwandlung erst einmal getan, ist ein Umkehren sehr schwierig, wie Shrier feststellt. Sie gibt dringend benötigte Ratschläge, wie Eltern ihre Töchter schützen können.
Eine Generation junger Mädchen ist in Gefahr
Abigail Shriers Buch ist wichtig. Es hilft Ihnen, zu begreifen, was der Transgenderwahn wirklich ist und wie Sie Ihr Kind davor schützen. Shrier entwickelt aber auch Schritte, die Eltern dabei helfen, das Wohlergehen ihrer Töchter zu verbessern.
Jeder, der jemals skeptisch über den plötzlichen Ansturm des Transgenderwahns nachgedacht hat, sollte dieses Buch lesen.
»Irreversibler Schaden ... hat einen Sturm entfacht. Abigail Shrier, Autorin des Wall Street Journal, tut etwas sehr Simples, aber Verheerendes: Sie hält sich streng an die Fakten.« Janice Turner, The Times
»Die gefährlichste Frau Amerikas?«
Ist Abigail Shrier »die gefährlichste Frau Amerikas«? So fragt Die Welt. »Transgender-Aktivisten würden Abigail Shrier gerne mundtot machen und ihre Schriften verbrennen. Denn sie argumentiert, dass nicht jeder vermeintlich transsexuelle Teenager es wirklich ist. Auch in Deutschland brechen Shriers Einwände ein Tabu. (...)
Ärzte verschreiben den Mädchen mitten in der Pubertät männliche Hormone, obwohl das sehr gefährlich ist. Chirurgen schneiden ihnen die Brüste weg; eine Ärztin behauptete im Gespräch mit Abigail Shrier allen Ernstes, dies lasse sich später wieder rückgängig machen. Manche Mädchen entscheiden sich sogar zu der rabiaten Maßnahme, sich mithilfe von Haut und Venen vom Oberarm einen künstlichen Penis basteln zu lassen, eine Operation, bei der die Klitoris abgetrennt und dann wieder angenäht wird - ziemlich oft geht die Sache schief.«
»Mut ist eine seltene Gabe. Abigail Shrier hat jede Menge davon.« Dennis Prager, Moderator
Die American Civil Liberties Union (ACLU) findet Irreversibler Schaden ganz schlimm. Chase Strangio, ein Direktor des Vereins, schrieb: »Abigail Shriers Buch ist eine gefährliche Polemik ... Die Verbreitung dieses Buches und dieser Ideen zu stoppen ist zu 100 Prozent eine Sache, für die ich mein Leben hingeben würde.« Grace Lavery, eine Englischprofessorin in Berkeley, rief gar zu inquisitorischen Maßnahmen auf: »Ich möchte dazu ermutigen, dieses Buch zu stehlen und es auf einem Scheiterhaufen zu verbrennen.«
»Es erhebt sich die Frage, warum Abigail Shriers Buch eine dermaßen hysterische Wut (und knieschlotternde Angst) hervorruft.« Die Welt
Trotz ihres sensiblen Umgangs mit diesem wichtigen Thema wurde Abigail Shriers Buch in den USA von Medien, Buchhändlern und Werbeträgern boykottiert. Während der Economist es als »eines der besten Bücher des Jahres« bezeichnete, wurde es von den deutschen Medien fast vollständig ignoriert. Kein deutscher Verlag hatte den Mut, das Buch zu veröffentlichen. Nun ist es im Kopp Verlag erschienen - weil die Zukunft unserer Kinder zu wichtig ist.
»Dieses furchtlose Buch zeigt, wie die Körper von Mädchen zu Kollateralschäden in den Kulturkriegen der Erwachsenen geworden sind.« Janice Turner, The Times
»Dieses Buch möchte ich Ihnen gerne empfehlen! [...] Die deutsche Übersetzung erschien bei KOPP. Es ist bezeichnend, dass kein anderer deutschsprachiger Verlag es gewagt hat, dieses Buch zu übersetzen.« Philosophia Perennis
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
1. Auflage August 2023
Copyright © 2020 by Abigail Shrier
First published in the United States of America 2020 by Regnery Publishing c/o Writers’ Representatives LLC, New York
All rights reserved
Titel der amerikanischen Originalausgabe:Irreversible Damage. The Transgender Craze Seducing Our Daugthers
Copyright © 2023 für die deutschsprachige Ausgabe bei Kopp Verlag, Bertha-Benz-Straße 10, D-72108 Rottenburg
Alle Rechte vorbehalten
Übersetzung aus dem Amerikanischen: Collin McMahon Lektorat: Klara Louber Covergestaltung: Stefanie Huber Satz und Layout: Nicole Lechner
ISBN E-Book 978-3-86445-952-8 eBook-Produktion: GGP Media GmbH, Pößneck
Gerne senden wir Ihnen unser Verlagsverzeichnis Kopp Verlag Bertha-Benz-Straße 10 D-72108 Rottenburg E-Mail: [email protected] Tel.: (07472) 98 06-10 Fax: (07472) 98 06-11
Unser Buchprogramm finden Sie auch im Internet unter:www.kopp-verlag.de
Für Zach,dessen Liebemeine Geheimwaffe ist
Sie versteckt sich wie ein Kind,ist für mich aber stets eine Frau.
Billy Joel1
Vorbemerkung der Autorin
Ich gehe davon aus, dass Teenager noch nicht ganz erwachsen sind. Um der Ehrlichkeit und Klarheit willen verwende ich für biologisch weibliche Jugendliche, die in diesen Transgenderwahn geraten sind, die Pronomina »sie« und »ihr«.
Bei Erwachsenen mit Transidentität ist die Lage eine andere. Sofern dadurch keine unnötige Verwirrung entsteht, verwende ich für sie jene Pronomina und Präpositionen, die sie selbst bevorzugen.
Außerdem habe ich die Namen und persönlichen Daten der Jugendlichen (sowie ihrer Eltern), die sich als Transgender identifizieren, geändert, um sicherzustellen, dass sie sich nicht wiedererkennen und ihre kampfesmüden Eltern des Verrats bezichtigen können. Da sich die Geschichten der Opfer dieses ansteckenden Phänomens stark ähneln, könnten manche Leser auf den Gedanken kommen, sich wiederzuerkennen – doch sie irren sich.
Einleitung
Die Ansteckung
Lucy war schon immer ein »richtiges Girlie«, versicherte ihre Mutter. Als kleines Mädchen zog sie zum Erledigen ihrer Hausaufgaben High Heels an und verschwand in ihrem Kinderzimmer, das von Beanie Babies und Haustieren – Kaninchen, Meerschweinchen und Sittichen – nur so überquoll.
Am allerliebsten verkleidete sie sich. Sie hatte eine große Kiste voller Klamotten und Perücken, in die sie hineinschlüpfte, um eine Reihe von Figuren zu verkörpern, die allesamt weiblich waren. Sie war ein typisches Mädchen der späten 1990er-Jahre und liebte Disneyfilme mit prinzessinnenhaften Hauptfiguren wie Arielle, die Meerjungfrau, später die Twilight-Filme.
Lucy war ein frühreifes Kind. Mit 5 Jahren konnte sie lesen wie eine Viertklässlerin. Schon früh zeigte sie künstlerische Fähigkeiten und wurde später Preisträgerin ihres Landkreises. Als sie aber die Mittelstufe erreichte, bekam sie es immer häufiger mit Ängsten zu tun und verfiel in Depressionen. Ihre wohlhabenden Eltern – ihre Mutter war eine bekannte Anwältin aus den Südstaaten – schickten sie zu Therapeuten und Psychologen, doch egal wie viel Gesprächstherapie oder Medikamente sie bekam, ihre sozialen Probleme wurden nicht weniger. Sie wurde weiterhin von Cliquen ausgegrenzt und versagte aus lauter Nervosität, wenn sie von anderen Mädchen gelegentlich auf die Probe gestellt wurde.
Jungs machten ihr weniger zu schaffen, und sie hatte die ganze Highschoolzeit hindurch männliche Freunde und Partner. Ihr Familienleben war nicht gerade leicht: Ihre ältere Schwester wurde drogenabhängig, was ihre Familie wie ein Orkan heimsuchte und beiden Elternteilen die totale Aufmerksamkeit abverlangte. Lucys Aufs und Abs wurden irgendwann als Bipolar-II-Störung diagnostiziert. Weibliche Freunde zu finden und zu behalten wurde zu einer ständigen Herausforderung, die sich nie wirklich zu ihren Gunsten wendete.
Ihr Studium an einem privaten College in Neuengland begann – wie so oft heutzutage – mit der Einladung, ihren Namen, ihre sexuelle Orientierung und ihre Genderpronomina anzugeben. Um dazuzugehören und sich mit einer speziellen Gruppe identifizieren zu können, ergriff Lucy diese Chance, um sich neu zu definieren. Als ihre Angstsymptome im Herbst wieder zurückkehrten, kam sie zusammen mit einigen Freundinnen zu dem Schluss, ihre Angst finde eine Erklärung in dem Begriff »Genderdysphorie«, der gerade in aller Munde war. Binnen eines Jahres begann sie eine Testosterontherapie. Aber ihre eigentliche Sucht – die Droge, von der sie abhängig wurde – war die Verheißung, jemand anderes sein zu können. Mit geschorenem Kopf, Jungsklamotten und einem neuen Vornamen wurde sie von einem Mädchen in einen Jungen umgetauft beziehungsweise als Junge neu geboren.
Der nächste Schritt – falls sie so weit gehen wollte – wäre dann eine »Obenrum-OP«, ein Euphemismus für eine freiwillige doppelte Mastektomie.
»Woher wissen Sie, dass es keine echte Genderdysphorie war?«, fragte ich ihre Mutter.
»Sie hatte einfach noch nie solche Anzeichen gehabt«, so die Mutter. »Ich habe sie nie zuvor sagen hören, dass sie sich in ihrem Körper unwohl fühlt. In der vierten Klasse hat sie das erste Mal ihre Tage bekommen, was ihr total peinlich war, weil sie so früh dran war, aber sie hat sich nie über ihren Körper beklagt.« Ihre Mutter hielt inne und forschte in ihrem Gedächtnis nach. »Mit 5 Jahren habe ich ihr einen Bubikopf verpasst, und sie hat sehr viele Tränen vergossen, weil sie nicht wie ein Junge aussehen wollte. Sie hat es gehasst.« Um hinzuzufügen: »Sie ist mit Jungs ausgegangen. Immer nur mit Jungs.«
In diesem Buch geht es nicht um Transgendererwachsene, auch wenn ich im Laufe meiner Recherche mit vielen von ihnen gesprochen habe, und zwar sowohl mit jenen, die als Frauen, wie jenen, die als Männer auftreten. Diese freundlichen, nachdenklichen und anständigen Menschen schildern in der Regel ein fortwährendes Gefühl des Unwohlseins in einem Körper, in dem sie sich fehl am Platz fühlen, in einem Leben, das ihnen wie eine Lüge vorkommt. Und dieses Gefühl verfolgt sie schon, solange sie denken können.
Ihre Dysphorie hat ihnen nie soziale Vorteile gebracht oder sie beliebter gemacht, sondern führte weitaus häufiger zu peinlichen oder unangenehmen Situationen. Die meisten von ihnen hatten als Jugendliche niemand anderen mit Dysphorie kennengelernt. Es gab noch kein Internet, das ihnen Vorbilder und Mentoren liefern konnte, und sie brauchten auch keine, sondern wussten genau, wie es ihnen ging. Sie fühlen sich einfach als anderes Geschlecht wohler und wollen nicht dafür gefeiert werden, so zu sein, wie sie sind. Es geht ihnen hauptsächlich darum, als das von ihnen empfundene Geschlecht »durchzugehen« und nicht weiter aufzufallen.
Mit einigen habe ich offiziell, mit anderen inoffiziell gesprochen und sie für ihren Mut und ihre Aufrichtigkeit sehr bewundert. Einer von ihnen wurde sogar ein Freund. Dass so viele Transgenderaktivisten in ihrem Namen sprechen wollen, ist weder ihre Schuld noch ihre Absicht. Und mit dem aktuellen Trans-Hype, der Mädchen im Teenageralter plagt, haben diese Menschen im Allgemeinen sehr wenig zu tun.
Da sind die Hexenprozesse von Salem im 18. Jahrhundert schon näher dran. Ebenso die Neurasthenie-Epidemie des ausgehenden 19. Jahrhunderts,2 Anorexia nervosa3, Bulimie, das Syndrom der Erinnerungsverdrängung4 sowie das im 20. Jahrhundert weitverbreitete Ritzen.5 Und bei all diesen Phänomenen spielt eine Protagonistin ganz vorne mit, nämlich das heranwachsende Mädchen, das ihr psychisches Leid gerne aufbauscht und um sich greifen lässt.6
Sein Leid ist sicher echt. Aber in jedem der genannten Fälle kommt es zu einer falschen Selbstdiagnose, die weniger einer psychologischen Tatsache entspricht als das Resultat von Ermutigung und Suggestion ist.
Vor 30 Jahren hätten sich solche Mädchen vielleicht eine Fettabsaugung herbeigesehnt, während ihre Körperformen dahinschwanden. Und vor 20 Jahren hätten jene Teenies, die sich heutzutage mit Transgender identifizieren, womöglich eine verdrängte Erinnerung an ein Kindheitstrauma »entdeckt«. Statt um dämonische Besessenheit geht es bei dem aktuellen Diagnosewahn um »Genderdysphorie«. Und »geheilt« wird diese nicht durch Exorzismus, Abführmittel oder Entschlackung, sondern durch Testosteron und »Obenrum-Chirurgie«.
Man sollte sich kein Lieblingsthema unter den Grundrechten der Verfassung der Vereinigten Staaten (Bill of Rights, Anm. d. Lektorats) herauspicken, denn das ergibt keinen Sinn, ich habe aber eines, und das ist das erste, nämlich die Redefreiheit. Und so war es auch mein Einsatz für das Recht der freien Meinungsäußerung, der mich durch eine Hintertür zur Transgenderpolitik brachte.
Im Oktober 2017 wurde in meinem Bundesstaat Kalifornien ein Gesetz erlassen, das Pflegekräften und medizinischem Personal mit Haft droht, wenn sie sich weigern, Patienten mit den von ihnen gewünschten Genderpronomina anzureden.7 In New York gibt es ein ähnliches Gesetz für Arbeitgeber, Vermieter und Gewerbetreibende.8 Beide Gesetze sind ganz offenkundig verfassungswidrig. Der Erste Zusatzartikel der US-Verfassung garantiert uns seit Langem das Recht, sowohl ohne staatliche Einmischung unpopuläre Meinungen kundtun zu dürfen als auch, sich zu weigern, der Regierung nach dem Mund zu reden.
Und dabei geht es nicht um verfassungsrechtliche Nuancen, sondern um eine bemerkenswert einfache Angelegenheit. In der Rechtssache des Schulrats von West Virginia gegen Barnette 1943 entschied das Oberste Gericht der USA, dass Schüler nicht gezwungen werden können, vor der amerikanischen Flagge zu salutieren. »Wenn es in der Konstellation unserer Verfassung einen Fixstern gibt, dann ist es der Grundsatz, dass kein Beamter, egal wie mächtig er ist, entscheiden kann, was in Politik, Nationalismus, Religion oder in anderen Meinungsangelegenheiten allgemein gültig sein soll, oder dass Bürger in Wort oder Tat zu einem solchen Bekenntnis gezwungen werden können«, schrieb Richter Robert H. Jackson im Namen der Mehrheit aller Richter.
Wenn die Regierung Schüler nicht zwingen kann, vor der amerikanischen Flagge zu salutieren, kann sie Pflegekräfte auch nicht dazu zwingen, bestimmte Pronomina zu verwenden. In den Vereinigten Staaten kann der Staat niemanden zwingen, irgendetwas zu sagen, auch nicht aus Höflichkeit.
Als ich mich unter der Überschrift »Der Transgender-Sprachkrieg« für das Wall Street Journal dazu äußerte, schrieb mir eine prominente Südstaaten-Anwältin, nämlich Lucys Mutter, unter einem Pseudonym. Sie hatte meinen Artikel gelesen und etwas darin vermisst: Hoffnung. So bat sie mich, über die Erfahrung ihrer Tochter zu schreiben, die als Teenager plötzlich verkündet hatte, »transgender« zu sein, obwohl sie zuvor in ihrer Kindheit keinerlei Anzeichen von Genderdysphorie gezeigt hatte. Sie erklärte mir, Lucy habe ihre Identität im Internet entdeckt, wo eine endlose Auswahl an Transgendermentoren Jugendliche dabei coachen, eine neue Genderidentität zu finden, und ihnen sagen, wie sie sich kleiden, wie sie sich verhalten und was sie sagen sollen. Welche Internethändler die besten Brustabbinder verkaufen (eine Art Mieder, mit dem man den Busen versteckt), welche Organisationen diese gratis und diskret verpackt verschicken, damit die Eltern nichts mitbekommen. Wie man Ärzte dazu bringt, Hormone zu verschreiben. Wie man die Eltern hinters Licht führt oder, wenn sie sich deiner neuen Identität widersetzen, sich von ihnen lossagt.
Der Einfluss von Testosteron und der Reiz der Transgression, so ihre Mutter, machte Lucy wütend und abweisend. Sie weigerte sich, ihre neue Identität zu erklären oder Fragen dazu zu beantworten, und warf ihrer Mutter vor, »transphob« und eine »Gatekeeperin« zu sein. Lucys erfundene Geschichte, sie habe »schon immer gewusst, dass sie anders war« und sei schon »immer trans gewesen«, hatte sie, wie ihre Mutter später feststellte, Wort für Wort aus dem Internet.
Benutzten ihre Eltern ihren offiziellen Namen – jenen Namen, den sie ihr gegeben hatten – oder vergaßen sie, ihre neuen Pronomina zu verwenden, geriet Lucy in ihrem hochexplosiven neuen Zustand in Rage. Und bald erkannten ihre Eltern sie kaum wieder. Lucys plötzliche Bekehrung zu einer Genderideologie, die ihnen – zumindest biologisch gesehen – wie ziemlicher Humbug vorkam, alarmierte sie. Ihrer Mutter kam es vor, als habe Lucy sich einer Sekte angeschlossen, und sie fürchtete, ihre Tochter käme da womöglich nie mehr heraus.
Charakteristisch für eine Genderdysphorie – früher als »Geschlechtsidentitätsstörung« bezeichnet – ist ein anhaltendes und schwerwiegendes Unwohlsein mit dem angeborenen Geschlecht.9 Sie beginnt üblicherweise in der frühen Kindheit – im Alter von 2 bis 4 Jahren –, kann sich aber in der Pubertät verschlimmern. In den allermeisten Fällen – etwa 70 Prozent – legt sich die kindliche Genderdysphorie irgendwann wieder.10 Historisch gesehen betraf sie nur einen winzigen Prozentsatz der Bevölkerung (etwa 0,01 Prozent) und fast ausschließlich Jungs. Vor 2012 gab es tatsächlich keine wissenschaftlichen Studien darüber, dass Mädchen im Alter von 11–21 Jahren überhaupt so etwas wie eine Genderdysphorie entwickelt hätten.
Im letzten Jahrzehnt hat sich dies jedoch dramatisch geändert. In der westlichen Welt gab es einen plötzlichen Anstieg von Jugendlichen, die sich selbst als »transgender« bezeichnen und unter Genderdysphorie zu leiden behaupten. Zum ersten Mal in der Geschichte der Medizin sind gebürtige Mädchen überhaupt in dieser Gruppe vertreten, sie stellen sogar die überwältigende Mehrheit.11
Weshalb? Wie war das möglich? Wie konnte eine Altersgruppe, die zuvor nur einen kleinen Teil der betroffenen Jugendlichen ausgemacht hatte, plötzlich die Mehrheit stellen? Noch wichtiger aber: Warum hat sich der Geschlechteranteil auf den Kopf gestellt – von mehrheitlich Jungs zu mehrheitlich Mädchen?
Ich fand Lucys Mutter, die Südstaaten-Anwältin, sympathisch und ließ mich schnell von ihrer Geschichte einnehmen. Da ich aber Leitartikel schreibe und keine Investigativjournalistin bin, empfahl ich sie an eine Kollegin weiter und versicherte Lucys Mutter, dass sie dort in guten Händen sei. Doch auch nachdem ich mich anderen Themen für das Wall Street Journal zugewandt hatte und die Anwältin schon längst von meiner Agenda verschwunden war, musste ich immer wieder an sie denken. Das Thema ließ mich einfach nicht los.
3 Monate später schrieb ich also Lucys Mutter, und alle Kontakte, die sie mir genannt hatte, noch einmal an. Ich sprach mit Medizinern – Endokrinologen, Psychiatern und weltweit anerkannten Psychologen, die auf Genderdysphorie spezialisiert waren. Ich wandte mich an Psychotherapeuten. Ich kontaktierte Transgenderteenager und Transgendererwachsene, um ihr Inneres, ihre Erfahrungen und den befreienden Reiz der Identifikation mit dem anderen Geschlecht zu verstehen. Und ich suchte auch das Gespräch mit »Desistern« – Menschen, die sich irgendwann nicht mehr transgender gefühlt hatten – und »Detransitionierern« – Menschen, die mit geschlechtsverändernden medizinischen Maßnahmen begonnen hatten, diese aber bereuten und versuchten, diese rückgängig zu machen. Je mehr ich über Mädchen erfuhr, die sich plötzlich als transgender identifizierten, umso mehr verfolgte mich eine Frage: Was quält diese Mädchen?
Im Januar 2019 brachte das Wall Street Journal meine Story »Wenn deine Tochter der Biologie trotzt«. Der Artikel erhielt fast eintausend Kommentare und Hunderte von Antworten auf diese Kommentare. 2 Tage später reagierte eine Transgenderautorin namens Jennifer Finney Boylan mit einem Artikel in der New York Times. Auch ihr Kommentar erhielt Hunderte von Kommentaren und Antworten auf diese Kommentare. Plötzlich schwappte eine Flut von E-Mails über mich herein, in denen Leser erklärten, sie hätten das von mir geschilderte Phänomen mit ihren eigenen Kindern oder in deren Schulen erlebt: Gruppen von jugendlichen Klassenkameradinnen, die auf einmal entdeckten, dass sie transgender waren, und nach Hormontherapien und chirurgischen Eingriffen verlangten.
Als mich Transgenderaktivisten dann im Internet attackierten, lud ich sie ein, mir ihre Version der Geschichte zu erzählen. Manche gingen darauf ein, und es kam zu einem Gespräch. Ich wurde aber ebenso von Detransitionierern kontaktiert, woraufhin ich ein Konto auf Tumblr anlegte und Transgendermenschen und Detransitionierer einlud, mir zu schreiben, was tatsächlich viele taten. Dieselbe Einladung postete ich auch auf Instagram, wo Hashtags wie #testosteron, #transjunge und #ftm (female-to-male, also weiblich-zu-männlich, Anm. d. Lektorats) Tausende von Followern verbinden. Dabei betonte ich immer wieder meine Bereitschaft, jedem zuzuhören, der etwas zu diesem Thema zu sagen hat. Die Antworten, die ich erhielt, wurden zur Grundlage dieses Buches.
Offenbar hatte man in den USA auf diese Geschichte regelrecht gewartet. Ob Sie nun eine pubertierende Tochter haben oder nicht, ob Ihr Kind auf diesen Transgenderwahn hereingefallen ist oder nicht – aus Gründen, die allesamt mit unserer kulturellen Labilität zu tun haben, fällt diese Massenhysterie in den USA zurzeit auf fruchtbaren Boden: Eltern werden untergraben; Experten überschätzt; andersdenkende Wissenschaftler und Mediziner eingeschüchtert; die Meinungsfreiheit wird immer wieder angegriffen; staatliche Verordnungen und medizinische Gesetze bergen unbeabsichtigte Konsequenzen. Wir sind in einem intersektionalen Zeitalter gelandet, in dem das Bedürfnis, einer dominierenden Identität zu entkommen, den Einzelnen dazu treibt, in Opfergruppen Zuflucht zu suchen.
Um die Geschichte dieser Mädchen zu erzählen, habe ich beinahe 200 Interviews geführt und mit fast 60 Familien von Jugendlichen gesprochen. Ich habe mich teilweise auf die Berichte der Eltern verlassen. Da die klassische Genderdysphorie in früher Kindheit beginnt und von einem »anhaltenden, intensiven und gleichbleibenden«12 Gefühl des Unwohlseins im eigenen Körper (was ein kleines Kind kaum verbergen kann) bestimmt wird, sind die Eltern oft die besten Zeugen dafür, ob die ausgeprägte jugendliche Dysphorie schon im Kindesalter auftrat oder nicht. Die Eltern wissen am besten, ob die Probleme, die viele weibliche Teenager heute erleben, einer klassischen Genderdysphorie entspringen oder für etwas ganz anderes stehen.
Natürlich kann man sich nicht völlig auf die Eltern verlassen, was die Gefühle anbelangt, die ihre heranwachsenden Kinder in Bezug auf ihre Transgenderidentitäten und das damit einhergehende neue Leben haben. Über deren schulische oder berufliche Leistungen sowie ihre finanzielle und familiäre Situation aber, ja manchmal sogar über ihre sozialen Erfolge und Niederlagen können Eltern einigermaßen zuverlässig Auskunft geben. Gehen diese Transgenderjugendlichen noch in die Schule oder nicht? Haben sie mit ihren alten Freunden noch Kontakt? Sprechen sie überhaupt noch mit ihrer Familie? Arbeiten sie auf eine Zukunft mit einem Lebensgefährten hin? Oder leben sie von der Hand in den Mund als Barista im nächsten Café?
Ich bilde mir nicht ein, die komplette Lebenswirklichkeit dieser Jugendlichen und noch weniger die Komplexität des Transgendererlebnisses abgebildet zu haben. Überall werden Transgendererfolgsgeschichten verbreitet und gefeiert. Sie sind Teil der Regenbogenallianz und versprechen, die nächste kulturelle Barriere niederzureißen und eine weitere Grundlage menschlicher Unterschiede zu erschüttern.
Beim Phänomen der Transgendermode unter Teenagermädchen handelt es sich jedoch um etwas völlig anderes. Sie rührt nicht von einer klassischen, das ganze Leben durchziehenden Genderdysphorie her, sondern wird plötzlich in der Pubertät durch Videos getriggert. Dabei geht es eher um eine Art Rollen- und Verkleidungsspiel, das von Internetgurus beflügelt wird und zu einem Pakt unter jungen Mädchen führt, die mit angehaltenem Atem und zugekniffenen Augen Händchen halten. Diesen Mädels bietet die Transidentität Freiheit von der Angst, die sie unerbittlich verfolgt; sie befriedigt das enorme Bedürfnis nach Akzeptanz, den Nervenkitzel des Verbotenen und das verführerische Gefühl, dazuzugehören.
Wie mir der Transgenderjugendliche »Kyle« sagte: »Das Internet ist der halbe Grund dafür, dass ich mein Coming-out gewagt habe. Chase Ross ist ein YouTuber. Ich war 12 und bin ihm mit religiösem Eifer gefolgt.« Chase Ross war so freundlich, mit mir zu sprechen, denn ich wollte sein Geheimrezept verstehen. Seine Geschichte kommt in Kapitel 3 zur Sprache.
Es handelt sich hier um die Geschichte der amerikanischen Familie – anständige, liebevolle, fleißige, freundliche Menschen. Sie will das Richtige tun. Aber sie befindet sich in einer Gesellschaft, die Eltern zunehmend als Hindernisse, Fanatiker und Idioten betrachtet. Wir sehen zu, wie Mädchen im Teenageralter, die keine genderdysphorische Vorgeschichte haben, in eine radikale Genderideologie eintauchen, die sie in der Schule oder im Internet kennenlernen – angefeuert von Gleichaltrigen, Therapeuten, Lehrern und Influencern. Nur ist in dem Fall der Preis für ihren jugendlichen Leichtsinn nicht bloß eine Tätowierung oder ein Piercing, sondern eher ein halbes Kilo Fleisch.
Ein sehr kleiner Teil der Bevölkerung wird immer transgender sein. Aber vielleicht werden wir irgendwann wieder an den Punkt kommen, wo ängstliche junge Mädchen ohne genderdysphorische Vorgeschichte nicht mehr durch eine Transgendermode zu einem Leben voller Hormontherapien und entstellender chirurgischer Eingriffe verführt werden. Wenn es sich dabei um eine gesellschaftliche Ansteckung handelt, kann die Gesellschaft vielleicht auch etwas gegen sie unternehmen.
Kein Teenager sollte für ein vorübergehendes Mitläuferdasein einen derart hohen Preis zahlen müssen.
Kapitel 1
Die Mädchen
Wenn Sie vor 1990 in Amerika geboren wurden, stellen Sie sich unter dem Begriff »Teenagermädchen« vermutlich eine Gruppe kichernder junger Damen im Einkaufszentrum vor. Rücklings auf einem Plüschteppich in ihrem Zimmer liegend, einen Song auf Dauerschleife, während sie in ähnlicher Weise am Telefon hängen, auf der Jagd nach einer zweideutigen Interaktion mit einem Jungen oder einem Mädchen. Zahllose mit Belanglosem zugebrachte Stunden, die sich irgendwie zu einer echten Freundschaft aufsummieren und in denen sie sich vom ersten Kuss, von Herzschmerz oder der Sehnsucht nach beidem und keinem von beidem erzählen, die Luft von Nagellackentferner geschwängert.
Um die Transepidemie unter Teenagermädchen zu verstehen, müssen wir erforschen, wie sehr sich das Leben junger Frauen inzwischen von diesem Bild entfernt hat. Nicht nur, weil die Technik sich verändert hat und es statt CDs Spotify, statt Festnetztelefon WhatsApp gibt, sondern weil die Pubertät heute viel weniger persönliche Begegnungen mit all den Enttäuschungen und Aufmunterungen bereitstellt, die früher einmal den Alltag eines Teenagers ausmachten: auf ein Date eingeladen zu werden, geküsst oder befummelt zu werden; mit der besten Freundin darüber zu jubeln, zu lachen und zu weinen, dazu nicht nur ihre Worte, sondern die Präsenz ihrer Stimme und ihr Gesicht, die dir versichern: Du bist nicht alleine.
Ich kann mich noch an meinen ersten Kuss mit Joel in der Mittagspause hinter unserer jüdischen Schule erinnern. Seine Augen waren hellbraun. Sein Atem roch nach Zimtkaugummi. Ein Zungenschlag, der keuchende Atem und der Duft seines Rasierwassers von Drakkar Noir hauten mich um und ließen mich betäubt zurück.
Als es vorbei war, zwang ich mich, ganz locker wieder hineinzugehen. Sah man es mir an? Sah ich anders aus? Ganz sicher, dachte ich, denn ich fühlte mich ja anders. Jedes Molekül der Welt schien auf subtile Weise neu angeordnet zu sein. Ich hatte den Drang, zu rennen, zu schreien und zu lachen, doch seltsamerweise auch, das alles wieder rückgängig zu machen. Dahinter stand die Sorge, dass ich etwas falsch gemacht hatte. Aber nach der Logik der Mittelschule der 1990er-Jahre war es das Mindeste, bei der Kussinszenierung mitzumachen. Schließlich war ich Joels Freundin.
Bis 2 Wochen später, da war ich es nicht mehr. Er hatte einer meiner Freundinnen gegenüber geäußert, ich sei keine »gute Küsserin«. Na gut. Ich war ja auch erst 12 Jahre alt. Er hatte schon eher mit mir Schluss machen wollen, musste aber warten, mich alleine zu erwischen.
Meine Freundin Yael lieferte mir Details, die sie bei seinen Freunden aufgesammelt hatte – eine Litanei meiner Defizite als Freundin. Also kehrte ich zu meinen alten Freunden zurück: zu Aaron, der mich schon vermisst hatte; Jill, die Joel ohnehin nicht so toll fand; Ariel, der sofort die Gelegenheit ergriff, mich für meinen kurzen romantischen Erfolg abzustrafen, denn, so sagte er, es sei doch allgemein bekannt, dass Joel auf Jennifer stünde. Auch die besten Freunde erwiesen sich nicht immer als die besten Tröster.
Aber so unvollkommen ihre Unterstützung auch war, es gab sie. Da waren Joel, der die Nachricht überbrachte; Yael, die den Kontext und Kommentar dazu lieferte; Aaron, der das Traumatische des Ganzen hilfreicherweise gar nicht wahrnahm; Jill, die mit den Augen rollte und mich anbettelte, mit einem Fußball herumzukicken; Ariel, der mich abstrafte, bevor er mich wieder akzeptierte. Die durchwachsene, sich unter Wert verkaufende Menschlichkeit, die man so kennt. Jedes bisschen Schmerz oder Trost kam von jemandem, der mir direkt in die Augen sah; jemandem, den ich erreichen und in die Arme schließen konnte, wenn ich wollte.
Für junge Frauen, die 1990, 1980 oder 1970 geboren wurden – und vielleicht sogar für die Generationen bis in die 1940er-Jahre –, hatten peinliche persönliche Erlebnisse während der Pubertät einen gemeinschaftlichen Charakter. Frauen, die wie ich 1978 geboren wurden und in einer Zeit aufwuchsen, als Teenager wie geladene Teilchen waren, die ständig aufeinanderprallten, fällt es schwer, sich die Isolation der Jugendlichen von heute vorzustellen.13
Mein Jahrgang, der in den frühen 1990er-Jahren erwachsen wurde, erreichte den Höchststand an Teenagerschwangerschaften in den USA.14 Seither fällt diese Rate – wie die Häufigkeit von Teenagersex allgemein – wieder steil ab und befindet sich nun auf einem Tiefstand, wie wir ihn seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen haben.15 Eine Erklärung dafür ist der Mangel an Gelegenheit: Die Teenager von heute verbringen viel weniger Zeit mit Freunden – bis zu einer Stunde weniger täglich – als die Mitglieder der Generation X.16 Und sie sind einsam, sehr einsam. Einsamer, als alle Generationen je zuvor zu Protokoll gegeben haben.17
Doch wir wollen nicht in die Nostalgiefalle tappen. Teenager sind heute toleranter, sagt die akademische Psychologin Jean Marie Twenge, die sich auf die Anfang 2000 geborene Generation (Generation Z oder iGeneration) spezialisiert hat. Die Abtreibungsraten unter Teenagern sind eingebrochen,18 und es ist Jahrzehnte her, dass sich Eltern wegen zu viel »Petting« und Oralverkehr auf Schulklos Sorgen machen mussten.
Um zu begreifen, warum einige der intelligentesten und vielversprechendsten jungen Frauen unserer Zeit dem Transgenderwahn anheimgefallen sind, sollten wir verstehen, dass junge Frauen heutzutage sehr viel auszuhalten haben. Laut dem Wissenschaftspsychologen Jonathan Haidt leiden Teenager in den USA, in Kanada und im UK an einer »Krise der geistigen Gesundheit« und weisen ein noch nie da gewesenes Maß an Angst und Depression auf.19
Zwischen 2009 und 2017 nahm die Zahl der Highschoolschüler, die mit Selbstmordgedanken spielten, um 25 Prozent zu.20 In den Jahren 2005–2014 stieg die Zahl von Teenagern mit klinischer Depression um 37 Prozent, wobei es die Teenagermädchen am härtesten traf, denn sie litten drei Mal so oft daran wie Jungs.21
Auf den Einwand, dies könne daran liegen, dass Mädchen häufiger über ihre Depression sprechen (und nicht unbedingt öfter unter einer solchen leiden), weist Haidt darauf hin, dass die Häufigkeit von Selbstverletzungen ebenfalls zugenommen habe, nämlich seit 2009 um ganze 62 Prozent, und dies allein unter Mädchen im Teenageralter.22 Selbstverletzendes Verhalten unter Mädchen im Alter von 10 bis 14 ist seit 2010 um 189 Prozent angestiegen, was fast eine Verdreifachung in nur 6 Jahren bedeutet.
»Was ist da passiert?«, fragte der weltführende Podcaster Joe Rogan Haidt. Woran der plötzliche Zuwachs von Angst, Depression, und Selbstverletzungen denn liege? »Soziale Medien«, antwortete Haidt unverzüglich.23
Jean Marie Twenge schrieb im Atlantic: »Es ist keine Übertreibung zu sagen, die iGeneration befinde sich am Rand der schlimmsten psychischen Krise seit Jahrzehnten. Und diese Krise ist hauptsächlich auf ihre Telefone zurückzuführen.«24
Das erste iPhone kam 2007 auf den Markt. 10 Jahre später, im Jahr 2018, hatten 95 Prozent aller Teenager Zugang zu einem Smartphone, und 45 Prozent erklärten, sie seien »beinahe ständig«25 online. Auf Tumblr, Instagram, TikTok und YouTube, die bei Teenagern außerordentlich beliebt sind, finden sich jede Menge Anleitungen zu Selbstverletzung: Anorexie (die hier »Thinspiration« oder »Thinspo«, »Inspiration zum Dünnwerden« genannt wird), Ritzen und Suizid. Wer seine Erlebnisse mit einer dieser Störungen schildert, dem winken Hunderte, ja Tausende Follower.26 Seit der Einführung des Smartphones haben Anorexie, Ritzen und Suizid rasant zugenommen.27
Heutzutage ein weiblicher Teenager in den USA oder Europa zu sein bedeutet fast unweigerlich, sich Sorgen machen zu müssen, dass der eigene Körper nicht die allgemeinen Erwartungen erfüllt. In früheren Zeiten hätte sich das Schönheitsideal vielleicht an den paar Klassenkameradinnen festgemacht, die von Geburt an schön waren. Sie brauchten sich bloß in der Umkleide vornüberzubeugen und ihre Haare um sich zu werfen und wussten genau (was für mich das größte Rätsel war), wann sie lächeln oder lieber den Mund halten sollten. Aber nur wenige Mädchen in meiner Klasse waren im herkömmlichen Sinn schön, das musste der Rest von uns zähneknirschend zur Kenntnis nehmen. Doch wie unsere Begegnungen bestätigten, die immer von Angesicht zu Angesicht stattfanden, waren selbst sie nicht perfekt – nicht wirklich, sondern Menschen wie wir anderen auch und damit angreifbar und verletzlich. Auch sie machten Fehler und hatten Probleme, trugen etwa ihr Parfüm zu stark auf oder hatten Zahnspangen, die hervorblitzten, wenn sie lächelten, und die Pubertät forderte plötzlich ihren Tribut: Sie bluteten durch ihre Jeans und schwitzten ihre Turnsachen voll.
Influencer auf den sozialen Medien hingegen – also die wichtigsten »Freunde« für die Jugendlichen von heute, mit denen sie die meiste Zeit verbringen – dulden keine solchen Fehler. Sorgfältig in Szene gesetzt und mit der Foto-App Facetune28 gefiltert, schaffen ihre Selfies ein völlig unrealistisches Schönheitsideal, dem kein echtes Mädchen je entsprechen könnte. Ständig in den Hosentaschen unserer heutigen Teenagermädchen, schüren sie deren Ängste vor Unzulänglichkeit und verstärken ihre Fixierung auf ihre angeblichen Makel – und übertreiben dabei noch gewaltig.29
Selbst unter den besten Voraussetzungen waren Teenagermädchen schon immer die schärfsten, grausamsten Kritiker ihres eigenen Körpers sowie der Körper der anderen. Doch heute betrachten sie das alles unter dem unerbittlichen Vergrößerungsglas der sozialen Medien.
Wie viel weniger hübsch bist du als deine Freundin? Um die Antwort auf diese Frage zu finden, müssen die Teens von heute nicht lange herumrätseln, eine einfache Subtraktion ihrer »Likes« genügt. Das Scheitern ist vorherbestimmt, öffentlich und sehr persönlich.
Wir wissen, dass soziale Medien Menschen ängstlich und traurig machen. Wir wissen auch, dass Teenagermädchen am härtesten davon betroffen sind. Doch es kommt noch etwas hinzu: Während sie sich früher zu zweit oder in Gruppen den Herausforderungen des Lebens stellten, sind sie mit diesen nun überwiegend alleine konfrontiert.
Die Angehörigen der Generation Z hängen seltener mit Freunden ab, haben seltener Dates, machen seltener Ausflüge, gehen seltener auf Partys, ins Einkaufszentrum oder ins Kino als irgendeine Generation vor ihnen.30 Im Jahr 2015 waren Highschoolabsolventen seltener mit Freunden unterwegs als Achtklässler nur 6 Jahre zuvor.31 Und wenn sie sich persönlich treffen, bringen sie weitaus häufiger ein Elternteil mit.
Mit Mama im Schlepptau gehen sie viel weniger Risiken ein, was beispielsweise Rauchen, Trinken oder rücksichtsloses Autofahren anbelangt; und nur 71 Prozent jener Schüler, die zur Highschool zugelassen sind, verfügen über einen Führerschein – weniger als vor Jahrzehnten.
Das scheint auf den ersten Blick eine gute Sache zu sein. Doch diese Verhätschelung hat Konsequenzen. Denn Risiken einzugehen und Grenzen auszuloten ist eine unverzichtbare Übergangsphase auf dem holprigen Weg zum Erwachsensein.32 18-Jährige von heute verfügen über die emotionale Reife von 15-Jährigen der Generation X, 13-Jährige über jene von 10-Jährigen, konstatiert Twenge. »Teenager sind physisch so abgesichert wie nie zuvor, aber psychisch verletzlicher denn je«.33
Sie leiden viel weniger an den Wunden, die durch die für Teenager typische Kopflosigkeit entstehen, wachsen aber auch nicht an deren Narben. Wer ins Fegefeuer der jugendlichen Revolte hinabsteigt, verbrennt sich vielleicht daran. Doch wer es überlebt, ist für das Leben gestählt und hat jede Menge Verletzbarkeit ausgetrieben bekommen. Bei meinen Recherchen zum Transgenderwahn habe ich mit mehr als vier Dutzend Eltern gesprochen und in verschiedenen Variationen immer wieder gehört: »Meine Tochter ist 17, aber wenn Sie sie kennenlernen würden, würden Sie sie für 14 halten.«
Viele heranwachsende Mädchen, die dem Transgenderwahn verfallen, sind gutbürgerliche Vertreter der Generation Z oder iGeneration. Sorgsam behütet von Eltern, für die das Elternsein eine aktive Tätigkeit ist, ja sogar ein Lebenswerk, sind sie oft Vorzeigeschüler. Bis zu dem Zeitpunkt, wo sie dem Transgenderwahn erliegen, fallen diese Jugendlichen durch ihre höfliche, freundliche und wohlerzogene Art und ihren völligen Mangel an Widerstandsgeist auf. Die meisten haben noch nie eine Zigarette geraucht und trinken auch keinen Alkohol.
Sie waren auch noch nie sexuell aktiv. Viele haben noch nie geküsst – weder einen Jungen noch ein Mädchen. Laut Sasha Ayad, einer Therapeutin, die sich in erster Linie um Jugendliche kümmert, die sich als transgender identifizieren, haben die meisten von ihnen noch nie onaniert. Ihre Körper sind für sie noch ein Buch mit sieben Siegeln, ihre innersten Sehnsüchte unerforscht und weitgehend unbekannt.
Aber sie leiden – und wie. Sie leiden unter Unsicherheit und Depressionen, sind ängstlich und unbeholfen. Wie ein Kleinkind, das gelernt hat, die Bettkante zu meiden,34 spüren sie, dass zwischen den unsicheren Mädchen, die sie sind, und den glamourösen Frauen, die sie laut den sozialen Medien sein sollten, eine gefährliche Kluft liegt. Diese Kluft zu überbrücken scheint hoffnungslos.
Das Internet lässt ihnen keinen Tag Auszeit, nicht einmal eine Stunde. Sie sehnen sich nach den Höhen und Tiefen einer Teenagerromanze, aber ihr Leben spielt sich hauptsächlich auf ihren iPhones ab. Sie probieren mal das Ritzen aus oder versuchen sich an Magersucht. Dann werden sie von ihren Eltern zum Psychiater geschleppt, der ihnen Medikamente verschreibt, um ihre Launen in Watte zu packen. Das hilft auch – nur eben nicht, etwas zu fühlen.
Wo ist all der ausgelassene Spaß, der ihnen von Rechts wegen zustehen sollte? Sie haben ihre Eltern erzählen hören und Filme gesehen, doch wie soll man den legendären Roadtrip erleben, wenn keiner deiner Freunde einen Führerschein hat und die Eltern dich ohnehin lieber zu Hause wissen? Wenn die Läden nicht schon dicht gemacht haben und wenn Teenager dergleichen überhaupt noch täten (was nicht der Fall ist), könnten sie ins Einkaufszentrum oder in die Fußgängerzone gehen. Nur kann die schnöde Wirklichkeit einer Heimatstadt wohl kaum mit den unendlichen Weiten des Internets mithalten, die stets auf dem iPhone locken und genial auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnitten sind.
Wer vor einem Jahrzehnt an Frau-zu-Mann-Transsexuelle dachte, hatte vermutlich Hillary Swanks oscarprämierte Darstellung von Teena Brandon im Film Boys Don’t Cry von 1999 vor Augen. Swanks Darstellung war ergreifend und erschütternd. Teena Brandon tauft sich in »Brandon Teena« um, kleidet sich wie ein Junge und geht meistens auch als einer durch. Sie reißt Mädchen auf, ext Biere und fährt ungestüm mit dem Auto durchs ländliche Nebraska. Was Brandon antreibt, ist ein erstaunlich traditioneller Begriff von Männlichkeit: Brandon will das richtige Mädchen kennenlernen, sie umwerben, heiraten und glücklich machen.
Man fiebert den ganzen Film hindurch mit ihr mit und wünscht sich nichts mehr, als dass es ihr gelingt. Die Anfeindungen und Misshandlungen, die Brandon heldenhaft erduldet, das Wissen, dass in dieser Zeit und an diesem Ort vermutlich niemand Brandon die Freundlichkeit und Zärtlichkeit bieten wird, nach der sie sich sehnt, die beklemmende Vorahnung, dass das alles nur tragisch enden kann – das alles zerreißt dem Zuschauer das Herz.
Die Teenagermädchen, die sich heute Transgender nennen, haben mit diesem Film so gut wie nichts mehr gemeinsam. Sie wollen nicht als Jungs »durchgehen« – nicht wirklich. Sie lehnen im Grunde die ganze Mädchen-Junge-Dichotomie ab, der Brandon Teena nacheiferte, und bemühen sich kaum darum, typische männliche Angewohnheiten zu übernehmen: Nur in seltenen Fällen kaufen sie sich eine Hantelbank, gucken Fußball oder starren Mädchen hinterher. Wenn sie sich tätowieren lassen, dann mit weiblichen Motiven – Blumen oder Zeichentricktierchen, vor allem solchen, die sie als etwas anderes als männlich oder weiblich kennzeichnen. Sie betrachten sich als »queer« und bestimmt nicht als »Cis-Männer«, also als männlich im traditionellen Sinne, und fliehen Hals über Kopf vor ihrer Weiblichkeit wie aus einem brennenden Gebäude, ohne zu wissen, wo sie überhaupt hinwollen – Hauptsache raus.
Nur 12 Prozent jener Mädchen, die als Mädchen geboren wurden und sich als Transgender bezeichnen, haben eine Phalloplastie (Penis-Konstruktion) vornehmen lassen oder eine solche geplant.35 Es ist ihnen nicht wichtig, jenes Körperteil zu bekommen, das die meisten Menschen als wesentliches Kennzeichen von Männlichkeit erachten. Laut Sasha Ayad sagen »die meisten Mädchen so etwas wie ›Ich will nicht unbedingt ein Junge sein, ich weiß nur, dass ich kein Mädchen sein will‹«.
»Julie«
Für die meisten Mädchen ist es nur ein ferner Traum, professionelle Balletttänzerin zu werden. Julie hatte jedoch in der Mittelschulzeit echte Chancen, es wirklich zu schaffen. Sie brillierte im Spitzentanz, ergatterte Hauptrollen in ihrer Tanzcompany und tanzte so gut wie pausenlos. Schulferien bedeuteten für sie, endlich Vollzeit tanzen zu können, und so qualifizierte sie sich in den Sommerferien immer für einen Intensivkurs.
Julies Mütter sind Lesben und stammen aus dem Mittleren Westen der USA, die eine Erbschaftsanwältin, die andere Schultherapeutin – keine von beiden ist ideologisch oder aktivistisch unterwegs. »Niemand von unseren Freunden ist lesbisch oder schwul. Sie sind einfach nur unsere Freunde und ganz normale Leute«, beteuerte Shirley, eine von Julies Müttern, und musste dann lachen. »Da ist dieses Wort schon wieder: ›normal‹!« Wenn sie danach gingen, in wen sich Julie verknallte, mussten sie denken, sie sei hetero, und das war prima.
Bis zum Ende der dritten Klasse wurde Julie zu Hause unterrichtet. Ab der vierten Klasse kam sie auf eine Privatschule für Mädchen, wo sie rasch eine ausgezeichnete Schülerin wurde, aber soziale Schwierigkeiten hatte. Sie hatte zwar Freunde, aber nicht viele. »Sie war immer ein körperlich sehr aktives Mädchen«, so ihre Mutter. »Das ist mit ein Grund dafür, warum sie so gern tanzte. Sie hatte einfach unwahrscheinlich viel Energie.« In der Mittelstufe erhielt sie vorübergehend einen Schulverweis, weil sie eine Mitschülerin geschubst hatte. »Die Mädels haben an der Bushaltestelle rumgealbert, und Julie hat eine von ihnen umgeschubst, die vor Kurzem am Unterleib operiert worden war, was Julie natürlich nicht wissen konnte.«
In der neunten Klasse wurden alle Mädchen dazu angeregt, sich einer Schulaktivität anzuschließen, und Julie trat der beliebten Gay-Straight-Alliance GSA (Schwul-Hetero-Allianz) bei. Für ihre Mütter war das ein positives Zeichen dafür, dass sie Solidarität mit einer Gruppe zeigte, der auch sie angehörten. Dabei kündigte Julie auch kein Coming-Out an. »Soweit ich weiß, fühlte sie sich hetero. Sie war mädchenhaft und feminin und schien völlig normal zu sein«, sagte Shirley und lachte wieder verlegen.
Weder als Kind noch als Jugendliche wies Julie Anzeichen für eine Genderdysphorie auf. »Sie kam in die Pubertät, ihr Körper entwickelte sich, und sie trug wie eine ganz normale 15- oder 16-Jährige am Pool einen Bikini.«
Ihre Mutter wollte sie mehr als einmal die GSA-Treffen früh morgens verschlafen lassen, doch Julie weigerte sich. Bei der GSA gab es ein älteres Mädchen namens Lauren, eine Oberstufenschülerin, von deren Zuspruch Julie stark abhängig zu sein schien. »Es drehte sich immer alles um Lauren«, erzählte Shirley.
Die Verehrung, die Julie ihrer neuen Freundin erwies, verstörte ihre Mütter ein wenig. Oft traf sich Julie nach der Schule mit Lauren, die ihr dann japanische Trickfilme, sogenannte Animes, vorstellte, in denen menschenartige Tiere auftreten. »Ich hatte keine Ahnung, dass das mit der Transgenderkultur zu tun hat«, bezeugte Shirley. Julie begann online auf DeviantArt zu gehen, ein Kunstforum für junge Leute, das bei der Transgendergemeinde beliebt ist und wo sich viele Kommentare mit der Genderideologie beschäftigten.36
In der zehnten Klasse bekam Julie die Hauptrolle im Ballett Aschenbrödel, und sie lud alle ihre Freundinnen und zwei Lehrer zur Premiere ein. »Sie war begeistert und hat das super gemacht.« Aber als Julie am Ende auf die Bühne kam, um sich zu verbeugen, sah Shirley, wie sie mit Lauren Blickkontakt aufnahm. »Sie schien sich zu schämen und wurde blass. Es war, als ob die ganze Freude aus ihrem Körper gesaugt wurde.« Lauren hatte sich zu diesem Zeitpunkt schon als »transgender« geoutet, aber Julies Mütter hatten davon keine Ahnung – auch nicht davon, dass ihre Tochter ebenfalls mit dem Gedanken spielte, diese Identität anzunehmen.
Geschlechtsspezifische Darbietungen, wie man sie im Ballett findet, sind ein Schlag ins Gesicht der Transgenderideologie. Für Transgenderjugendliche ist geschlechtsspezifisches Verhalten, das mit dem eigenen Geschlecht übereinstimmt, ein absolutes No-Go: Es entlarvt diejenigen, denen es an Überzeugung fehlt und die in Wahrheit nur »cis« sind.
Julie musste sich mit der Genderideologie noch vertraut machen. Eine Freundin hielt in diesem Jahr ein Referat über Gender und Geschlechteridentität und führte die »Genderbread Person« (»Lebkuchenperson«) ein, ein beliebtes Mittel der Genderlehre, in der der Umriss eines Menschen in Form eines Lebkuchenmännchens verwendet wird. Pfeile verorten die »Genderidentität« im Hirn und die »Anziehungskraft« im Herzen. Der »Genderausdruck« wird im ganzen Körper lokalisiert, und die Pfeile für »biologisches Geschlecht« verweisen auf den Unterleib.
Julie war fasziniert, Shirley verstört. »Ich fragte mich: Ist das wirklich so eine gute Idee, Menschen so zu zerstückeln? Warum sollte man sich so in Einzelteile zerlegen?«
In der zehnten Klasse verschärfte sich der Druck in Julies Ballettcompany, die anderen Tänzerinnen wurden immer zickiger und rivalisierten mit ihr. »Sie war ängstlich und deprimiert und erzählte uns, sie habe sich geritzt.« Ihre Mütter fanden rasch einen Therapeuten für sie. Bei der ersten Sitzung legte der Therapeut nahe, Julie könnte an Genderdysphorie leiden, und überwies sie an einen Endokrinologen wegen einer Hormontherapie. »Es war das erste und letzte Treffen bei diesem Therapeuten, wenn man so will«, konstatierte Shirley.
Ihre Mütter fanden einen anderen Therapeuten, der sich zwei- bis dreimal monatlich mit Julie traf. »Mehr konnten wir uns nicht leisten.« Ihre Mütter mussten schließlich auch für die Privatschule und die Ballettstunden aufkommen.
Zu Beginn fragte der Therapeut Julie nach ihren Pronomina. Julie nannte einen männlichen Namen und männliche Fürwörter, die der Therapeut fortan auch verwendete. Die ganze Bestätigung und Unterstützung machte Julie jedoch nicht etwa glücklich und zufrieden, sondern immer unsicherer und unglücklicher. »Wenn sie von dem Therapeuten zurückkam und all diese Bestätigungen erhalten hatte … war sie jedes Mal feindselig, distanziert und frech.«
Ab der elften Klasse hatte Julie keine Lust mehr auf Ballett, denn sie hatte einen neuen Traum: Sie wollte ein Junge sein. Sie schnitt sich die Haare kurz und forderte von ihren Müttern, mit ihrem neuen Namen und Pronomen angeredet zu werden. »Wir haben uns eine Weile lang dagegen gewehrt. Dann dachten wir, probieren wir es mal, aber es geschah wieder dasselbe: Sobald wir sie mit ihrem neuen Namen anredeten, wurde sie feindseliger und distanzierter und entfremdete sich emotional immer mehr. Circa eine Woche später kamen wir zu dem Schluss, dass auch diese Therapie nicht half, und so ließen wir es wieder bleiben.«
Shirley sprach mit der Schulleitung, die ihr versicherte, dass sie eine Mädchenschule seien und Julie als Mädchen behandeln würden, solange sie dort zur Schule gehe, und dazu gehörten auch ihr Mädchenname und die entsprechenden weiblichen Fürwörter. »Doch das Gegenteil war der Fall.« Denn ohne es den Eltern mitzuteilen, begannen Julies Lehrer, der Schulleiter und ihre Freunde, Julie wunschgemäß mit ihrem männlichen Namen und den entsprechenden Pronomina anzureden. Julie fing an, ein Doppelleben zu führen. »Je mehr Zeit sie in der Schule oder am Computer verbrachte, desto feindseliger, zurückgezogener und deprimierter wurde sie. Wir hatten keine Ahnung, dass sie sich selbst mit diesen YouTube-Videos indoktrinierte.«
Damals hatten Julies Eltern noch keine Kenntnis von den YouTube-Influencern, denen ihre Tochter intensiv zu folgen begonnen hatte, doch sie spürten, dass ihre Tochter ihnen entglitt. »Ich kann mich noch ganz deutlich erinnern«, sagte Shirley. »Ich habe mich mit ihr hingesetzt und zu ihr gesagt: ›Weißt du, wenn ich das Gefühl hätte, dass dies das Richtige für dich ist, würde ich alles tun, um dir zu helfen, damit du dich in deinem Körper wohlfühlst. Aber es gibt nichts in deiner Vorgeschichte, das mich darauf schließen lässt.‹« Julie ging auf ihr Zimmer und dachte darüber nach. Als sie wieder herunterkam, schien sie sich beruhigt zu haben.
Als sie ein andermal beim Abendessen saßen, begann Julie eine Unterhaltung über verschiedene Genderidentitäten. Da sagte ihre Mutter leicht genervt: »Das scheint mir doch eine allzu enge Schublade zu sein, in die du dich da steckst. Eine Frau ist also jemand, der wie eine Barbiepuppe aussehen will, Bikinis trägt und biestig ist? Die Biologie bestimmt, ob du eine Frau bist oder nicht, nicht irgendwelche hypersexualisierten Stereotypen.«
Dann begann sich Julies psychischer Zustand zu verschlechtern, und als eine ihrer Mütter eines Abends von der Arbeit heimkam, fand sie Julie mit einer ausgewachsenen Panikattacke vor. Sie brachten sie ins Krankenhaus, wo die Ärzte bestätigten, dass es ihr körperlich gut ging. Am nächsten Morgen durchforschte ihre Mutter ihr Handy, während Julie ausschlafen durfte. Sie fand einen Chatverlauf mit einem anderen Mädchen, das schrieb, Julie sei »der beste Boyfriend«, den sie je gehabt habe. Ihre Mutter war außer sich, und zwar sowohl, weil das andere Mädchen Julie als Jungen ansprach, als auch, weil das alles ihrer Tochter nicht gut zu tun schien.
In der zwölften Klasse erhielt Julie ein Teilstipendium für eine Kunsthochschule. Aber ihre Mütter fühlten sich nicht wohl dabei, sie nach ihrer Verwandlung in eine geistig labile, feindselige und depressive Jugendliche gehen zu lassen. Sie baten sie, ein Jahr Auszeit zu nehmen.
Mit 18 Jahren zog Julie aus und meldete sich bei der Krankenkasse Medicaid an, obwohl sie noch bei ihrer Mutter mitversichert war. Sie begann sich Testosteron verschreiben zu lassen. Julie fand eine Tanztruppe in der Nähe, bei der sie als Junge trainieren konnte. Aber sie war nicht stark genug, so Shirley. »Nach dem, was ich gehört habe, musste der Choreograf seine Choreografie dreimal umgestalten, weil sie nicht stark genug für die Männerrolle war … Sie hatte mehrere Tänzerinnen fallen gelassen.« Ihre Mutter befürchtete, dass Julie mit ihrer Fixierung darauf, ein Mann zu sein, sich selbst oder jemand anderen verletzen würde. »Es geht nicht nur um dich, deinen Körper und deine Karriere. Es geht hier auch um die Körper und Karrieren der anderen Tänzer. Du wirst noch irgendwen verletzen«, warnte sie Julie.
Aber Julie hörte nicht mehr auf ihre Mütter, sondern brach unvermittelt den Kontakt zu ihnen ab. Auf Instagram hatte sie Hunderte von Followern, ihren Müttern aber den Zugang zu ihrem Account verwehrt.
»Wir haben jemanden, der ihr Instagram für uns im Auge behält … Ich habe das Foto von ihr im Krankenbett nach ihrer Brustentfernung gesehen. Sie schwärmte, dieser Tag sei der beste ihres Lebens, vergoss Freudentränen und hatte vierhundert Follower, die sie alle anfeuerten: ›Hurra! Gut gemacht! Wir sind so stolz auf dich! Du schaffst das‹, und so weiter. Das Übliche eben.«
DerIdentitätswandel in den Mädchenjahren
Wenn ich an meine Jugend in den 1990ern zurückdenke, kann ich mich nicht daran erinnern, dass sich irgendjemand damals als »trans« geoutet hätte. Und bis vor etwa 5 Jahren entsprach dies auch genau dem, was die Statistik zur Genderdysphorie vorhergesagt hätte, dass sie nämlich kaum mehr als 0,01 Prozent der Bevölkerung betrifft, was bedeutet, dass auch Sie und ich vermutlich keine »trans« Schulkameraden hatten.37 Deshalb waren wir Mädchen aber noch lange keine monolithische Erscheinung, sondern brachten unser Mädchensein auf unterschiedliche Weise zum Ausdruck.
So war ich zum Beispiel ein regelrechter Wildfang, ein burschikoses Mädchen, das statt mit Puppen gerne mit den vergleichsweise unkomplizierten Jungs spielte, auf Bäume kletterte und Sport trieb. Mit Mädchen befreundet zu sein kam mir oft vor wie ein hollywoodreifer Bankeinbruch mit unsichtbaren Lasersensoren, die bei der kleinsten Berührung einen Riesenalarm und ein Mordsdrama auslösen konnten.
Wie aber jedes Teenagermädchen bestätigen kann, gibt es heutzutage keine burschikosen Mädchen mehr. Stattdessen stößt man auf eine endlose Litanei sexueller und geschlechtsspezifischer Identitäten – öffentlich, starr und einengend. Wie mir die 16-jährige Riley, eine junge Frau, die sich seit ihrem 13. Lebensjahr als Junge identifizierte, sagte: »Ein burschikoses Mädchen zu sein ist heutzutage schwer. Es gibt sie einfach nicht mehr. Sie entscheiden sich stattdessen für eine Transition.« Eine Transition zu einem Jungen.
Jahre nach meinem Highschoolabschluss haben sich einige von uns, die mit den süßesten Jungs ausgegangen waren, als Lesben geoutet. Bei anderen, die wir im Stillen verdächtigt hatten, es ebenfalls zu sein, stellte sich heraus, dass dies nicht stimmte. Keiner von uns fühlte sich damals sicher, irgendwelche Identitätsentscheidungen zu treffen, die wir nicht einfach so zurücknehmen konnten.
Heutzutage werden Teenager und junge Leute förmlich dazu gedrängt, sich innerhalb eines Genderspektrums und einer sexuellen Klassifizierung einzuordnen – lange bevor sie ihre sexuelle Entwicklung abgeschlossen haben, die früher einmal eine Abenteuer- und Entdeckungsreise auf dem Weg zu sich selbst war, und lange bevor sie überhaupt romantische oder sexuelle Erfahrungen gemacht hatten. Junge Frauen, die nicht feminin genug sind, werden von Gleichaltrigen automatisch gefragt: »Bist du trans?«
Früher hätten sich viele der Mädchen, die heute zu einer Transidentität gedrängt werden, vielleicht als lesbisch geoutet. »Wir leben in einer Zeit, in der junge Lesben unter Druck gesetzt werden, wenn sie sich nicht dieser neuen Vorstellung davon unterwerfen, was Lesbischsein bedeutet«, sagte mir die renommierte lesbische Autorin Julia D. Robertson. Diese »neue Auffassung« besagt, dass es keine Lesben gibt und Mädchen mit männlichen Verhaltensmustern »in Wirklichkeit« Jungen sind.
Zwar gibt es heute immer noch Jugendliche, die sich als Lesben outen, doch diese Identität ist unbestreitbar weniger angesagt, als transgender zu sein. An ihrem englischen Mädcheninternat mit 500 Schülerinnen hätten sich fünfzehn Mädchen als transgender geoutet, sagte mir Riley. »Und wie viele als Lesben?«, fragte ich. Riley dachte einen Augenblick lang nach und wunderte sich dann selbst über die Antwort: »Gar keine.«
»Sally«
Wenn sie in einem früheren Jahrgang geboren worden wäre, hätte man Sally als »Wildfang« bezeichnet – sie war erstaunlich athletisch und körperlich draufgängerisch. »Sie war immer die Erste, die vom 10-Meter-Brett sprang«, erzählte ihre Mutter. »Ich denke, wenn es um ihren Körper ging, war sie einfach sehr selbstbewusst. Als jüngstes von drei Geschwistern musste sie als Kind immer darum kämpfen, mit ihren beiden älteren Brüdern mitzuhalten.«
»Mit 4 oder 5 hatte sie eine kurze Phase, in der sie ein Junge sein wollte. Wir glaubten, das liege eher daran, dass sie zwei ältere Brüder hat. Und wissen Sie, sie hat sich mit einer Schere die Haare abgeschnitten.«
Ihre Eltern dachten sich also nichts dabei. Ihre beiden großen Brüder waren ihre ganze Welt. Ihr Wunsch, ein Junge zu sein, war weder besonders ausgeprägt noch lang andauernd, sondern eine »kurze Phase«, die so schnell wieder vorbei war, wie sie gekommen war. In der wissenschaftlichen Literatur wird die Auffassung vertreten, dass es nicht ungewöhnlich ist, wenn sich kleine Kinder phasenweise mit dem anderen Geschlecht identifizieren.38
»So haben wir uns nur gesagt«, fügte ihre Mutter Mary in einem für den amerikanischen Mittelwesten typischen Akzent hinzu, »na ja, vielleicht wird sie halt eine Lesbe«.
Ihrer Mutter zufolge war Sally eine Traumtochter: fröhlich und gehorsam, bei anderen Kindern beliebt, ein Selbstläufer. »Sie war auf jeden Fall mein pflegeleichtestes Kind«, erklärte sie. »Sie hat zwei ältere Brüder, denn ich hatte innerhalb von 5 Jahren drei Kinder bekommen. Es herrschte immer Chaos, ein absoluter Affenzirkus. Aber Sally machte einfach ihr eigenes Ding. Das war, bevor Computer so eine große Sache wurden. Damals gründeten Kinder einen Klub oder machten eine Zeitung.«
Sallys enormes sportliches Talent kristallisierte sich immer mehr heraus. Mit 11 Jahren bekam sie von ihren Eltern ein Einrad geschenkt und brachte sich das Einradfahren selbst bei. Sie übte in der Einfahrt und hielt sich an der Familienkutsche fest. »Oh, mein Gott, sie ist mindestens eine Million Mal hingefallen«, sagte mir ihre Mutter. Aber irgendwann konnte sie mit dem Ding durch die Stadt fahren, und die Leute starrten sie an und riefen: »Guck dir das mal an!«
Bereits in der Mittelstufe stach sie als Schwimmerin heraus und wurde in der neunten Klasse in die Schwimmmannschaft aufgenommen. Sie war 3 Jahre hintereinander Landesmeisterin in ihrem Bundesstaat und stellte immer wieder neue Schulrekorde im Kraulen und Delfin auf. Aber es war die Persönlichkeit des Mädchens, das in der Lokalzeitung zu ihren Rekordleistungen interviewt wurde, die ihre Mutter am stolzesten machte: Mit einem strahlend weißen Lächeln bedankte sie sich artig bei ihren Trainern und lobte ihre Mitschüler. Sie schien ehrlich überzeugt, dass sie es ohne sie nie so weit geschafft hätte. »Ich war so stolz auf sie«, sagte ihre Mutter. »Sie war einfach so ein fröhliches, glückliches Mädchen.«
In der Elften ging Sally mit einem Jungen in ihrer Klasse aus, der hieß Jordan. »Wir mochten ihn sehr. Sie hat ihm eine Chance gegeben. Ich glaube, sie hat es versucht, dann aber irgendwann eingesehen: ›Ich bin einfach nicht verliebt. Er ist ein lieber Kerl, ein super Junge, und hat mir noch nie etwas Böses getan, aber ich habe einfach keine Gefühle für ihn.‹« Mary und ihr Ehemann akzeptierten, was sie schon lange vermutet hatten: Sally war wahrscheinlich lesbisch.
Und so versuchten Mary und Dave, Sally die Möglichkeit zu geben, falls sie es wollte, sich ihnen gegenüber zu outen. Politisch schon immer eher links eingestellt, war Mary ein führendes Mitglied der Organisation PFLAG (Parents, Families and Friends of Lesbians and Gays, zu Deutsch: »Eltern, Familien und Freunde von Lesben und Schwulen«) und unterstützte die Homo-Ehe, lange bevor sie legal wurde. Mary sah aus der Ferne zu, wie sich ihre Tochter in andere Mädchen verliebte, und es gab ihr einen Stich ins Herz, zu sehen, dass Sallys Liebe oft unbeantwortet blieb.
Trotzdem war die Oberstufe für Sally eine Zeit grandioser Erfolge. So wurde sie in der zwölften Klasse auch noch Finalistin für das Bundesbegabtenstipendium National Merit Scholarship und alsdann in die Schwimmmannschaft der Eliteuniversität ihrer Wahl aufgenommen. Mary war überglücklich. »Auf eine gewisse Weise fühlte es sich für mich an wie ein wahr gewordener Traum, das wunderschöne Schulgelände, die Wohnheime und die historischen Gebäude zu sehen und zu wissen, dass meine Tochter all dies erleben durfte.«





























