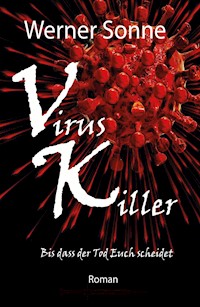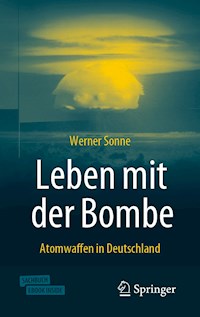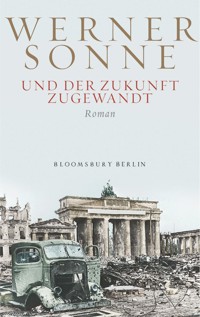17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Werner Sonne war am 7. Oktober 2023 in Israel. Schon 50 Jahre zuvor hatte er als junger Reporter über den Jom-Kippur-Krieg berichtet – und nun wiederholte sich die Geschichte. In diesem Buch blickt der bekannte ARD-Journalist auf die hitzigen deutschen Debatten über den Umgang mit Israel. Zugleich erzählt er die Geschichte der deutsch-israelischen Beziehungen – von den schwierigen Anfängen unter Adenauer und Ben-Gurion bis zum Kauf des israelischen Raketenabwehrsystems Arrow 3 und der Frage, was die Formel von der Sicherheit Israels als "Staatsräson" Deutschlands konkret bedeutet. So bietet dieses anschaulich geschriebene Buch Hintergründe, macht Argumente verständlich und liefert "food for thoughts" für eine der drängendsten und umstrittensten Debatten der Gegenwart. Seit dem terroristischen Angriff der Hamas vom 7. Oktober 2023 und dem anschließenden neuen Gaza-krieg wird in Deutschland intensiv über das Verhältnis zu Israel debattiert. Auf den Straßen und in den sozialen Netzwerken kam es zu einem unerwartet heftigen Ausbruch von Antisemitismus. Jüdinnen und Juden fühlen sich in Deutschland wieder bedroht. Die deutsche Politik stellte sich klar an die Seite Israels und bekräftigte den Ausspruch Angela Merkels, dass die Sicherheit Israels deutsche „Staatsräson“ sei. Doch wie weit geht die Solidarität? Sollte sie bedingungslos sein? Und kann sie das sein angesichts einer israelischen Regierung, der rechtsextreme Minister angehören? Deren umstrittene Reform des Verfassungsgerichts viele Israelis als Angriff auf die Demokratie interpretierten und die den völkerrechtswidrigen Siedlungsbau forciert? Was ist legitime Kritik, und wo beginnt als Israelkritik verbrämter Antisemitismus?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Werner Sonne
Israel und wir
Geschichte einer besonderen Beziehung
C.H.Beck
Zum Buch
Seit dem terroristischen Angriff der Hamas vom 7. Oktober 2023 und dem anschließenden neuen Gazakrieg wird in Deutschland intensiv über das Verhältnis zu Israel debattiert. Auf den Straßen und in den sozialen Netzwerken kam es zu einem unerwartet heftigen Ausbruch von Antisemitismus. Jüdinnen und Juden fühlen sich in Deutschland wieder bedroht. Die deutsche Politik stellte sich klar an die Seite Israels und bekräftigte den Ausspruch Angela Merkels, dass die Sicherheit Israels deutsche «Staatsräson» sei. Doch was heißt das konkret? Wie weit geht die Solidarität mit Israel? Sollte sie bedingungslos sein? Und kann sie das sein angesichts einer israelischen Regierung, der rechtsextreme Minister angehören? Deren umstrittene Reform des Verfassungsgerichts viele Israelis als Angriff auf die Demokratie interpretierten und die den völkerrechtswidrigen Siedlungsbau forciert? Was ist legitime Kritik und wo beginnt als Israelkritik verbrämter Antisemitismus?
Werner Sonne war am 7. Oktober 2023 in Israel. Schon 50 Jahre zuvor hatte er als junger Reporter über den Jom-Kippur-Krieg berichtet, und nun wiederholte sich die Geschichte. Die Berichterstattung aus und über Israel ist ein Lebensthema des bekannten ARD-Journalisten. In diesem Buch beschreibt er die gesellschaftlichen Debatten der Gegenwart und lässt ihre wichtigsten Protagonistinnen und Protagonisten zu Wort kommen. Zugleich erzählt er die Geschichte der deutsch-israelischen Beziehungen mit einem besonderen Schwerpunkt auf die Sicherheitspolitik, die gegenwärtig vor allem im Fokus steht — von den schwierigen Anfängen unter Adenauer und Ben Gurion bis zum Kauf des israelischen Raketenabwehrsystems Arrow 3 und der Lieferung weiterer deutscher U-Boote als Trägerwaffen für die nukleare Abschreckung Israels. So bietet dieses Buch Hintergründe, macht Argumente verständlich und liefert «food for thought» für eine der drängendsten und umstrittensten Debatten der Gegenwart.
Vita
Werner Sonne kam 1968 zum WDR. Zunächst arbeitete er im Hörfunk, seit 1981 wechselte er zum Fernsehen. Er war unter anderem Korrespondent in Washington und Warschau, im ARD-Hauptstadtstudio und zuletzt beim ARD-Morgenmagazin. Bis heute ist er immer wieder Gast in den großen Fernseh-Talkshows.
Inhalt
Prolog
Staatsräson konkret – Die Berliner Politik nach dem 7. Oktober
Die Linie der Regierung
Herausforderung im Roten Meer
Diplomatie auf Hochtouren
Wie weiter nach dem Krieg?
Ein tiefer Riss – Die deutsche Gesellschaft im Bann des Nahostkonflikts
Nichts rechtfertigt Antisemitismus
Neukölln zu Gaza machen
Bekenntnis zu Israel als staatsbürgerliche Pflicht
Muslime in der Kritik
Die Deutschen auf der Anklagebank
In der Grauzone – Die AfD und Israel
Die Häutungen der AfD
Widerliche Töne vom rechten Mob
Die AfD als Gemischtwarenladen
Israel, Palästina und die Schuld – Die Linke und der Antisemitismus
Linke Sehnsucht nach dem Schlussstrich
Im Minenfeld: der Kulturbetrieb
Kein Aber – oder doch?
Gefallene Engel
Der deutsche Linksextremismus und die Palästinenser
Wiedergutmachung mit Waffen – Die Anfänge unter Adenauer und Ben-Gurion
Deutsche Militärhilfe für das Überleben
Geheimabkommen an Weihnachten
Uzis für die Bundeswehr
Entrüstung in der Knesset
Staatsräson schon bei Adenauer
Deutsche Techniker in Ägypten
Ein Pfarrer deckt alles auf
Ein Deutscher und Israels Atombombe
Auf dem Weg zur Atommacht
Die Baustelle in der Wüste
Geheimaktion mit Yellow Cake
Im Schattenreich – Der Mossad und der BND
Der Meisterspion des Mossad
Eine unwahrscheinliche Partnerschaft
Der ehrliche Makler
Unter falscher Flagge
Waffen aus der Sowjetunion
Sowjetische Waffen aus Afghanistan
Fehleinschätzungen
Deutschland als Gefechtsfeld
Staatsräson in der DDR – Israel als kapitalistischer Klassenfeind
MiG-Jagdflieger für Syrien aus Brandenburg
Israelis als Kriegsgegner
Die DDR als Schutzengel für die Palästinenser
Taube Ohren bei der Wiedergutmachung
Juden verlassen die DDR
Alles, was schwimmt, geht – Israel und die deutschen U-Boote
Deutsche Waffenhilfe für den Irak
Die Geburt des Dolphin-Projektes
Die nukleare Zweitschlagskapazität
Die zweite Lieferung
Das sechste U-Boot
Noch größere U-Boote, noch mehr atomare Abschreckung
Auch andere wollen Atomwaffen
Enge Partner – Die Bundeswehr und Israel
Deutsche Kampfstiefel in Gaza?
Besuche fallen nicht mehr auf
Cerberus
Zusammenarbeit bei der Panzerentwicklung
Raketenwerfer für die Bundeswehr
Die Drohnen-Ära
Der größte Deal in der Geschichte Israels
Israel will Deutschland schützen
Eliteeinheiten unter sich – Die GSG 9 und die YAMAM
Die Tür hinter der Tür
Das Olympia-Desaster
Frühe Verbindung zur RAF
Deutsche sortieren Juden aus
Durchbruch für den Kommandeur
Operation Feuerzauber
Eine neue Seite wird aufgeschlagen
Der unterbrochene Honeymoon – Von Olmert zu Netanjahu
Raketen auf Haifa
Die Einladung
Eine historische Entscheidung
Immer Ärger mit Netanjahu
Ohne Grundlage durch das Völkerrecht
Zankapfel Zweistaatenlösung
Hamas-Geld aus Katar
Paukenschlag aus Washington
Nein auch zu Freunden
Israel und wir – Ein Realitätscheck
Israel-Solidarität immerwährende Aufgabe
Deutschland also in einer Sonderrolle?
Abkehr von der Zurückhaltung
Ist das der Schlussstrich?
Zwei Staaten: Vision oder Illusion?
Distanz in der Bevölkerung
Große Entfernung in Ostdeutschland
Gedanken zum Schluss
Dank
Prolog
Oktobertage sind in Israel bunte Postkartentage. Blauer Himmel, gesprenkelt mit weißen Wölkchen, warme, aber nicht mehr zu heiße Tage, milde Temperaturen am Abend, die zum unbeschwerten Ausgehen einladen. Das Rauschen der Wellen am Strand von Tel Aviv, die ersten Jogger sind an diesem Morgen unterwegs. Das Laubhüttenfest, das jüdische Erntedankfest, geht an diesem Schabbat zu Ende.
Um 6.30 Uhr morgens an diesem 7. Oktober 2023 ist plötzlich alles ganz anders. Die Sirenen heulen, schrecken uns auf, dann zwei Explosionen.
Kurz darauf meldet sich mein Freund Ron Ben-Yishai, ein bekannter israelischer Militäranalyst, telefonisch und sagt, dies sei kein Probealarm, dies sei Krieg.
Ziemlich schnell blitzen die ersten Meldungen auf meinem Smartphone auf, berichten von Überfällen aus dem Gaza-Streifen auf israelisches Gebiet, von heftigen Schießereien und offensichtlich auch von Geiselnahmen.
Mein erster Gedanke ist: schon wieder! Die Geschichte wiederholt sich. Eigentlich war ich in Israel zum 50. Jahrestag des Jom-Kippur-Krieges. Das war am 6. Oktober, einen Tag zuvor. Als junger ARD-Hörfunkreporter hatte ich 1973 aus Israel berichtet.
Auch damals war der Staat der Juden völlig blind von dem Angriff der Araber überrascht und anfangs in eine existentielle Krise gebracht worden. Die hochgelobten Geheimdienste hatten völlig versagt. Und diesmal schon wieder. Es war die Arroganz der Macht. Nach dem so erfolgreichen Sechstagekrieg des Jahres 1967 waren die Israelis im Oktober 1973 überzeugt, dass es die Araber nicht wagen würden, sie anzugreifen. Und auch diesmal waren die Sicherheitsdienste der Meinung, sie hätten die Lage im Griff. Da wird nichts passieren, jedenfalls nicht aus Richtung Gaza. Wie fürchterlich und eigentlich unerklärlich falsch sie damit lagen!
Die israelische Bevölkerung und damit auch die Netanjahu-Regierung hatte zu diesem Zeitpunkt ganz andere Probleme. Seit Monaten gingen immer wieder Hunderttausende auf die Straße, um gegen die Justizreform zu demonstrieren. Die unabhängige Justiz sollte entmachtet werden, so empfanden sie es, sie sollte nicht länger als Korrektiv gegenüber der Regierung dienen dürfen.
Die Netanjahu-Regierung, zusammengesetzt auch aus Parteien mit ultra-rechten, ultra-orthodoxen und ultra-nationalistischen Kräften, wollte sich nicht länger dabei stören lassen, ihre radikale Agenda durchzusetzen. Im Kern ging es darum, welche Identität der Staat der Juden in Zukunft haben sollte: eine weltoffene, liberale Gesellschaft oder ein Land auf dem Weg zu einem Gottesstaat mit den Spielregeln aus dem Alten Testament.
In den Tagen unmittelbar vor dem Ausbruch des Krieges waren wir in Israel, aber auch in der palästinensischen Westbank unterwegs, besuchten Jericho und dann auch Bethlehem. Dort trafen wir auf Hassan (Name geändert), einen Fremdenführer. Ein kluger, gebildeter Palästinenser Mitte dreißig, der stolz darauf war, dass sein Großvater noch als Beduine in einer Höhle gelebt hatte. Er berichtete freimütig von den zunehmenden Spannungen innerhalb der palästinensischen Bevölkerung. Sowohl in der Westbank wie auch in Gaza schwinde die Unterstützung der Menschen für die Herrschenden, die nur an ihrem Machterhalt interessiert und darüber hinaus völlig korrupt seien. Ja, auch für die Hamas in Gaza, versicherte er auf Nachfrage. Ich teilte seine Analyse. Als ich ihm berichtete, ich hätte vor einigen Jahren bei einer öffentlichen Veranstaltung in Nordrhein-Westfalen Palästinenser-Präsident Abbas vor einem großen Publikum als Moderator eines etwa einstündigen Gesprächs mit meinen kritischen Fragen so verärgert, dass er auf der Bühne (erfolglos) verlangte, von diesem lästigen Fragesteller befreit zu werden, stand er auf und umarmte mich spontan. Ich war offenbar sein Held, endlich einer, der Abbas die Stirn geboten hatte. Es war ein Bild der zunehmenden Hoffnungslosigkeit und Resignation, das er von seinen Landsleuten zeichnete. Dann führte er uns zu einem Beobachtungspunkt und zeigte auf die riesigen israelischen Wohnblöcke, die rund um Jerusalem im Osten auf palästinensischem Gebiet entstanden sind. Eine hohe Mauer, gut doppelt so hoch wie die einstige Mauer in Berlin, schirmt sie von dem Gebiet ab, das den Palästinensern verblieben ist. Wir fahren weiter zum Aida-Flüchtlingslager, das dort am Rande von Bethlehem seit 1950 steht. Über einem großen Eingangstor in Form eines Schlüssellochs liegt quer ein riesiger, rostiger Schlüssel, bis heute das Symbol schlechthin für den Anspruch, in die Häuser zurückzukehren, die sie im Krieg 1948 an die Juden verloren haben. Gleich daneben auf der Mauer ein großes Wandgemälde mit vermummten Kämpfern, die mit Schleudern gegen die israelischen Feinde vorgehen. Darüber in Knallrot die Zeile: We will win!
Am Abend vor dem Angriff, am Jahrestag des Beginns des Jom-Kippur-Krieges, sind wir bei Freunden zum Abendessen eingeladen. Yael, damals Leutnant und Verbindungsoffizier der israelischen Armee und als 22-Jährige die Organisatorin des Transports für uns Korrespondenten an die Fronten auf den Golanhöhen und auf dem Sinai, hat sich viel Mühe gegeben, ein europäisch-jüdisch-arabisches Menü zusammenzustellen. Ihr Mann Dani war einer der ersten, die 1973 an der Sinai-Front von der ägyptischen Armee gefangen genommen wurden.
Auch Ron ist dabei, der hoch erfahrene journalistische Sicherheitsexperte. Er berichtet von den zunehmenden Spannungen in den Palästinensergebieten auf der Westbank in den zurückliegenden Monaten, vor allem in dem Flüchtlingslager in Jenin, wo die Armee massiv gegen vermutete Terroristen vorgeht und es zu zahlreichen Opfern kommt. Dort ist der Fokus des israelischen Sicherheitsapparates. Es zeichne sich die Gefahr einer dritten Intifada ab, befürchtet Ron. Auch hier zeigt sich, dass die Hoffnungslosigkeit der jungen Palästinenser sich ein Ventil sucht, und das ist die Gewalt. Die israelische Armee hat einen wesentlichen Teil ihrer Truppen dorthin verlegt. Von Gaza ist nicht die Rede.
Das sollte sich rächen. Die IDF, die israelischen Streitkräfte, sind nicht nur geschwächt, sie sind völlig unvorbereitet und über Stunden unfähig, diesen Angriff abzuwehren.
Ron, der eine Vielzahl von Krisen und Kriegen erlebt hat, wird mir später berichten, er habe schon so viele schreckliche Dinge gesehen. Etwa in Sabra und Shatila, wo die christlichen Milizen unter den Augen der israelischen Besatzer 1982 im Libanon ungeheure Massaker begingen, seien die Leichen zum Teil brusthoch gestapelt gewesen. Ron hat dann nach dem jüngsten Angriff vom 7. Oktober Zugang zu dem Videomaterial bekommen, das die Hamas-Terroristen selber aufgenommen haben, als sie an einem Tag rund 1200 Menschen abschlachteten. Eine solche Brutalität, so Ron, habe er trotz allem noch nie gesehen.
Es sollte ein neues, nie gekanntes Trauma für die Israelis werden. Aber auch eine Herausforderung für die übrige Welt, die nun entscheiden musste, wie sie auf diesen Überfall auf den Staat der Juden reagieren sollte. Eine Frage, der sich vor allem die Nachfahren der Nazi-Täter stellen mussten, deren Kanzlerin Angela Merkel Israels Sicherheit zur deutschen Staatsräson erhoben hatte. Plötzlich stand die Frage im Raum: Israel und wir – was nun?
Die Antwort hieß: Staatsräson, Staatsräson, Staatsräson …. Ein Wort in aller Munde, fast wie eine Endlos-Schleife, so klang es wochenlang in Berlin in nahezu jeder Rede. Geprägt wurde das Bekenntnis am Morgen des 18. März 2008. Zusammen mit der deutschen Delegation saß ich als journalistischer Beobachter auf der Besuchertribüne der Knesset, dem israelischen Parlament, gespannt, wie die deutsche Kanzlerin diese Rede meistern würde. In das Jahr 2008 fiel der 60. Jahrestag der Gründung des Staates Israel, bei vielen war die Erinnerung an die tief sitzenden Tragödien in den eigenen Familiengeschichten noch sehr lebendig.
Arieh Eldad hatte bis zur letzten Minute vergeblich dagegen gekämpft, dass Angela Merkel auf Deutsch in der Knesset reden durfte. Der Abgeordnete der ultrarechten Nationalen Union trat ans Mikrofon und sagte, seine Großeltern seien dem Holocaust zum Opfer gefallen, er könne es nicht ertragen, dass in der Knesset Deutsch gesprochen werde. Dann verließ er den Saal.
Er hörte nicht mehr, wie Angela Merkel, dem Anlass entsprechend würdig in einem schwarzen Hosenanzug, die Abgeordneten auf Hebräisch ansprach – einige kurze Sätze, die sie einstudiert hatte. Dann fuhr sie auf Deutsch fort.
Es ging aber keineswegs nur um die Frage Deutsch – ja oder nein. Dieser Auftritt einer deutschen Bundeskanzlerin war noch in weiterer Hinsicht besonders. Es ging darum, ob sie überhaupt sprechen durfte. Eigentlich wurden nur ausländische Staatsoberhäupter vor das israelische Parlament geladen. Die Knesset hatte aber eigens für sie die Regeln so geändert, dass Angela Merkel als weltweit erste Regierungschefin in der Geschichte des Landes dort eine Rede halten durfte.
Die Kanzlerin zollte der Geschichte Tribut, sie sprach von der Scham der Deutschen über den Holocaust und fuhr fort, dass sie sich vor den Opfern und den Überlebenden verneige. «Der Zivilisationsbruch der Shoah ist beispiellos. Er hat Wunden bis heute hinterlassen.» Es war die Linie, die vom ersten Kanzler Konrad Adenauer bis heute die deutsche Politik prägt und die deutsche Sonderrolle gegenüber dem Staat der Juden in ihrem Kern begründet.
Aber Angela Merkel stellte auch einen aktuellen Zusammenhang her. Schon damals fühlte sich Israel vom Iran bedroht. Kein Wunder, hatte doch der damalige Präsident Mahmud Ahmadinedschad gleich nach seiner Wahl im Jahre 2005 Israels Existenz infrage gestellt und davon gesprochen, das Land der Juden «von der Landkarte fegen» zu wollen. Und den Holocaust nannte er einen «Mythos». Angela Merkel sah darin offenbar den angemessenen Anlass, die deutsche Position klarzustellen, und das auch so grundsätzlich, dass es bis heute nachwirkt.
«Jede Bundesregierung und jeder Bundeskanzler vor mir war der besonderen historischen Verantwortung verpflichtet. Diese historische Verantwortung Deutschlands ist Teil der Staatsräson meines Landes. Das heißt: Die Sicherheit Israels ist für mich als Bundeskanzlerin niemals verhandelbar.»
So deutlich, so weitgehend wie sie hatte es bis dahin kein deutscher Regierungschef formuliert. Und zugleich hatte sie schon damals eine Diskussion begonnen, die bis heute nichts an Aktualität verloren hat. Im Gegenteil: Nie war sie so aktuell, so dringlich wie gerade heute. Aber schon damals stellte sich die Frage: War diese Erklärung wirklich so unmissverständlich, so eindeutig, wie der Text es vermuten lässt? Hat sie im Namen Deutschlands an diesem Frühlingstag in Jerusalem ein Versprechen abgegeben, das sie möglicherweise gar nicht einhalten konnte – und ihre Nachfolger auch nicht?
Und hatte möglicherweise Helmut Schmidt, einer ihrer Amtsvorgänger, damals recht, als er sofort öffentlich die Frage stellte, ob Merkels Aussagen vor der Knesset aus Nähe zur amerikanischen Politik gefallen seien oder aus «unklaren moralischen Motiven». Helmut Schmidt spitzte das noch weiter zu: «In meinen Augen eine schwere Übertreibung, das klingt fast nach einer Art Bündnisverpflichtung.» Und Schmidt war damit keineswegs allein, wie sich auch noch lange danach herausstellen sollte. Ausgerechnet der erste Mann im Staate setzte hier ein großes Fragezeichen, und er tat es ausgerechnet in Israel.
Wir begleiteten Joachim Gauck im Mai 2012 auf dieser Reise. Schon im Flugzeug machte er uns mitreisenden Journalisten klar, dass er der von Angela Merkel eingegangenen Verpflichtung eher skeptisch gegenüberstand. Und dann, in Jerusalem angekommen, wiederholte er seine kaum verhohlene Kritik an Angela Merkel auch öffentlich. «Ich will mir nicht jedes Szenario ausdenken, welches die Bundeskanzlerin in enorme Schwierigkeiten bringen könnte mit ihrem Satz, dass Israels Sicherheit deutsche Staatsräson ist.» Es war kein Ausrutscher, es war ein sorgfältig überlegter Satz des Bundespräsidenten, der erst kurz zuvor ins Amt gekommen war und seinen ersten offiziellen Staatsbesuch absolvierte. Nicht überraschend, machte diese Bemerkung in Deutschland sofort Schlagzeilen und verursachte eine Debatte. Joachim Gauck schien noch vor Ort zurückrudern zu müssen. «Wer gemeint hat, zwischen der Bundeskanzlerin und mir Distanz herauszulesen, wäre im Irrtum», sagte er uns.
In der Sache sei er «ganz dicht bei der Kanzlerin». Ganz dicht, aber eben nicht deckungsgleich. Aber als dann im Oktober 2023 das Thema Staatsräson eine völlig neue Dynamik bekam, korrigierte sich Gauck noch viel deutlicher. «Eigentlich war das eine Äußerung, die ein Bundespräsident nicht machen sollte», sagte er in der ZDF-Sendung «Maybrit Illner». «Was ich niemals wollte, ist die Verbindlichkeit unseres Beistands infrage zu stellen.»
Doch trotz der von ihr ausgerufenen Staatsräson würde Angela Merkel in ihrer langen Amtszeit noch bei mehreren Gelegenheiten sehr deutlich machen, dass diese Formel keineswegs als Carte blanche für die Regierenden in Jerusalem zu verstehen war und die Bundesregierung schweigend alles einfach hinnehmen würde, was dort beschlossen und umgesetzt wurde. Das musste vor allem der Dauer-Ministerpräsident Benjamin Netanjahu erfahren, mit dem Merkel harte Auseinandersetzungen mit ganz konkreten Auswirkungen hatte. Reuven Rivlin, von 2014 bis 2021 Israels Präsident, sagte ganz unumwunden im Berliner «Tagesspiegel»: «Sie war nicht blind und hat uns auch mal knallhart die Meinung gesagt, wenn es sein musste. Aber sie hat Israel immer ohne Zögern unterstützt – ohne Spiele mit uns zu spielen.»
Seit diesem Frühlingstag im Jahre 2008 gab es viel Auf und Ab in den deutsch-israelischen Beziehungen. Und lange schien es so, als sei der Begriff der Staatsräson bestenfalls noch für Sonntagsreden tauglich. Das änderte sich nach dem 7. Oktober 2023 schlagartig. Es war fast so, als habe die Berliner Politik den etwas angestaubten Begriff über Nacht wieder aus der Kiste geholt. Und plötzlich standen Regierung und Opposition vor der Herausforderung, ihn mit Inhalt zu füllen.
Es ist Zeit, Bilanz zu ziehen. Gerade jetzt. Wir Deutschen müssen uns fragen, wo wir angesichts dieses so blutig verlaufenden Konflikts stehen. Hatte Angela Merkel recht, als sie sich ohne Wenn und Aber für das Existenzrecht Israels einsetzte? Natürlich hatte sie recht. Für mich ganz persönlich, der ich als Deutscher 1947 in die Ruinen des Zweiten Weltkriegs hineingeboren wurde, zwei Jahre nach dem Ende des Holocaust, kann man das nicht anders sehen. Aber die Frage darf nicht nur von Älteren beantwortet werden. Gerade die nachgewachsenen Generationen müssen sich jetzt darüber klar werden, wie sie mit dem Staat der Juden umgehen wollen.
Wie auch ich tragen sie keine persönliche Schuld an dem dunkelsten Kapitel deutscher Geschichte. Verantwortung dafür, dass es sich nicht wiederholen kann, dagegen schon. Und auch hier gilt, schaut man auf die Reaktionen auf deutschen Straßen oder auch an deutschen Universitäten: gerade jetzt!
Israel hat seine moralische Existenzberechtigung durch diesen so unvorstellbaren, so entsetzlichen und so belastenden, von Deutschland ausgehenden Zivilisationsbruch erworben. Zeit für einen Schlussstrich?
Wohl kaum.
Ebenfalls schmerzhaft ist jedoch die Einsicht, dass die Gründung Israels auf Kosten der arabischen Bewohner Palästinas geschehen ist, denen bis heute Unrecht widerfährt. Der so brutale Angriff der Hamas, der die Menschen in Israel auf nie dagewesene Weise traumatisiert und viele gar an den Holocaust erinnert hat, darf das nicht überdecken. Er hat mit einer neuen Dringlichkeit deutlich gemacht, dass eine Lösung für die Palästinenser gefunden werden muss, soll sich die Spirale der Gewalt nicht immer und immer wieder weiter drehen.
Vor diesem Hintergrund ist sicher weder blinde Gefolgschaft gegenüber Israel noch eine undifferenzierte Dauerkritik angemessen. Jede Auseinandersetzung mit der israelischen Politik und der deutschen Israel-Politik muss vielmehr von den Realitäten ausgehen – und die sind wahrlich komplex.
Dazu gehören die ernstzunehmende Bedrohung durch einen zunehmend radikalen und vielleicht irgendwann atomar aufgerüsteten Islamismus genauso wie die Ungerechtigkeiten und die Gewalt, die im Namen Israels ausgeübt werden. Israel ist stolz auf seine demokratische Tradition, auf seine humanitären Werte – und hat sie bisher gleichzeitig fünf Millionen Palästinensern verwehrt, deren Führung allerdings ebenfalls nicht bereit war, die Chancen für einen endgültigen Frieden mit Israel zu ergreifen, die sich viele Jahre geboten haben. Die Palästinenser blieben zerrissen zwischen politischer Vernunft und wütendem Israel-Hass und machten es so der israelischen Politik leicht, die Frage eines eigenen palästinensischen Staates weiter zu ignorieren und zugleich mit ihren Siedlungen auf palästinensischem Gebiet immer mehr Fakten zu schaffen, die einen solchen lebensfähigen Staat fast unmöglich machen.
Deutschland hat sich schon früh seiner moralischen Verantwortung gestellt. Ohne diese frühe deutsche Hilfe – gerade auch im Sicherheitsbereich – hätte der junge Staat der Juden große Probleme gehabt zu überleben. Gewiss, das ist lange her. Aber wenn jetzt die deutsche Politik, über die Parteigrenzen hinweg, wieder die Sicherheit Israels zur Staatsräson erhebt, dann dürfen das nicht leere Worte bleiben.
Auf der Suche nach tauglichen Beschreibungen für den deutschen Beistand begab sich die Politik gleichwohl schnell auf ein Gebiet, das sich noch als Glatteis herausstellen könnte. Bei einer Bundestagsdebatte zum 85. Jahrestag der Reichspogromnacht etwa nutzte Bundesinnenministerin Nancy Faeser eine zu Fragezeichen einladende Definition, als sie mit Hinweis auf den grausamen Überfall der Hamas auf israelische Bürger feststellte: «Wir stehen fest an der Seite Israels, und ich sage es in aller Deutlichkeit, dieser Tage darf es kein Aber geben.»
Kein Aber? Gilt das ausschließlich als Beschreibung dieses blutigen und für die Israelis so traumatischen Gemetzels der Hamas, und gilt das nur «dieser Tage»? Oder ist das die Steigerung des Versprechens, wonach Israels Sicherheit deutsche Staatsräson ist? Kann Israel, auch wenn die Waffen schweigen, davon ausgehen, dass es bei den Deutschen künftig kein Aber mehr gibt?
Neben der Bundesinnenministerin saß bei dieser Debatte Annalena Baerbock, die Außenministerin. Hatte sie nicht gerade bei der Abstimmung in den Vereinten Nationen gezeigt, dass die Bundesregierung durchaus nicht so eindeutig ohne dieses Aber auf der Seite Israels stand, als Deutschland sich der Stimme bei einer Resolution enthielt, in der die Verbrechen der Hamas nicht einmal beim Namen genannt wurden? Das hatte in Israel für eine große Welle an Zorn und Unverständnis gesorgt. Yael, die einst für die israelischen Streitkräfte unsere Fahrten an die Front organisiert hatte, schrieb empört, sie sei doch für eine Zweistaatenlösung, ihr Herz sei bei den armen Leuten in Gaza, aber unschuldige Menschen seien in Israel von der Hamas im Schlaf ermordet oder entführt worden, und all das zähle nicht – nur eine Enthaltung durch die Deutschen in der UN! «Was für eine Heuchelei!»
Diese politischen Debatten zeigten auf, wie schwierig es wurde, angesichts tiefer Risse in der Welt, die vor allem im Forum der Vereinten Nationen offenbar wurden, eine Balance zu finden zwischen einem Bekenntnis zu Israel und dem Anliegen, auch an die Opfer in Gaza zu erinnern und die dortige humanitäre Krise einzudämmen.
Aber im Hintergrund setzte sich die Staatsräson mit ihrem Versprechen, für Israels Sicherheit einzustehen, auf eine herausragende Weise praktisch durch, vieles davon geheim. Deutschland lieferte militärisches Gerät und Munition an den Staat der Juden, in Deutschland hergestellte Schiffe wurden im Kampf gegen die Hamas eingesetzt, eigentlich für die Bundeswehr vorgesehene Drohnen kreisten über dem Kampfgebiet. Twentyfour/seven, rund um die Uhr, so lobte man in der israelischen Botschaft, seien die Deutschen für die weitgehenden Anliegen bei dieser konkreten Hilfe ansprechbar gewesen. Ex-Präsident Rivlin fasste es nach einem Vierteljahr Krieg so zusammen: «Deutschland ist das für uns hilfreichste Land, wenn es um unsere Sicherheit geht.» Es war ein spektakulärer Testfall für die Formel von der deutschen Staatsräson.
Staatsräson konkret
Die Berliner Politik nach dem 7. Oktober
Als Olaf Scholz am 17. Oktober, zehn Tage nach dem Beginn des Krieges, in Israel war, heulten gleich viermal die Sirenen – Raketenalarm! Zweimal musste der Kanzler allein in der deutschen Botschaft in den Schutzbunker. Zuletzt erwischte es die deutsche Delegation unmittelbar vor dem Abflug mit dem Regierungsflieger der deutschen Luftwaffe. «Alles liegen lassen, alles raus», hieß es plötzlich. Die rund 50 Begleiter, darunter Journalisten und Journalistinnen, wurden aufgefordert, die auf dem Vorfeld des Ben-Gurion-Flughafens geparkte Maschine sofort zu verlassen, sie legten sich flach auf den Asphalt. Der Kanzler wurde eilends in das nahegelegene Flughafengebäude gebracht. Es knallte, das israelische Abwehrsystem Iron Dome schoss über Tel Aviv die anfliegenden Raketen ab.
Olaf Scholz war der erste ausländische Regierungschef, der nach dem Hamas-Überfall nach Israel kam. Auch US-Präsident Joe Biden war in der Region. Beide hatten vereinbart, dass sie nicht am gleichen Tag in Israel sein sollten. Biden kam dann am nächsten Tag. Überhaupt, das zeigte sich früh, waren es diese beiden Regierungen, die während des gesamten Konflikts am engsten kooperierten und ihre Positionen abstimmten, zum Teil praktisch wortgleich in den öffentlichen Stellungnahmen. Der Kanzler wiederholte die Botschaft, die man in diesen Tagen auch in Berlin immer wieder hörte: «Dies ist ein Besuch bei Freunden in schwierigen Zeiten. Die Sicherheit Israels und seiner Bürger ist Staatsräson.» Der politisch entscheidende Satz, auch das sollte sich immer wieder zeigen, war dieser: «Israel hat das Recht, sich gegen diesen Terrorismus zu wehren.»
Die Linie der Regierung
Auf der Suche nach einem Inhalt für das so weitgehende Versprechen der Staatsräson hatte das Kanzleramt drei Punkte festgelegt, die zugleich auch eine durchaus konkrete Antwort sind auf die immer wieder gestellte Frage, was das Versprechen eigentlich bedeutet, wenn es darauf ankommt:
Die moralische Unterstützung: öffentlich zu zeigen, dass man angesichts des ungeheuren Traumas, das der brutale und so unerwartete Hamas-Überfall ausgelöst hatte, an der Seite der Überfallenen stehe. Der sonst mit drastischen Worten nicht zimperliche Gastgeber Netanjahu übertrieb nicht, als er die weit verbreitete Befindlichkeit in der israelischen Bevölkerung beschrieb, indem er sagte, der Terrorangriff sei das «schlimmste Verbrechen gegen Juden seit dem Holocaust».
Die zahlreichen Besucher aus dem Berliner Kabinett vor Ort versicherten die deutsche Solidarität wieder und wieder. Kein Land schickte so viele Repräsentanten, auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier reiste an und besuchte eine von der Hamas zerstörte Ortschaft gleich an der Grenze zu Gaza. «Israel hat jedes Recht, sich selbst zu verteidigen und seine Existenz zu sichern», so Steinmeier in Übereinstimmung mit der deutschen Regierungslinie.
Die Diplomatie: Berlin wollte sich international darum kümmern, Israel für seine Aktionen in Gaza den Rücken frei zu halten. Es ging darum, so formulierte man das in der Umgebung von Olaf Scholz, der Netanjahu-Regierung «Raum und Zeit» zu verschaffen. Dafür habe man auch «teuer bezahlt» und die Abkehr von einstigen Freunden in Kauf genommen. Israels Bedürfnisse hatten Priorität. «Das geht nicht umsonst», so die bittere Erkenntnis. Hier nahm man auch ein Zerwürfnis innerhalb der Europäischen Union in Kauf, vor allem mit Deutschlands wichtigstem Partner Frankreich. Immer wieder wehrte sich die Berliner Politik dagegen, Israel zu einem andauernden Waffenstillstand aufzufordern, was der französische Präsident Macron wollte. Dabei ging es um feine semantische Unterschiede. Ging es um «Pause» oder «Pausen»? Humanitäre Pausen ja, so die Berliner Position, Dauerpause jedoch nicht. Das konnte die Bundesregierung in Brüssel durchsetzen. Dieser politische Kraftakt sei allerdings, so ein Beteiligter, «verdammt schwierig» gewesen. «Frankreich und wir gehen da getrennte Wege.» Das sei nicht angenehm gewesen für den Kanzler, «aber er stand».
Die ganz praktische, auch militärische Hilfe. Hier hatte Scholz eine Formel im Gepäck, die noch eine wichtige Bedeutung bekommen sollte: «Wenn ihr was braucht, meldet euch!»
Die Bundesregierung richtete eine Arbeitsgruppe ein. Quer durch die Ressorts sollte geprüft werden, was man konkret machen konnte. Dabei rückte schnell der Bereich der militärischen Unterstützung in den Vordergrund. Angesichts der weiterhin mit erheblichen Ausstattungslücken kämpfenden Bundeswehr und vor allem der andauernden Unterstützung der Ukraine mit Waffen und Munition in großen Mengen war diese Aufforderung des Kanzlers eine, die nicht nur einen symbolischen Wert hatte.
Denn bald meldeten die Israelis tatsächlich einen Bedarf an. In Berlin wurde dem schnell stattgegeben: 155-Millimeter-Geschosse für die Artillerie und 120-Millimeter Granaten für die Merkava-Panzer. Hier zahlte sich aus, dass Israels Artillerie die im Westen standardisierten Granatendurchmesser nutzt und die Merkava-Panzer die in Deutschland entwickelte Glattrohrkanone haben.