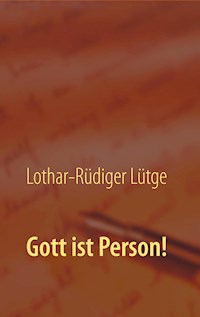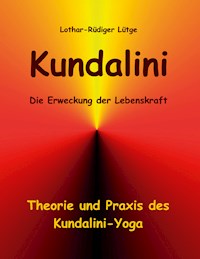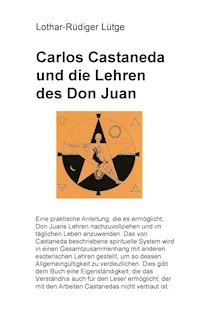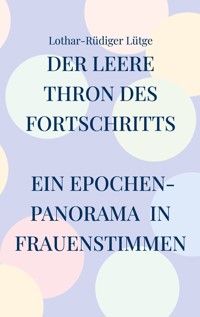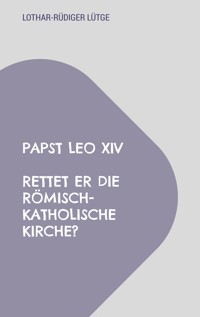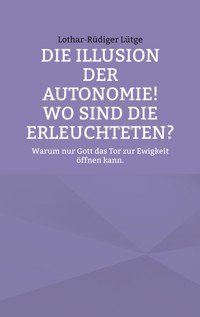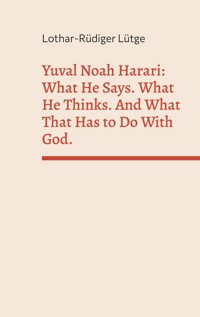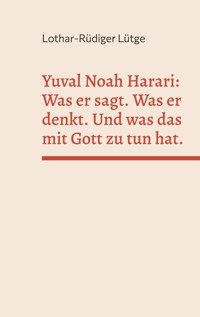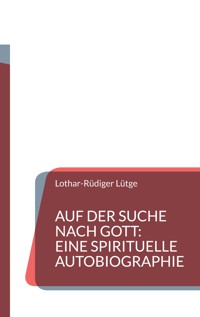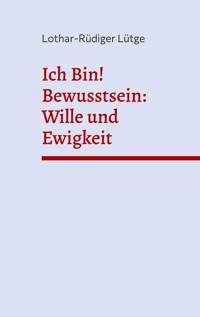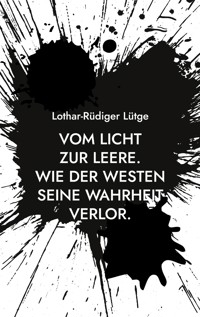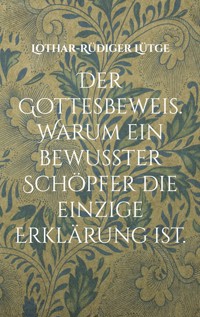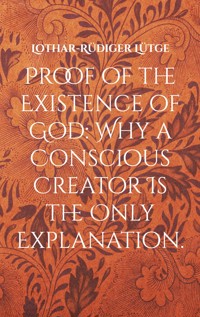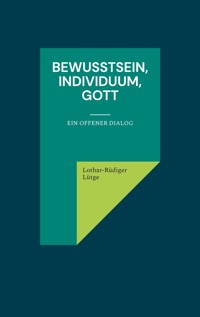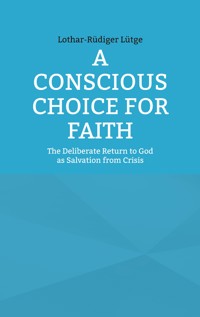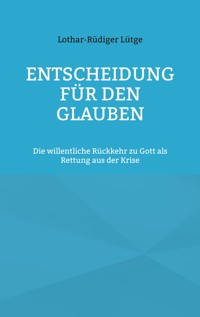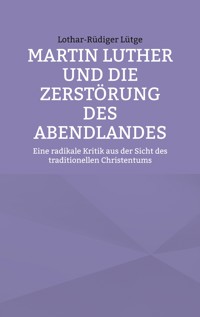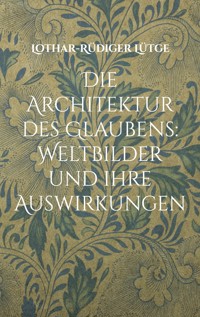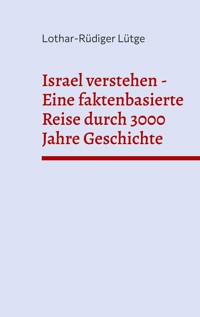
Israel verstehen - Eine faktenbasierte Reise durch 3000 Jahre Geschichte E-Book
Lothar-Rüdiger Lütge
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Israel verstehen - das ist Ziel dieses Buches. Ohne Parteinahme, aber mit klarem Blick führt es den Leser durch 3000 Jahre Geschichte: von der Frühzeit der Hebräer über die Zerstreuung in alle Welt, die Schoah und die Staatsgründung bis in die konfliktreiche Gegenwart. Fundiert, sachlich und verständlich geschrieben, bietet es Orientierung in einem Thema, das die Welt bis heute bewegt - und oft spaltet. Wer die Geschichte Israels kennt, kann die Gegenwart besser einordnen - und sich ein eigenes Urteil bilden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 111
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
„Der beste Weg, die Seele eines anderen Landes kennenzulernen, ist seine Literatur zu lesen.“
Amos Oz (1939 – 2018, israelischer Schriftsteller)
Inhalt
Einführung
Warum dieses Buch? Und warum jetzt?
Teil I
Frühgeschichte und Antike – Die Verbindung zum Land
Kapitel 1
Die frühen Erzählungen und die Ursprünge der Besiedlung
Kapitel 2
Königreiche und Tempelzeit
Kapitel 3 (I)
Perser, Griechen und Römer – Fremdherrschaft und Widerstand
Exkurs
Jesus von Nazareth – Ein Jude verändert die Welt
Kapitel 3 (II)
Der jüdische Aufstand und die Zerstörung Jerusalems
Exkurs
Zwischen Tempel und Talmud – Die Neuerfindung des Judentums
Teil II
Diaspora – Zerstreut, aber nicht vergessen (70–1948)
Kapitel 4
Verstreut in alle Welt – Der Beginn der Diaspora
Kapitel 5
Verfolgung, Pogrome und Überlebenswille
Exkurs
Licht in der Diaspora – Jüdische Beiträge zu Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft
Kapitel 6
Das jüdische Volk bleibt bestehen – Warum?
Kapitel 7
Der Holocaust – Kulmination des Judenhasses
Teil III
Die Rückkehr – Zionismus, Staatsgründung, Gegenwart
Kapitel 8
Der Zionismus – Traum, Idee und politische Bewegung
Kapitel 9
Der Weg zur Staatsgründung
Exkurs
Rückkehr nach 2000 Jahren – Fragen, Fakten, Perspektiven
Kapitel 10
Der junge Staat Israel – Aufbau, Kriege und Friedensbemühungen
Kapitel 11
Die palästinensische Frage – Wurzeln eines ungelösten Konflikts
Kapitel 12
Gaza, Hamas und der neue Nahostkonflikt
Exkurs
Der Iran-Israel-Konflikt 2025 – Prävention oder Eskalation?
Kapitel 13
Zwei Narrative – Zwei Wirklichkeiten
Kapitel 14
Israel heute – Ein moderner Staat in einem alten Land
Kapitel 15
Was bleibt? Eine offene Frage an die Welt
Einführung
Warum dieses Buch? Und warum jetzt?
Israel.
Kaum ein anderes Land wird so emotional, so kontrovers und so häufig diskutiert – und doch so selten verstanden.
Kaum ein Konflikt wird so öffentlich verhandelt – und zugleich von so vielen Missverständnissen, Halbwahrheiten und ideologischen Verzerrungen begleitet.
Israel ist zum Projektionsraum geworden: für Schuld, Hoffnung, Wut, Moral, Gerechtigkeit – je nach Perspektive.
Aber was ist Israel wirklich?
Ein Staat unter permanentem Bedrohungsdruck
Ein Land mit jahrtausendealter Geschichte und moderner Hightech-Gegenwart
Ein Ort der Rückkehr – und der Ablehnung
Ein Land der Vielfalt – und der tiefen Spannungen
Ein Symbol – und ein konkreter Ort mit konkreten Menschen
In der öffentlichen Debatte wird Israel heute oft entweder glorifiziert oder dämonisiert. Kaum jemand nimmt sich die Zeit, sich mit seiner Geschichte, seinen inneren Strukturen, seinen realen Herausforderungen und seiner Bedeutung im Weltgeschehen nüchtern und sachlich auseinanderzusetzen. Dieses Buch will genau das tun.
Wir haben es geschrieben, um:
Informationen bereitzustellen, wo Emotionen dominieren
Zusammenhänge zu zeigen, wo oft nur Teilaspekte diskutiert werden
Verständnis zu ermöglichen, wo allzu schnell verurteilt wird
Dabei verfolgen wir keine politische Agenda, keine ideologische Mission.
Wir wollen keine Parteinahme – sondern Verständnis durch Wissen.
Denn nur wer die Geschichte Israels kennt, kann seine Gegenwart einordnen.
Dieses Buch beginnt bei den Anfängen – in der Frühgeschichte, bei Abraham, bei Exodus, Tempel, Zerstörung, Diaspora.
Es begleitet die jüdische Geschichte durch die Jahrhunderte – durch Verfolgung, Überleben, Hoffnung, Rückkehr.
Und es führt in die Gegenwart – in ein Israel, das lebt, kämpft, sich verändert, sich verteidigt und zugleich sucht, fragt, streitet.
Am Ende dieses Weges steht keine Antwort. Aber vielleicht eine bessere Frage.
Teil I: Frühgeschichte und Antike – Die Verbindung zum Land
Kapitel 1: Die frühen Erzählungen und die Ursprünge der Besiedlung
Abraham, Isaak und Jakob – Die Urväter Israels
Zeitlicher Rahmen:
Biblischer Bezug: Genesis (1. Buch Mose), Kap. 12–50
Verortung laut biblischer Chronologie: ca. 1900–1600 v. Chr.
Historische Bewertung:
Die Gestalten Abrahams und seiner Nachkommen lassen sich historisch nicht verifizieren. Viele Forscher ordnen diese Erzählungen in die sogenannte Mittlere Bronzezeit ein, etwa 2000–1500 v. Chr. Eine präzise Datierung ist unmöglich, aber es spricht einiges dafür, dass sie ein kollektives Erinnerungsbild aus dem Übergang nomadischer zu sesshafter Kultur spiegeln.
Die Verbindung des jüdischen Volkes mit dem heutigen Gebiet Israels beginnt nicht erst im 20. Jahrhundert, oder mit der Rückkehr aus Ägypten, um 1.200 v. Chr., sondern reicht – gemäß der biblischen Überlieferung – viel weiter zurück. In der Genesis, dem ersten Buch der hebräischen Bibel, wird erzählt, dass ein Mann namens Abram – später Abraham genannt – aus dem Land Ur in Chaldäa (im heutigen Irak) aufbrach, weil er sich von Gott dazu berufen fühlte, in ein neues Land zu ziehen. Dieses Land, so die Verheißung, sollte ihm und seinen Nachkommen auf ewig gehören. Die biblische Darstellung nennt dieses Zielgebiet „das Land Kanaan“, eine Region, die weite Teile des heutigen Israel und angrenzende Gebiete umfasst.
Abraham gilt in der jüdischen Tradition als der erste Erzvater des Volkes Israel. Sein Weg führte ihn über Haran (im heutigen Südosttürkei/Nordsyrien) in den Süden des Landes Kanaan, wo er sich unter anderem in der Nähe von Sichem, Bet-El und Hebron niederließ. Dort – so heißt es – empfing er die Verheißung Gottes, dass seine Nachkommen zahlreich wie die Sterne sein würden und das Land bewohnen sollten. Auch wenn es sich bei diesen Erzählungen um religiöse Überlieferungen handelt, die außerhalb der Bibel keine historische oder archäologische Bestätigung finden, prägen sie bis heute das Selbstverständnis und das kollektive Gedächtnis des jüdischen Volkes.
Die Geschichte setzt sich fort mit Isaak, dem Sohn Abrahams, der ebenfalls in Kanaan lebte, und schließlich mit dessen Sohn Jakob. Jakob gilt als Stammvater der zwölf Stämme Israels, denn aus seinen Söhnen gingen jene Familienlinien hervor, die später als das Volk Israel bezeichnet wurden. Auch Jakob wird in der Bibel als jemand beschrieben, der im Land Kanaan lebte, sich zeitweise mit seiner Familie in Hebron aufhielt und schließlich – durch bestimmte Ereignisse rund um seinen Sohn Josef – mit seiner Familie nach Ägypten übersiedelte.
In der biblischen Darstellung erscheint dieses frühe Kapitel der jüdischen Geschichte als eine Abfolge göttlich geführter Wanderschaften, Verheißungen und familiärer Entwicklungen, die das Fundament für die spätere Volkswerdung Israels legen. Historisch jedoch liegen diese Erzählungen im Dunkel der Vorzeit. Archäologische Belege für die Existenz der einzelnen Patriarchen gibt es bislang nicht, und viele Historiker betrachten die Texte dieser Frühzeit als später entstandene, theologisch geprägte Rückschau auf eine mythische Vorzeit. Genaues Wissen gibt es nicht, es könnte sich also auch um reale Gegebenheiten handeln. Auf jeden Fall bilden diese Schilderungen dennoch bis heute einen integralen Bestandteil jüdischer Identität – und zwar nicht nur als religiöse Inhalte, sondern als kulturelle Ursprungsnarrative.
Besonders bedeutsam ist dabei die Vorstellung, dass das Land Kanaan – das heutige Israel – nicht einfach irgendein Siedlungsraum war, sondern der Ort einer göttlichen Verheißung. Diese Verheißung zieht sich durch die gesamte hebräische Bibel und wurde über Jahrhunderte hinweg in den Herzen und Gedanken der Diaspora-Juden bewahrt. Dass sich Abraham, Isaak und Jakob laut der Überlieferung in genau diesem Gebiet aufgehalten haben sollen, ist ein wichtiger Teil jenes tiefen inneren Zusammenhangs zwischen Volk und Land, der weit über politisch-territoriale Fragen hinausgeht.
Ob man diese Überlieferungen nun als historische Fakten, als spirituelle Gleichnisse oder als identitätsstiftende Erzählungen liest – ihr Einfluss auf das jüdische Selbstverständnis ist unbestreitbar. Und selbst wenn aus moderner historischer Sicht viele Fragen offen bleiben, beginnt die Geschichte des jüdischen Volkes – in seinem eigenen Selbstverständnis – mit der Ankunft Abrahams im Land Kanaan.
Ägyptenaufenthalt und Exodus
Zeitlicher Rahmen:
Biblischer Bezug: Exodus, Levitikus, Numeri, Deuteronomium
Traditionelle Verortung (je nach Auslegung):
Frühdatierung: 15. Jahrhundert v. Chr. (etwa 1446 v. Chr.)
Spätdatierung: 13. Jahrhundert v. Chr. (etwa um 1250 v. Chr., oft favorisiert)
Historische Bewertung:
Es gibt keine archäologisch gesicherten Hinweise auf einen groß angelegten Exodus. Einige Forscher vermuten, dass sich die Geschichte aus Erinnerungen kleinerer semitischer Gruppen speist, die Ägypten verließen. Die populärste Hypothese ordnet den Exodus grob in die Zeit des späten Neuen Reichs, also um 1250–1200 v. Chr., ein – meist unter Ramses II. oder Merenptah.
Die biblische Überlieferung führt die Geschichte der Nachkommen Jakobs weiter in das Land Ägypten. Ausgelöst durch eine Hungersnot, so erzählt das Buch Genesis, zieht Jakob mit seiner gesamten Familie nach Ägypten, wo sein Sohn Josef inzwischen eine hohe Position am Hof des Pharaos innehat. Dort lassen sich die Israeliten – zu diesem Zeitpunkt noch eine lose Stammesgemeinschaft – nieder und wachsen über Generationen hinweg zu einer großen Gemeinschaft heran.
Doch mit der Zeit, so berichtet das Buch Exodus, ändert sich das politische Klima. Ein neuer Pharao, der Josef nicht mehr kannte, sieht in der wachsenden Zahl der Hebräer eine Bedrohung für das ägyptische Reich. Die Israeliten werden zur Zwangsarbeit herangezogen und schließlich versklavt. In dieser Situation tritt Mose als zentrale Gestalt der Befreiung auf. Die Erzählung des Exodus – der Auszug aus Ägypten unter Moses Führung – gehört zu den prägendsten Motiven der jüdischen Identität und ist bis heute tief im religiösen Bewusstsein des Judentums verankert.
Gemäß der biblischen Darstellung führt Mose das Volk unter göttlicher Leitung durch die Wüste Sinai, mit dem Ziel, es zurück in das „Land der Verheißung“ zu bringen –jenes Land, Kanaan, das Abraham, Isaak und Jakob bewohnt hatten und das nun erneut die Heimstatt des Volkes Israel werden sollte. Auf dem Weg dorthin, am Berg Sinai, empfängt Mose von Gott die Zehn Gebote und übergibt sie dem Volk als göttliches Gesetz. Diese Gesetzgebung bildet in der religiösen Überlieferung das Fundament des Bundes zwischen Gott und Israel.
Historisch betrachtet, wirft der Bericht über den Aufenthalt in Ägypten und den Auszug erhebliche Fragen auf. Bis heute gibt es keine archäologisch oder dokumentarisch gesicherten Hinweise auf eine größere Gruppe semitischer Sklaven, die das Land Ägypten in der vermuteten Zeitspanne verlassen hätte. Auch die Wanderung durch die Wüste ist nicht durch Spuren belegbar. Viele Historiker sehen im Exodus daher eher ein literarisches und theologisches Konstrukt, das möglicherweise Erinnerungen an kleinere Auswanderungsbewegungen, soziale Spannungen oder regionale Konflikte aufgreift und in mythisch verdichteter Form wiedergibt.
Ungeachtet dessen ist der Exodus in der jüdischen Erinnerung nicht einfach ein historisches Ereignis, sondern ein Gründungsmythos – ein Symbol für Befreiung, Identität und göttliche Führung. Bis heute wird diese Geschichte jedes Jahr im Pessach-Fest lebendig gehalten, bei dem Juden weltweit der Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten gedenken. In diesem Sinne wirkt die Erzählung weniger als Geschichtsquelle im modernen Sinne, sondern vielmehr als ein kollektives Selbstbild, das über Generationen weitergegeben wurde und das die tiefe Verbindung des jüdischen Volkes mit dem Gedanken der Heimkehr, des Bundes und der göttlichen Bestimmung fest verankert.
Die Rückführung aus Ägypten ist somit nicht nur geografisch bedeutsam, sondern auch symbolisch: Das Volk Israel wird nicht nur physisch, sondern auch geistig zu einer Einheit geschmiedet, mit dem gelobten Land als Ziel und Hoffnung. Diese Vorstellung durchzieht bis heute die jüdische Kultur, unabhängig davon, wie der historische Kern der Erzählung zu bewerten ist.
Landnahme und Richterzeit
Zeitlicher Rahmen:
Biblischer Bezug: Josua, Richter
Traditionelle Verortung:
Landnahme: ca. 1200 v. Chr.
Richterzeit: ca. 1200–1050 v. Chr.
Historische Bewertung:
Die Landnahme wird heute meist nicht als Invasion, sondern als allmählicher Siedlungsprozess interpretiert. Die sogenannte Richterzeit ist eine Periode relativer Zersplitterung, bevor das Königtum etabliert wurde. In dieser Zeit erscheinen auch erste archäologische Spuren eines „Israel“ im zentralen Hochland.
Die Merenptah-Stele (ca. 1208 v. Chr.) nennt erstmals den Namen „Israel“ – damit ist die Existenz einer eigenständigen Gruppe im südlichen Kanaan zu diesem Zeitpunkt erstmals historisch greifbar.
Nach dem Tod des Mose, so berichtet das biblische Buch Josua, übernahm dessen Nachfolger Josua die Führung des Volkes Israel. Unter seiner Leitung begann die sogenannte „Landnahme“, also die Rückkehr der Israeliten in das Gebiet Kanaans. Die biblische Darstellung schildert diesen Vorgang als eine Serie militärischer Auseinandersetzungen, in deren Verlauf zahlreiche kanaanitische Städte erobert und zerstört wurden – darunter die berühmte Stadt Jericho, deren Mauern nach siebenmaligem Umrunden durch das Volk Israel unter Fanfarenklängen angeblich einstürzten. Auch andere Städte wie Ai und Hazor werden in den Erzählungen als Schauplätze von Eroberungen genannt.
Historisch ist diese Phase unter Fachleuten stark umstritten. Während einige archäologische Funde – etwa Brandspuren in bestimmten Ruinen – gelegentlich als mögliche Indizien für gewaltsame Zerstörungen gedeutet wurden, bleibt die groß angelegte und koordinierte Invasion, wie sie in der Bibel beschrieben ist, bislang unbelegt. Die Mehrheit der Historiker geht heute davon aus, dass die Besiedlung des Hochlands von Kanaan eher schrittweise und weniger dramatisch verlief – vermutlich durch innere Umstrukturierungen, kleinere Einwanderungsbewegungen und soziale Prozesse innerhalb der kanaanitischen Kultur selbst. Dennoch bleibt das Bild einer kraftvollen Rückkehr ins „verheißene Land“ bis heute ein zentrales Element des jüdischen Selbstverständnisses.
Nach der Landnahme folgte eine Zeit der Dezentralisierung. Die zwölf Stämme Israels lebten – wiederum nach biblischer Überlieferung – als ein lockerer Stammesverband ohne zentrale Regierung, aber mit gemeinsamen religiösen Traditionen. Diese Phase wird in der Bibel als Zeit der „Richter“ beschrieben: charismatische Führer wie Gideon, Deborah oder Samson, die in kritischen Momenten auftraten, um das Volk zu leiten oder vor äußeren Feinden zu schützen. Es handelte sich also nicht um Richter im juristischen Sinn, sondern eher um militärisch-religiöse Führergestalten mit begrenzter regionaler Autorität.
Auch diese Epoche entzieht sich einer klaren historischen Verortung. Archäologische Hinweise auf eine kohärente israelitische Identität in dieser Zeit sind rar. Allerdings gibt es Anzeichen für neue Siedlungsformen im