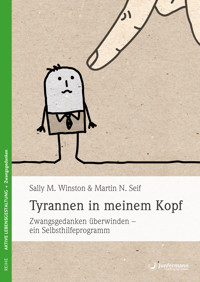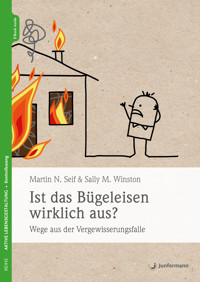
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Junfermann Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Stecken Sie in der Vergewisserungsfalle? "Woher weiß ich, ob ich die richtige Entscheidung getroffen habe?" "Was ist, wenn etwas Schlimmes passiert?" "Ich muss mir unbedingt sicher sein!" Kommen Ihnen solche Gedanken? Gedanken, mit denen Sie sich selbst infrage stellen, die Angst, Stress und Sorgen verursachen? Checken Sie immer wieder Ihre Mails, bitten Sie andere wiederholt um deren Meinung oder liegen Sie nachts wach, weil sie in aussichtslosen Beruhigungsversuchen alles haarklein analysieren und vorausplanen? Falls ja, leiden Sie vermutlich unter Kontroll- und Vergewisserungszwang. Die gute Nachricht: Sie werden es schaffen, sich aus der verflixten "Vergewisserungsfalle" zu befreien. In diesem Ratgeber finden Sie erprobte Tools, die auf der Kognitiven Verhaltenstherapie (KVT) basieren und Ihnen helfen, Frieden mit der Ungewissheit zu schließen und Ihr Bedürfnis, "auf Nummer sicher zu gehen" allmählich verringern. "Dieses Buch handelt vom Streben nach Gewissheit, wo es keine gibt." – Martin N. Seif & Sally M. Winston
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 245
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Martin N. Seif & Sally M. Winston
Ist das Bügeleisen wirklich aus?
Wege aus der Vergewisserungsfalle
Über dieses Buch
Stecken Sie in der Vergewisserungsfalle?
„Woher weiß ich, ob ich die richtige Entscheidung getroffen habe?“ „Was ist, wenn etwas Schlimmes passiert?“ „Ich muss mir unbedingt sicher sein!“ Kommen Ihnen solche Gedanken? Gedanken, mit denen Sie sich selbst infrage stellen, die Angst, Stress und Sorgen verursachen? Checken Sie immer wieder Ihre Mails, bitten Sie andere wiederholt um deren Meinung oder liegen Sie nachts wach, weil sie in aussichtslosen Beruhigungsversuchen alles haarklein analysieren und vorausplanen? Falls ja, leiden Sie vermutlich unter einem Kontroll- und Vergewisserungszwang. Die gute Nachricht: Sie werden es schaffen, sich aus der verflixten „Vergewisserungsfalle“ zu befreien.
In diesem Ratgeber finden Sie erprobte Tools, die auf der Kognitiven Verhaltenstherapie (KVT) basieren und Ihnen helfen, Frieden mit der Ungewissheit zu schließen und Ihr Bedürfnis, „auf Nummer sicher zu gehen“ allmählich verringern.
„Dieses Buch handelt vom Streben nach Gewissheit, wo es keine gibt.“ – Martin N. Seif & Sally M. Winston
Martin N. Seif, PhD, Mitbegründer der Anxiety and Depression Association of America und langjähriges Vorstandsmitglied, stellvertretender Direktor des Anxiety and Phobia Treatment Center in New York.
Sally M. Winston, Gründerin des Anxiety and Stress Disorders Institute of Maryland. Langjährige Erfahrung als Klinikerin und in der Weiterbildung von Therapeuten.
Copyright: © der deutschen Ausgabe: Junfermann Verlag, Paderborn 2021
Copyright: © der Originalausgabe: 2019 by Martin N. Seif and Sally M. Winston
Translated from the English: Needing to Know For Sure. A CBT-Based Guide to Overcoming Compulsive Checking & Reassurance Seeking
First published by: New Harbinger Publications, Inc.
Coverfoto: © NLshop – iStock
Übersetzung: Claudia Campisi
Unser Dank gilt den Urhebern des Noun Project für die Verwendung ihrer Icons in den Abbildungen dieses Buches: Abb. 1.1 Berkah Icon und Abb. 3.1 Berkah Icon, Arafat Uddin, vectoriconset10 und Tatina Vazest
Covergestaltung / Reihenentwurf: Junfermann Druck & Service GmbH & Co. KG, Paderborn
Satz: Peter Marwitz, Kiel (etherial.de)
Digitalisierung: Junfermann Druck & Service GmbH & Co. KG, Paderborn
Alle Rechte vorbehalten.
Erscheinungsjahr dieser E-Book-Ausgabe: 2021
ISBN der Printausgabe: 978-3-7495-0277-6
ISBN dieses E-Books: 978-3-7495-0278-3 (EPUB), 978-3-7495-0280-6 (PDF), 978-3-7495-0279-0 (EPUB für Kindle).
Im Gedenken an Dr. Morton Winston
Einleitung
Benjamin Franklin fand: „Sicher ist auf Erden nichts, außer der Tod und die Steuern.“
Über Letzteres könnte man sich angesichts von Steueroasen streiten, über den Tod eher nicht. Trotzdem stellt sich die Frage: Worauf ist wirklich Verlass? Woher wollen Sie wissen, dass Ihr Leben morgen nicht von einer Katastrophe, einem Unfall oder einer Krankheit ruiniert wird? Ist Ihnen wirklich kein verhängnisvoller Flüchtigkeitsfehler unterlaufen? Können Sie Ihrer Partnerin hundertprozentig garantieren, dass Sie sie ewig lieben werden? Könnten Sie Ihre Hand dafür ins Feuer legen, dass all das, was Sie für selbstverständlich halten, tatsächlich existiert und kein Traum oder die futuristische Alternative eines Computernetzwerks ist?
Mitnichten!
Wahrscheinlich will jeder Mensch das Richtige tun, doch ist das eigene Handeln mit Sicherheit immer von anständigen, korrekten oder normalen Beweggründen und Gefühlen motiviert?
Die knappe Antwort lautet: Nein. Es gibt keine Garantie. Für nichts. Wirklich. Also tun wir einfach so als ob. Wir gönnen uns die Illusion der Gewissheit.
Manche Menschen jedoch werden von dem Bedürfnis nach Sicherheit geradezu verfolgt. Da Sie dieses Buch hier gerade lesen, wissen Sie, wovon wir reden: diese plötzliche Eingebung, sich ganz sicher sein zu müssen — und die Rituale, um sich hieb- und stichfeste Gewissheit zu verschaffen. Sie prüfen Dinge nach, Sie bitten andere um deren Eindruck und Meinung und versuchen immer wieder, sich damit zu beruhigen. Eine Weile hilft das auch, aber nie auf Dauer. Mit der Zeit werden Sie für bestimmte Dinge sehr hellhörig. Vielleicht schießt Ihnen ein unerwünschter Gedanke durch den Kopf und plötzlich haben Sie den Wunsch oder den Drang herauszufinden, was das ist, denn es könnte ja eine Warnung sein. Oder Ihnen kommt eine vage Erinnerung, und um Klarheit zu haben, müssen Sie ihr nachgehen. Oder Sie werden von hartnäckigen Zweifeln überfallen. Und so wird das Nachprüfen und Sichvergewissern langsam – aber sicher – zur Sucht.
Dieses Buch handelt vom Ablegen des Kontroll- und Vergewisserungszwangs, d. h., wie man es anstellt, sich nicht mehr auf all jene mehr oder weniger offensichtlichen Maßnahmen zu verlassen, die wir zur Befriedigung des Bedürfnisses nach Nummer sicher ergreifen und damit scheitern.
Wenn Sie dazu neigen, unweigerlich vom Schlimmsten auszugehen und dann unverhältnismäßig viel Zeit und Energie darauf verwenden, sich vom Gegenteil zu überzeugen, oder wenn Sie sich über Ihre Vergangenheit den Kopf zerbrechen und die Lauterkeit Ihrer Absichten hinterfragen, dabei Ihre Verhaltensweisen, Gedanken und Einstellungen unter die Lupe nehmen, um sich davon zu vergewissern, dass Sie aus der richtigen Motivation heraus richtig gehandelt haben, dann machen Sie sich die Ungewissheit zur Feindin. Wenn andere Menschen Ihnen – oder Sie sich selbst – gut zureden und sagen: „Das wird nie passieren“, „Du hast dich bestimmt darum gekümmert“, „Das war so nicht“ oder „Es wird schon nicht so schlimm kommen“, vertreibt das kurzzeitig das Schreckgespenst und entspannt vorübergehend. Doch schon im nächsten Moment schreit irgendetwas in Ihrem Inneren wieder auf: „Bin ich wirklich sicher??“ Sie sind verängstigt, mit den Nerven am Ende und dazu voller Schuldgefühle, neue dringende Fragen tauchen auf und schon wollen Sie sich wieder absichern. Der Kreislauf geht wieder von vorne los. Sie sitzen in der Falle.
Und darum nennen wir dieses unerbittliche, zwanghafte und reflexartige Bedürfnis nach beruhigender Gewissheit „die Vergewisserungsfalle“.
Stecken Sie in der Vergewisserungsfalle?
Kennen Sie Folgendes?
Schaffen Sie es nicht, mit dem Nachkontrollieren und Sichvergewissern aufzuhören?
Gibt es Lebensbereiche oder -themen, wo Sie sich „sicher“ sein müssen? Macht es Sie verrückt, wenn Sie es nicht sind?
Nehmen Zweifel überhand? Können Sie sie nicht akzeptieren oder ignorieren?
Ertappen Sie sich dabei, wie Sie sich den Kopf über etwas zerbrechen, das passiert ist, vielleicht noch passieren wird oder hätte passieren können?
Sind die Versicherungen, die Sie bekommen, „leer“ (weil die Leute, die Sie fragen, es auch nicht besser wissen)?
Ertappen Sie sich dabei, dass Sie schon wieder irgendwelche Erkundigungen einholen, im Internet, bei Freund*innen, Familienangehörigen, Behörden oder auf der Arbeit?
Checken sie ständig Ihren Körper durch, um sicherzugehen, dass alles in Ordnung ist?
Schauen Sie immer wieder nach, ob Sie eine Nachricht per E-Mail, SMS, Telefon etc. bekommen haben?
Können Sie unmöglich damit aufhören, Schlösser, Alarmanlagen oder Gerätschaften zu überprüfen?
Reden Sie ständig mit sich selbst, um Ihre Sorgen zu beschwichtigen?
Fragen Sie andere wiederholt nach deren Meinung?
Nerven Sie andere, weil Sie sich über Gebühr entschuldigen oder auf etwas herumreiten?
Können Sie vor lauter Analysieren und Planen gegen die Angst nicht einschlafen?
Verwickeln Sie sich in nie endende, nie lösbare innere Debatten?
Sind Sie vor Entscheidungen wie gelähmt, weil Sie sich, egal wie viel Erkundigungen Sie einholen und wie oft Sie nachfragen, einfach nicht sicher genug fühlen?
Recherchieren Sie so lange, bis Sie auch ja alle Informationen beisammen haben, um definitiv Fragen zu klären oder Entscheidungen zu treffen – und stellen dann fest, dass sie trotzdem noch weitersuchen?
Wenn Sie auch nur eine dieser Fragen mit Ja beantwortet haben, dann ist das hier das richtige Buch für Sie!
Falls Ihnen wiederholt nach Rückbestätigung zumute ist und Sie sich entweder selbst darum bemühen oder sie von Freund*innen und „Expert*innen“ (einschließlich Dr. Google) einholen, die Wirkung jedoch partout nicht anhält, dann drohen Sie in die Schlingen der Vergewisserungsfalle zu geraten. Wie Studien zeigen, ist das Bedürfnis nach der sicheren Seite – bzw. die verbreitete Ungewissheitsintolerenz – die Hauptursache für Angst, Kummer und Leid (Anxiety Canada o. A., Beck 2015, Peterson 2017).
Das Problem des Sicherheitsstrebens hat zwei Seiten. Erstens ist das Ziel unerreichbar und zweitens kann das Bedürfnis überhandnehmen, alles vereinnahmen und zur Folter werden. Man wird unfrei, kann weder kleine noch große Entscheidungen treffen und wird ständig von Zweifeln geplagt. Bis das Leben einzig und allein davon beherrscht wird, alles nachzukontrollieren, damit man sich absolut sicher ist.
Und wie Sie vielleicht schon bemerkt haben, lassen sich Ihre Zweifel gar nicht durch zwanghaftes Kontrollieren und Vergewissern beseitigen! Es verschafft Ihnen nicht die ersehnte Erleichterung. Sie bekommen stattdessen sogar noch mehr Angst und Ihr Leid wird größer.
Ihre Bemühungen verschaffen Ihnen keine Ruhe, weil Ihre Lösungsmethode falsch ist: Häufigeres Vergewissern befreit nicht von Zweifeln. So erstaunlich und widersinnig es vielleicht klingt, Ihr Hang zur Vergewisserung ist problematischer als die ursprüngliche Sorge. Doch Sie können sich aus Ihren Nöten befreien, nämlich indem Sie sich mit der Ungewissheit anfreunden, sich mit ihr wohlfühlen und souveräner mit ihr leben.
Unsere Botschaft lautet: Ihre gegenwärtigen Bemühungen führen Sie in die falsche Richtung. Und wie immer gilt: Wenn Sie an einen anderen Ort gelangen wollen, dann müssen Sie einen anderen Weg einschlagen.
In diesem Buch werden Sie erfahren, wie Sie Ihre Beziehung zu der Angst verändern können, die Sie befällt, wenn Sie zweifeln. Sie werden lernen, wie Sie sich selbst vertrauen und die Möglichkeit akzeptieren, dass Sie Fehler machen und unter Ihrem Idealergebnis bleiben. Wahrscheinlich fühlen Sie sich dieser Aufgabe nicht gewachsen, aber die Informationen und Erklärungen, die Sie von uns über den Wandel Ihrer Einstellung zu Ungewissheit erhalten, werden das ändern. Wenn Wissen Macht ist, dann wird das Wissen, das wir Ihnen mit unserem Buch vermitteln wollen, Ihnen die Macht geben, sich zu befreien. Sie werden sehen: Sobald Sie dem inneren Druck nach Gewissheit nicht mehr nachgeben, werden Sie ihn los.
Machen Sie für sich das Beste aus diesem Buch
In diesem Buch erfahren Sie, was es mit dem Vergewissern auf sich hat, was es bewirkt und welche Grenzen ihm gesetzt sind. Wenn Sie sich durch das Bedürfnis nach Sicherheit und Gewissheit wie gelähmt fühlen, dann bemühen Sie sich, die Unsicherheit und Ungewissheit nach besten Kräften zu vermeiden. Das geht doch gar nicht, sagt Ihr Verstand, und trotzdem ist Ungewissheit für Sie unerträglich. Sich aus dieser Lage zu befreien wird anfangs viel Zeit und Energie in Anspruch nehmen. Aber mit der Zeit wird es leichter.
In den ersten beiden Kapiteln erzählen wir Ihnen, warum es manchmal etwas bringt, sich zu vergewissern, und manchmal nicht und wie das überhaupt funktioniert, und in Kapitel 3 und 4 stellen wir die verschiedenen Arten von Vergewisserungsfallen vor und ihre psychologischen und biologischen Mechanismen. In Kapitel 5 geht es um einen tief greifenden und folgenreichen therapeutischen Haltungswechsel. Kapitel 6, 7 und 8 werden Ihnen helfen, Ihre neu erworbene Fähigkeit im Umgang mit Ungewissheit weiter zu trainieren, indem Sie sich Situationen aussetzen, die Ihnen Angst bereiten, und sich mit Hindernissen konfrontieren, die Sie davon abhalten, die Schlingen Ihrer Vergewisserungsfalle zu lockern.
Dieses Buch ist so aufgebaut, dass Sie es der Reihe nach, von Anfang bis Ende durchlesen. Blättern Sie also bitte nicht gleich zu den letzten Kapiteln vor. Als Allererstes wollen wir Ihnen die Augen für Ihre Abwehr gegen Ungewissheit öffnen. Denn entweder merken Sie nicht, dass Sie in der Vergewisserungsfalle sitzen, oder Sie erkennen nur eine offensichtliche Art und übersehen die unterschwelligen, von denen Sie auch betroffen sind. Vielleicht halten Sie sich für einen besonders vorsichtigen oder analytischen Menschen, der einfach Klarheit braucht, oder betrachten sich als ängstlich, neurotisch oder unselbstständig. Vielleicht unterstellen Sie sich sogar Gedächtnisprobleme, Hypochondrie oder ein schwaches Selbstbewusstsein. Finden Sie anhand der realistischen Beispiele aus unserer Praxis heraus, mit welchem Vergewisserungsmuster Sie sich ins eigene Knie schießen.
Eine neue Einstellung bedeutet Freiheit
Die Ungewissheit ist umso quälender, je vehementer man dagegen ankämpft. Dabei könnte das Leben so schön, so befriedigend sein, wenn die sorgenvollen und unguten Gefühle nachlassen und Sicherheit ihren gebührenden Platz bekommt. Wir werden Ihnen zeigen, dass Angst und Leid weniger durch die Ungewissheit selbst entstehen, sondern vielmehr durch die Mühe, die es kostet, dagegen anzukämpfen und sich zu versichern. Dieses Buch kann Ihnen helfen, diese Last abzuwerfen.
1. Die Grenzen der Vergewisserung
Bestimmt kennen Sie das: Sie sind unschlüssig oder unsicher und vergewissern sich oder holen sich Bestätigung – und manchmal funktioniert es! Dann wiederum verlangt es Sie danach zu wissen, ob Sie sich wirklich richtig entschieden haben oder etwas klar genug beurteilen oder kein unzumutbares Risiko eingehen, aber das Bedürfnis ist zu stark. Keine Rückversicherung kann sie je beruhigen.
Es ist also nicht immer gleich, und meistens ist es wie im ersten Fall. Doch warum kann es auch anders sein? Warum drehen Sie sich manchmal in endlosen Spiralen aus Sorge und Beruhigung und manchmal nicht? Das ist eine wichtige Frage und daher handelt dieses Kapitel von dem grundlegenden Unterschied zwischen hilfreicher und nicht hilfreicher Vergewisserung und aus welchem Grund sie mal funktioniert und mal zur Falle wird.
1.1 Manchmal kann man sich durch Vergewisserung dauerhaft beruhigen, und manchmal nicht
Schauen wir uns zunächst den Normalfall an. Erstes Beispiel: Ihr Nachbar hat sich ein Auto gekauft, und zwar zum Schnäppchenpreis. Plötzlich fragen Sie sich voller Sorge, ob Sie für Ihr eigenes neues Auto vielleicht zu viel bezahlt haben. Eine Internetrecherche ergibt, dass der Preis – mehr oder weniger – angemessen war. Thema erledigt. Keine weitere Vergewisserung nötig.
Oder: Sie probieren ein Kleidungsstück an und fragen sich, ob Sie gut damit aussehen. Sie schauen in den Spiegel, wünschen sich, sie hätten ein paar Kilo weniger drauf, finden, dass es sitzt, und kaum sind Sie zur Tür raus, denken Sie schon nicht mehr darüber nach. Oder: Ihnen kommt der Gedanke, Sie könnten womöglich vergessen haben, eine Rechnung zu begleichen. Sie prüfen das einmal nach und stellen fest: schon erledigt. Alle Zweifel beseitigt.
In diesen Beispielen ging es um triviale Dinge. Vergewisserung kann jedoch auch bei gravierenderen nachhaltig helfen, wie wir beide, die wir uns auf die Behandlung von Menschen mit Angststörungen spezialisiert haben, es erleben. Viele von ihnen gehen nach einer erschreckenden Panikattacke zum Hausarzt und erfahren, dass sie keine körperliche Krankheit haben, sondern akute Angst. Richtig, bestätigen wir, es war kein Schlaganfall, auch kein Krebs, sie sind weder sterbenskrank noch verlieren sie den Verstand oder werden verrückt. Wir beruhigen sie, indem wir die Sache beim Namen nennen – Panikattacke – und erklären, was das ist, woher sie kommt und warum sie nicht gefährlich ist. Im Nu setzt Erleichterung ein – manchmal so stark, dass die Panikattacken sofort aufhören –, und so lernen die Betreffenden, sich nicht mehr zu fürchten, wenn sie Angst spüren. Spätestens nach ein paar Wochen Therapie bewerten sie ihren Zustand als „wesentlich besser“.
Manchen Patient*innen hingegen helfen wissenschaftliche Fakten und Erklärungen nicht. Sie bekommen trotzdem eine Panikattacke nach der anderen. Auch ihnen hat der Hausarzt versichert, dass sie nicht ernsthaft krank sind. Sie erhalten dieselben Informationen von uns: Der Übeltäter heißt Angst, es ist eine Panikattacke und sie ist harmlos. Und trotzdem, die Beruhigung hält nicht an. Jedes Mal, wenn ihr Herz laut klopft oder sie sich komisch fühlen, rennen sie zur Ärztin, um sich noch einmal mehr zu versichern. Ungewissheit und Zweifel tauchen wieder auf und verursachen noch mehr Angst und Sorge. Die Therapie schlägt nicht an, die Panikattacken häufen sich, die Angst wird stärker, und mit ihren Zweifeln können sie keinen rechten Frieden schließen: „Woher kann ich mir ganz sicher sein, dass ich nicht kurz vor einem Herzinfarkt stehe? Ich brauche eine zweite (dritte) Meinung!“ Ungehindert werden sie weiter von ihrer Angst traktiert, sie rennen von Arzt zu Arzt, von Therapeutin zu Therapeutin und versuchen, „sicher“ herauszufinden, was mit ihnen los ist. Sie machen keine Fortschritte und verlangen weiter nach Gewissheit.
Und noch ein Beispiel: Auch beunruhigende Gedanken sprechen nicht immer auf beruhigende Informationen an. So berichtete eine Patientin von Dr. W., sie sei völlig mit den Nerven fertig, weil ihr beim Sex immer Bilder ihres vorherigen Freundes durch den Kopf gingen. Als sie erfuhr, dass es sich um bedeutungslose Symptome ihrer Zwangsstörung (OCD) handelte, die keiner Aufmerksamkeit und Analyse würdig seien, verschwanden sie von selbst. Ein junger Mann hingegen, dem das Bild in den Kopf schoss, wie er mit seiner Cousine, die noch ein Kleinkind war, Sex hatte, war so fixiert auf die abwegige Möglichkeit, ein Pädophiler zu sein, dass der Satz: „Das ist nur deine OCD, die sich hier meldet“ ihm nicht half. Er mied Kinder, betete um Erlösung und verlangte ständig die Bestätigung, kein Pädophiler zu sein.
Es gibt also zwei Arten der Vergewisserung: Eine ist produktiv, die andere nicht. Der Weg aus der Falle führt nur über die Unterscheidung.
1.2 Produktive Vergewisserung
Die produktive Art der Vergewisserung ist lehrreich. So kann man zum Beispiel im Internet recherchieren oder andere fragen, die sich auf dem Gebiet auskennen, über das man mehr wissen möchte, damit man sich mit verschiedenen Optionen vertraut machen und sich auf die bestmögliche Entscheidung vorbereiten kann. Angst liebt Unwissenheit und diese wird durch Fakten abgebaut.
Sich produktiv zu vergewissern ist hilfreich. Wenn Sie dadurch letzte Unklarheiten beseitigen oder aber mit ihnen leben können, wirkt es angstmindernd. Erhalten Sie glaubwürdige, seriöse Informationen, stellt Sie das zufrieden, sodass Sie keine weiteren mehr nötig haben, nicht noch mehr Meinungen einholen oder nachforschen müssen, um ja alle Zweifel zu beseitigen. Die produktive Vergewisserung bleibt haften. Alles, was Sie brauchen, ist eine glaubwürdige Informationsquelle. Und wenn Ihnen doch etwas entgangen sein sollte, was höchstwahrscheinlich der Fall sein wird, können Sie das tolerieren. Sie müssen nicht jedem Link folgen oder weitergoogeln.
Manchmal genügt eine einzige Information zur vollständigen Beruhigung. Dr. S. war als Kind ängstlich. Einmal las er in einem Zeitungsartikel über die schrecklichen Symptome einer Krankheit und glaubte, sie alle bei sich selbst zu erkennen. Aber einen Begriff kannte er nicht, und wenn ihm den nur jemand erklärt hätte, dann wäre er enorm erleichtert gewesen. Das war der Begriff „Wechseljahre“ ...
Fakt ist: Wenn man sich mit einer einzigen sachlichen Information aus einer glaubwürdigen Quelle begnügt, landet man eher nicht in der Vergewisserungsfalle.
Produktive Vergewisserung führt zu einem Handlungsplan. An dem orientiert man sich, um etwas Bestimmtes zu tun. Beispiel: „Ich mache mir Sorgen, dass mein Kind sich unangemessene Websites anschaut, und jetzt habe ich eine App entdeckt, mit der man beim Surfen die Kontrolle über Webinhalte behält.“ Oder sie bewahrt vor einer falschen Entscheidung, z. B.: „Ich habe befürchtet, mein Haus könnte innen mit bleihaltiger Farbe gestrichen sein und müsste saniert werden. Dann habe ich herausgefunden, dass Farben seit 1978 bleifrei sind – und mein Haus ist Baujahr 1991.“ Oder man vergewissert sich erst gar nicht: „Mir kam ein seltsamer Gedanke – na und?“ Ob man nun handelt oder nicht – die Sache ist abgehakt, auch wenn vielleicht nicht alle Fragen beantwortet wurden.
Produktive Vergewisserung kann so einfach sein. Man schaut nach, ob man die Schlüssel eingesteckt oder eine E-Mail wirklich beantwortet hat. Sie wirft keine neuen Fragen oder Zweifel auf.
Und vor allem: Produktive Vergewisserung dreht sich nicht immerzu im Kreis. Sie beackert nicht wieder und wieder dasselbe Terrain. Sie zieht keine Flut von Nachfragen bei anderen Menschen nach sich oder Recherchen bei anderen Quellen oder Neuformulierungen des ewig gleichen Anliegens. Sie macht Fortschritte. Sie führt zu einem Handlungsplan.
Produktive Vergewisserung beseitigt keineswegs die Angst. Sie hilft aber, die Lage zu klären: Welche Informationen noch eingeholt oder welche Schritte noch unternommen werden müssen – selbst wenn diese vielleicht nur darin bestehen, untätig zu bleiben und die Sache auf sich beruhen zu belassen. Hier einige Beispiele:
Ängstlicher Gedanke:Was ist, wenn meine Magenschmerzen von einem Krebsgeschwür kommen?
Produktives Vergewissern bedeutet, Sie prüfen die Wahrscheinlichkeit der verschiedenen Optionen und entscheiden sich für eine verantwortungsvolle Vorgehensweise. Vielleicht führen Sie sich vor Augen, dass Sie schon einmal Magenschmerzen hatten, die sich dann aber als relativ harmlose Magen-Darm-Grippe herausstellten, und warten erst einmal ein paar Tage ab. Für eine gewisse Zeit ertragen Sie den Gedanken an die Möglichkeit einer ernsthaften Erkrankung. Sie spüren keine Dringlichkeit und müssen nicht auf Biegen oder Brechen sofort eine Antwort auf Ihre Frage haben. Sobald ein Handlungsplan steht, müssen Sie nicht immer wieder neu darüber nachdenken.
Ängstlicher Gedanke:Was ist, wenn ich meinem Freund wehgetan habe?
Falls Sie sich Sorgen machen, dass Sie einen Freund oder eine Freundin beleidigt haben, fragen Sie ihn oder sie am besten direkt (aber nur einmal!). Damit diese Vergewisserung produktiv ist, müssen Sie die Antwort bereitwillig akzeptieren, selbst wenn Sie nie sicher sein können, die Wahrheit zu hören und nicht nur eine höfliche Floskel oder eine Ausrede. Sie müssen sich mit der Antwort zufriedengeben und die Sache hinter sich lassen. Letzten Zweifeln dürfen Sie weder nachhängen noch das Ruder überlassen. Was auch immer an Zweifeln bleibt, sie können sie tolerieren.
Ängstlicher Gedanke:Was ist, wenn das Flugzeug abstürzt?
Gerade bei diesem Gedanken lassen sich die Nerven schnell von der Faktenlage beruhigen: Das Flugzeug ist so ziemlich das sicherste Transportmittel, das es gibt (auf jeden Fall sicherer als das Auto!). Wenn Sie eine Flugreise als akzeptables Risiko bewerten können, hilft Ihnen das, trotz der Sorge eine vernünftige Entscheidung zu treffen.
Wichtig, wenn auch bisweilen schwer nachvollziehbar ist, dass auch produktives Vergewissern keine absolute Sicherheit bewirkt. Letztlich ist alles eine Frage des Ermessens, man handelt eben nach bestem Gutdünken und akzeptiert die produktive Vergewisserung Seite an Seite mit eventuellen Restzweifeln. Es besteht kein Bedürfnis nach absoluter Gewissheit.
Ob die Vergewisserung produktiv ist, erkennen Sie nicht an dem, was Ihnen inhaltlich mitgeteilt wird, sondern an der Art, wie Sie darauf reagieren. Eine produktive Vergewisserung befähigt Sie zum Handeln, obwohl Sie beunruhigt und verunsichert sind. Vollkommene Sicherheit ist nicht ihr Ziel.
Fakt ist: Produktive Vergewisserung liefert keine hundertprozentige Sicherheit, erhöht aber enorm die Treffsicherheit.
Produktive Vergewisserung hat jedoch auch ihre Grenzen. Wenn es Ihnen trotz der Fakten übers Fliegen widerstrebt, ein Flugzeug zu besteigen, wissen Sie, dass Ihre Angst vorm Fliegen irrational ist und keine weiteren Fakten dagegen helfen. Oder wenn Ihre Freundin Ihnen versichert, dass Sie sie nicht verletzt haben, und Sie sich einfach nicht mit ihrer Antwort abfinden können oder wenn Sie Ihren Handlungsplan immer wieder überdenken und ändern oder wenn Sie wieder einmal Ihre Bedenken zu zerstreuen versuchen – dann helfen keine weiteren Fakten. Es liegt auf der Hand: Was Sie ursprünglich auf den Boden der Tatsachen bringen bzw. ein Problem lösen sollte, ist also in Wahrheit etwas ganz anderes: Sie sitzen in der Vergewisserungsfalle.
Fakt ist: Wenn Sie in dem Bedürfnis nach Sicherheit gefangen sind, lösen weitere Fakten nicht das Problem.
Und sobald man in dem Bedürfnis nach Sicherheit gefangen ist, wird Vergewisserung unproduktiv.
1.3 Unproduktive Vergewisserung
Diese Art der Vergewisserung liefert weder vernünftige Handlungspläne noch hilfreiche Informationen. Was immer man ins Feld führt: Nichts bleibt hängen, nichts ist je genug. Dabei erfolgt der Einstieg recht harmlos, etwa indem man einen Freund nach seiner Meinung fragt oder sich selbst von der Dummheit eines Gedankens überzeugt. Anfangs tut die unproduktive Vergewisserung noch ganz produktiv. Doch eigentlich geht es ihr gar nicht um die Fakten. Sie hat vielmehr eine Aversion gegen Ungewissheit und will einfach weniger Angst haben. Mit ihr glaubt man an die Illusion der Gewissheit und bemüht sich darum.
Unproduktive Vergewisserung ist das Bestreben, Unruhe, Angst und Stress abzubauen. So vermag man sich eine Weile lang in Sicherheit zu wiegen und atmet erleichtert auf. Angenommen, Sie machen sich Sorgen um Ihren Sohn. Er ist viel reizbarer als sonst und Sie befürchten, er könnte einen Hirntumor haben. „Unwahrscheinlich“, sagt eine Nachbarin. Augenblicklich geht es Ihnen besser. Aber hat die Nachbarin überhaupt Ahnung? Unweigerlich kehrt die Sorge zurück und damit auch das Bedürfnis nach Beruhigung. Anderes Szenario: Ihnen kommt der unpassende Gedanke, Ihnen könnte bei der Arbeit ein Fehler unterlaufen sein. Sie verschaffen sich Gewissheit, indem Sie den Gesichtsausdruck Ihrer Chefin mustern. Ihre Verunsicherung legt sich ein bisschen. Doch nur bis zum nächsten Gedanken: Wahrscheinlich hat sie den Fehler einfach noch nicht bemerkt.
Man kann sich unproduktive Vergewisserung auch als fehlgeschlagene Angstminderung vorstellen.
Fakt ist: Unproduktive Vergewisserung erzeugt die Illusion von Gewissheit – vorübergehend.
Ein Weg aus der Falle besteht darin, von der Vergewisserung abzusehen. Aber dafür muss man sie erst einmal erkennen. Wie Sie in der folgenden Abbildung sehen, gibt es drei leicht unterschiedliche Arten: die verborgene, die leere und die kontrollierende Vergewisserung. Jede versucht auf ihre Weise, Angst zu lindern, Sorgen abzubauen und irgendwie mit Ungewissheit klarzukommen.
Abbildung 1: Arten unproduktiver Vergewisserung
1.3.1 Verborgene Vergewisserung
Diese Art der Vergewisserung ist der Versuch, die Angst möglichst unauffällig zu beruhigen. Gut getarnt tritt sie in vielerlei Gestalt auf, beispielsweise als kreatives Gedankenlesen, rationales Wegargumentieren sowie obsessives Planen, Analysieren und Grübeln. Vielleicht sind Sie so sehr daran gewöhnt, sich bei sich selbst oder bei anderen zu vergewissern, dass Sie es schon automatisch tun und es nicht mehr merken.
Halten Sie manchmal Ausschau nach Hinweisen, die dagegen sprechen, dass das Befürchtete nicht eingetroffen ist oder nicht eintreffen wird? Nehmen wir an, Sie gehen zur Mammografie und beobachten die Technikerin: Wirkt sie nervös oder entspannt? Können Sie an ihrem Gesicht etwas ablesen? Sie vergewissern sich in der Hoffnung auf Zeichen, dass alles in Ordnung ist. Oder wenn das Flugzeug gewaltig rüttelt und Sie den Flugbegleiter anstarren. Schaut er unerschrocken? Sie halten Ausschau nach Anhaltspunkten, dass die Turbulenzen nicht zu heftig sind und der Flug sicher verläuft. Die ruhige Art des Flugbegleiters stimmt Sie zuversichtlich – im Moment jedenfalls.
Manchmal läuft dieser Prozess noch unterschwelliger ab. Sie wollen doch nur „Feedback“. Sie befürchten, eine dumme oder verletzende Bemerkung gemacht oder eine Präsentation vermasselt zu haben und scannen Ihre Umgebung nach anerkennenden Gesten oder Blicken ab. Alle Interaktionen beurteilen Sie sorgfältig, ob sie auf Kränkung oder Missbilligung hinweisen. Das Problem ist: Ihr Urteil ist subjektiv. Also bleibt es bei bloßen Vermutungen, die Sie natürlich jederzeit infrage stellen können. Sie werden sich niemals sicher sein. Pure Gedankenleserei. Stumme Bitten.
Verborgene Vergewisserung maskiert sich auch als „Planung“. Zum Beispiel: Sie liegen nachts im Bett und überlegen sich, wie Sie auf alle möglichen Wendungen eines bevorstehenden Gesprächs reagieren könnten. Sie versuchen sich selbst davon zu überzeugen, dass Sie mit Ihrer perfekten Dialogvorlage etwaige Probleme oder Ziele meistern werden, egal was die anderen sagen oder tun. Oder Sie schmieden „Fluchtpläne“ für Notlagen und fragen für alle Fälle beispielsweise als Erstes nach den Toiletten, oder Sie überlegen sich Ausreden, sollte die Angst überhandnehmen. Wie Sie vielleicht schon festgestellt haben, ist die Wirkung dieser Art von „Planung“ nicht von Dauer: Sie verleiht Ihnen kein Vertrauen in Ihre Geistesgegenwart.
Manchmal nimmt verborgene Vergewisserung die Form rationaler Selbstgespräche an. Doch leider sind diese nicht von Substanz, und da man findet, das sollte aber so sein, ist die Frustration besonders groß. Setzt sich das zweifelnde „Ja, aber“ durch, dreht sich der innere Streit zwischen dem rationalen und dem irrationalen Ich im Kreis und eskaliert. Ein solches rationales Selbstgespräch hat keinen Bestand, weil nichts, das nicht alle Restzweifel mit absoluter Sicherheit beseitigt, akzeptabel, erträglich oder erlaubt ist. Ihre Argumentation kann noch so gut sein – sie wird nicht überzeugen, weil Ungewissheit einfach nicht sein darf.
Derartige Selbstgespräche zur Bewältigung und Minderung der Angst vor der Ungewissheit misslingen. Sie mögen zwar Gegenargumente finden, aber lange werden Sie sich die nicht abkaufen. Hier einige Beispiele: „Ich liebe Kinder. Ich würde ihnen nie etwas antun.“ „Bestimmt hast du die Beträge korrekt addiert, das tust du doch immer.“ „Letztes Mal waren meine Sorgen ja auch unbegründet.“ Leider führt unproduktives Wegargumentieren in der Regel nur zur Eskalation. Das Erstellen von Für-und-Wider-Listen ist auch nicht besser. Dito das Rezept „negative Gedanken durch positive ersetzen“.
Oder Sie fragen sich: „Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass es wirklich so schlimm kommt, wie ich es mir vorstelle?“ Oder: „Wie wahrscheinlich ist es, dass das eintritt?“ Oder das endlos wiederholte Mantra von der Wahrscheinlichkeit von 0,01 %, dass die Kellnerin über Ihren Teller gehustet hat oder von der Wahrscheinlichkeit von eins zu einer Million, dass es heute einen Terrorangriff im Shopping-Center geben wird. Die meisten in der Vergewisserungsfalle Gefangenen wissen schon, worauf das hinausläuft: Es geht nach hinten los.
Hier eine kleine, aber feine Variante: Mal angenommen, Sie fahren mit dem Auto über eine Brücke und haben Angst, plötzlich abzustürzen. Ihr Therapeut hat Ihnen geraten, sich mit Ihrer Angst zu konfrontieren und trotzdem über die Brücke zu fahren. Wenn Sie sich nun wiederholt zur Beruhigung sagen: „Mein Therapeut würde mich doch keiner Gefahr aussetzen“, wird Ihre Angst einen Augenblick lang nachlassen. Doch im nächsten werden Sie sich fragen, ob Sie ihm alles richtig erklärt haben und er wirklich Ahnung hat. Sie könnten ja auch jene berühmte Ausnahme sein, die die Regel bestätigt.
Fakt ist: Die Wahrscheinlichkeitsberechnung negativer Folgen ist keine langfristige Lösung.
Sich bei anderen klammheimlich Versicherungen zu holen geht auch, indem man umgekehrt ihnen gut zuredet. Man darf nur keine Einwände kassieren. Einige Beispiele für solche unausgesprochene Bitten:
Das wird mein Problem lösen. (Nicht wahr?)
Ich habe ihn nicht verletzt. (Oder doch?)
Ich habe niemanden überfahren. (Du hast nichts gesehen, oder?)
Ich liebe dich. (Liebst du mich auch?)
Ich bin echt in Ordnung. (Findest du das auch?)
Das war eine gute Therapiesitzung. (Oder etwa nicht?)
Wer Bestätigungen braucht, schämt sich oft, direkt darum zu bitten, weil man nun einmal selbstsicher zu sein hat. Meist gehen ihnen die anderen auf den Leim und geben freundlicherweise ihre Zustimmung oder haben zumindest nichts dagegen einzuwenden.
Fakt ist: Gedankenlesen, nutzlose Selbstgespräche und stumme Bitten sind Formen der verborgenen unproduktiven Vergewisserung.
1.3.2 Leere Vergewisserung
Die zweite Art der unproduktiven Vergewisserung ist, sie sich bei Menschen zu holen, die es auch nicht besser wissen. Dann geht sie ins Leere. Häufig ist das eine Bitte um Antwort auf Fragen, für die es keine Antworten gibt, etwa was die Zukunft bringen oder ob einem etwas zustoßen wird – als ob irgendjemand in der Lage wäre, Glück, Erfolg oder Gerechtigkeit zu garantieren. Die Beruhigung ist eine hohle Nuss. Sie ist unvernünftig, ohne Sinn und Wert und zieht die Schlinge unabsichtlich noch enger.