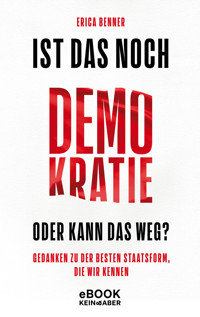
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kein & Aber
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Durch die Brille einer Frau, einer Philosophin, einer "Ausländerin", die auf fünf Kontinenten zu Hause war: Erica Benner führt uns zu den wunden Punkten der Demokratie. Geboren und aufgewachsen in Japan, hat sie große Teile ihres Lebens in Großbritannien verbracht, war in Südafrika, in den USA, in der UdSSR, in Frankreich, Polen, Ungarn, Kolumbien, Deutschland und in China. An diesen Orten hat sie gelebt und gelehrt und verschiedene demokratische Gesellschaften aus nächster Nähe beobachtet. In Japan das Konzept der "Fremden", in England die Klassenunterschiede, in den USA der Rassismus, in China Genderfragen - eines wird überall deutlich: Wie Männer über Frauen sprechen, wie Mehrheiten über Minderheiten oder Gebildete über weniger Gebildete: Gleichheit ist und bleibt ein Ideal. Erica Benner befragt die historischen Vordenker der Demokratie und zieht daraus Schlüsse für die Gegenwart. Denn wir brauchen die Demokratie, und die Demokratie braucht uns.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 342
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhalt
» Über die Autorin
» Über das Buch
» Buch lesen
» Impressum
» Weitere eBooks von Kein & Aber
www.keinundaber.ch
Über die Autorin
Erica Benner wurde 1962 als Tochter US-amerikanischer Eltern in Japan geboren. Sie ist eine politische Philosophin, die an der Universität Oxford, der London School of Economics und in Yale gelehrt hat. Ihre Machiavelli-Biografie Be Like the Fox wurde vom Guardian zu einem der besten Bücher des Jahres 2017 gewählt und in zahlreiche Sprachen übersetzt. Sie lebt und arbeitet in Berlin.
Über das Buch
Durch die Brille einer Frau, einer Philosophin, einer »Ausländerin«, die auf fünf Kontinenten zu Hause war: Erica Benner führt uns zu den wunden Punkten der Demokratie. Geboren und aufgewachsen in Japan, hat sie große Teile ihres Lebens in Großbritannien verbracht, war in Südafrika, in den USA, in der UdSSR, in Frankreich, Polen, Ungarn, Kolumbien, Deutschland und in China. An diesen Orten hat sie verschiedene demokratische Gesellschaften aus nächster Nähe beobachtet. In Japan das Konzept der »Fremden«, in England die Klassenunterschiede, in den USA den Rassismus, in China Genderfragen. Daran wie Männer über Frauen sprechen, wie Mehrheiten über Minderheiten oder Gebildete über weniger Gebildete zeigt sich überall: Gleichheit ist und bleibt ein Ideal. Und dennoch: Die Einzigen, die etwas zum Guten verändern können, sind wir selbst.
Inhalt
Vorwort
ANFÄNGE UND MYTHEN
1. Aus Feuer geboren
2. Sind Demokratie und Tyrannei Gegensätze?
3. Über das Verdrängen unbequemer Wahrheiten
4. Der Drang zu herrschen
5. Können auch Frauen dem Klub beitreten?
6. Die furchterregende Macht des Volkes
7. Die Kontrolle zurückgewinnen
ANHALTENDE KÄMPFE
8. Warum die Machtkämpfe niemals enden
9. Wie man einen Anführer auswählt
10. Wenn Frauen Bärte tragen
11. Sollen wir den Experten vertrauen?
12. Bildung und Bescheidenheit
13. Redefreiheit und diffamierende Sprache
14. Wie gehen wir mit Fremden um?
GEFÄHRLICHE BEDROHUNGEN
15. Über den Fortschrittsglauben
16. Ist Freiheit wichtiger als Gleichheit?
17. Wettbewerb und Lügen
18. Wie wir Demagogen erschaffen
19. Wann ist eine Demokratie nicht länger demokratisch?
20. Wofür es sich zu kämpfen lohnt
Dank
Vorwort
Im Jahr 2026 wird die Demokratie ihren 250. Geburtstag begehen.1 Vermutlich wird es keine Siegesfeier werden. Millionen Menschen auf der ganzen Welt, die in autoritären Regimen leben, sehnen sich nach Freiheit, doch nicht wenige fragen sich auch, ob die Demokratie die beste Alternative darstellt. Einige Menschen, die in demokratischen Staaten leben, haben ebenfalls Zweifel. Angesichts der vielen welterschütternden Probleme, die uns bedrängen – ein gefährlicher globaler Wettbewerb, digitale Technologien, die die Menschen manipulieren und polarisieren, der verheerende Klimawandel –, ist die Frage durchaus angebracht, ob eine Regierungsform, die auf endlosen Debatten zwischen streitsüchtigen, uninformierten Bürgern basiert, diese Herausforderungen überhaupt bewältigen kann. Sollten wir nicht besser Experten mehr Macht einräumen, oder jenen Führungspersonen, die eine konkrete Vision für unser Land mitbringen?
Ich gehöre nicht zu diesen Zweiflern. Für mich besteht der beste Weg, die Probleme unserer Zeit anzugehen, darin, die politische Macht gleichmäßiger zu verteilen und auszuweiten, anstatt sie in die Hände von Anführern zu legen, denen unser persönliches Wohl und unsere gemeinsame Zukunft am Herzen liegen mögen – oder eben auch nicht. Die Untersuchung politischer Verhaltensmuster in der Geschichte hat gezeigt, dass die Zusammenarbeit von vielen dauerhafteren Erfolg erzielt, die Lebensqualität der Menschen erhöht und dem Einzelnen ein weitaus größeres Sicherheitsempfinden bietet als eine Regierung der wenigen. Ich hoffe, dass Menschen, die über die Fähigkeiten verfügen, die mir fehlen, die neuen Technologien nutzen werden, um öffentliche Institutionen zu schaffen, wie wir sie noch nie zuvor gesehen haben, in denen Laien und Fachleute ihre praktischen Ideen, ihre moralischen und religiösen Ansichten darlegen und gemeinsam Politik gestalten können.
Doch wir werden keine effektiven Lösungen finden, solange wir nicht verstehen, wie unsere Probleme entstanden sind, und uns eingestehen, dass auch in Demokratien schon einiges gehörig schiefgelaufen ist. Wenn wir wollen, dass die Demokratie uns dabei hilft, lokale, nationale und weltweite Koalitionen aufzubauen, um die drängenden Probleme unserer Zeit anzugehen, müssen wir – und mit »wir« meine ich alle von uns, die in einer Demokratie leben oder es gerne würden – uns nicht nur ihre Stärken, sondern auch ihre Schwächen genauer ansehen.
Dabei greife ich auf meine eigenen Erfahrungen in den Ländern zurück, in denen ich gelebt und die ich bereist habe. Außerdem gehe ich auf die historischen Anfänge der Demokratie ein – im antiken Athen und Rom, im Florenz der Renaissance und während der Amerikanischen und der Französischen Revolution –, um ein klareres Bild von der widerspenstigen Realität hinter den demokratischen Idealen zu gewinnen.
Die Gemeinschaft der selbstbestimmten Bürger, der Demos, nimmt in diesem Buch die Hauptrolle ein. Bei meinen Reisen durch die Demokratien verschiedener Länder und Epochen interessiere ich mich weniger für die politischen Institutionen als für die Menschen und wie es ihnen gelingt, Selbstbestimmung umzusetzen. Damit meine ich nicht die Anführer, auch wenn einige von ihnen sich in den Vordergrund drängen und übermäßig viel Aufmerksamkeit für sich beanspruchen. Viel interessanter sind die ganz normalen Bürger, die eine Meinung haben und wählen gehen (oder auch nicht), die Online-Posts lesen oder schreiben, Demonstrationen und Debatten veranstalten und darüber nachdenken, wie Politik unser Privatleben und die Zukunft unserer Kinder beeinflusst.
Platon glaubte, dass die Seelen der einzelnen Bürger – das altgriechische Wort für Seele lautet psychē – die Verfasstheit eines Staates ebenso sehr beeinflussen wie umgekehrt. Politische Entitäten sind lebende, atmende Organismen, die eine eigene Seele haben, die von den Strukturen der Institutionen geformt, aber von den Seelen der Einzelnen belebt wird, die wiederum von ihren unterschiedlichen sozialen und ökonomischen Lebensumständen und ihrer persönlichen Geschichte geprägt sind. Selbst die effizientesten Institutionen können auf lange Sicht nur funktionieren, wenn die Menschen sich mehr oder weniger an ihre Vorgaben halten.
Und wo auch immer in den letzten 2500 Jahren Demokratien entstanden sind, haben die Menschen, die in ihnen lebten, sich durch ihr Fehlverhalten hervorgetan. Vom antiken Athen bis heute sind selbstbestimmte Bürger jeder Couleur ständig vom Skript abgewichen. Sie stellen das Grundkonzept ihrer Regierung infrage, erfinden wortreiche Ausreden, um Regeln zu umgehen, und wählen Anführer, die ihnen versprechen, sich nicht unbedingt an die Regeln zu halten. Oder sie untergraben die Grundfesten der Demokratie, ohne dabei gegen Vorschriften zu verstoßen – beispielsweise wenn die Anhänger einer ethnischen Gruppe, Partei oder Ideologie Desinformation nutzen, um Institutionen zu monopolisieren, die dazu geschaffen wurden, die Macht breiter zu verteilen.
In den heutigen dicht bevölkerten, bürokratischen Demokratien mag es scheinen, dass nur diejenigen Einfluss auf das politische System nehmen können, die besonders durchsetzungsfähig sind. Aber die psychē von uns Durchschnittsbürgern kann sich dennoch bemerkbar machen. Wir werden uns dieser Macht vor allem in Zeiten großer Anspannung bewusst, wenn im Wahlkampf der Ausgang ungewiss ist oder wenn Polarisierung, Grobheit oder Gewalt zunehmen. Sobald Führungspersonen davon sprechen, maßgebliche Institutionen und Gesetze zu reformieren, um die Risse in unseren Demokratien zu kitten, wird meist schnell klar, dass ihre Reformen entweder im Parlament scheitern oder von den gutgesinnten Seelen der Bürger nicht ausreichend unterstützt werden.
Das bedeutet, dass institutionelle Reformen selten ausreichen, um Demokratien zu reparieren. Um sie neu zu justieren und wieder glaubwürdig zu machen als Option für Menschen, die eine neue Demokratie erschaffen wollen, müssen wir also einen unverstellten Blick auf uns selbst zulassen und unser Denken und Handeln überprüfen. Dieses Buch wirft ein schonungsloses Licht auf die Irrtümer, Ängste, Dummheiten, Peinlichkeiten, Anmaßungen, die Doppelmoral und die Verblendung, die Teil jeder Demokratie sind. Ich beschäftige mich auch mit der Frage, ob die ökonomischen, kulturellen und ideologischen Umfelder demokratischer Institutionen diese stärken oder belasten. Ich untersuche die Wünsche und Bedürfnisse, die wir auf unsere Regierungen projizieren: Was soll die Demokratie für uns tun, für Menschen in anderen Ländern, für die Zukunft der Menschheit? Und ich wage einen kritischen Blick auf unsere Haltung gegenüber Mitbürgern und Menschen aus anderen Ländern, und unsere Bereitschaft, diejenigen als Gleichwertige anzuerkennen, mit denen wir uns – ob wir nun wollen oder nicht – den politischen und globalen Raum teilen müssen.
Moderne Vorstellungen von Demokratie halten die Gleichheit hoch und fordern Respekt für alle Bürger. Dennoch herrscht auch heute in den meisten Demokratien eklatante Ungleichheit. Und sie wächst in erschreckendem Tempo, in einer hyperkompetitiven Welt, die auf Rangordnung, exzessiven Reichtum und nationale Größe fixiert ist.
Die Kluft zwischen egalitären Idealen und der Realität schwächt die Demokratie – nicht nur dort, wo sie seit Jahrzehnten oder gar Jahrhunderten stark erschien, sondern auch als politische Option für Menschen auf der ganzen Welt. Ökonomische Ungleichheit schafft enorme Diskrepanzen, was politischen Einfluss und Chancengleichheit angeht, obwohl doch alle Bürger grundsätzlich gleich sein sollten. Die Gegenreaktionen, die die Fortschritte in der Gleichstellung aller Ethnien und Geschlechter ausgelöst haben, befeuern Extremismus sowohl von rechts als auch von links, und verstärken die Zweifel, ob die maßgeblichen Institutionen der Demokratie tatsächlich für alle Menschen tauglich sind. Derartige Entwicklungen in Ländern, die lange Zeit als Vorzeigemodelle der liberalen Demokratie galten, lassen Menschen andernorts daran zweifeln, ob sie dem nacheifern sollten. Wenn man allen Menschen Macht verleiht – egal, ob sie reich oder arm, an einem Ort verwurzelt oder global mobil sind –, hilft es ihnen dann dabei, sich ein besseres und sicheres Leben aufzubauen? Oder könnte ihre neu gewonnene Freiheit dazu führen, dass sie in einen kraftraubenden Konkurrenzkampf geraten und versuchen, ihre jeweilige politische Agenda durchzusetzen und sich so viel Aufmerksamkeit, Geld und Macht zu verschaffen, wie sie nur können?
Gleiches Stimmrecht, gleiche Freiheiten, gleiche Chancen, gleiche Anteile an einem gemeinsamen ökonomischen Kuchen, gleicher Respekt – das sind nicht nur Schlagwörter. Menschen setzen sich aus guten Gründen dafür ein, die nichts mit rechter oder linker Ideologie zu tun haben. Lange vor der Psychologie haben die Geschichtswissenschaft und die Philosophie beobachtet, dass das Streben nach Macht die Menschen mindestens ebenso antreibt wie ihre Ideale.2 Menschen sind kompetitiv – wir sehen uns selbst gern als »gleicher als andere«, wie schon George Orwell bemerkte. Menschen sind misstrauisch – wir befürchten, wenn wir Schwäche zeigen, könnten andere es ausnutzen. Politische Gleichheit ist deshalb so verlockend, weil sie verspricht, dem Konkurrenzkampf Grenzen zu setzen, während jeder und jede Einzelne einen gerechten Anteil an der Macht behält: Mitbestimmung, Grundfreiheiten, eventuell sogar einen sicheren Lebensunterhalt. Eklatante Ungleichheit hingegen setzt manche Menschen auf gefährliche Weise der Macht anderer aus. Diese Unsicherheit befeuert Zweifel an der Demokratie und stärkt anti-demokratische Bewegungen.
Die meisten von uns wünschen sich gerade so viel Gleichheit, dass wir uns sicher und respektiert fühlen können. Doch wenn sich die Möglichkeit ergibt, mehr Sicherheit, Wohlstand, Ansehen oder Einfluss als andere zu gewinnen, ist es verlockend, sich darauf einzulassen. Wir brauchen unterschiedliche Arten von Macht, um gehört zu werden und Politik mitzugestalten und für uns und unsere Familien ein gutes Leben aufzubauen. Doch wie viel Macht ist dazu nötig? Und wie viel Macht können Einzelne für sich beanspruchen, ohne den Anteil anderer zu schmälern?
Als politische Idee ist Gleichheit keine Forderung nach vollkommener Parität oder Übereinstimmung – oder sollte es jedenfalls nicht sein –, sondern vielmehr ein grober Maßstab für eine ganze Reihe von unterschiedlichen menschlichen Fähigkeiten und Ressourcen, die dazu beitragen, ein gesundes Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. Diese Art von Gleichheit, die die Demokratie stützt, muss ständig danach streben, die wechselhaften Kräfte in einem prekären Gleichgewicht zu halten. Ich habe mich mein Leben lang bemüht zu verstehen, weshalb die demokratische Gleichheit so verlockend und gleichzeitig so schwer fassbar ist. In diesem Buch spüre ich der problematischen Beziehung zwischen Demokratie und Gleichheit in der Geschichte und in verschiedenen Ländern dieser Welt nach.
Eine der Botschaften dieses Buches ist, dass wir eine klareres, pragmatischeres Verständnis der Ziele und Zwecke einer Demokratie brauchen, wenn wir sie für die Zukunft erhalten wollen. Das bedeutet nicht, dass wir von unseren idealistischen moralischen Grundüberzeugungen absehen sollten. Im Gegenteil, die Ziele und Zwecke, auf die ich verweise, sollen den demokratischen Grundprinzipien wie Gleichheit und geteilter Freiheit neues Leben einhauchen – und entsprechen ihnen weitaus mehr als einige der quasi-religiösen oder revolutionären Ideale, die ihre Schatten auf unsere Demokratien werfen und uns alle irritieren.
Das rhetorische Skript moderner Demokratien geht üblicherweise über den Konflikt zwischen Ideal und Wirklichkeit hinweg. Die Biografie der Demokratie wird als eine Geschichte heroischer Triumphe über die Tyrannei präsentiert, gefolgt von einer fortschrittlichen Entwicklung – natürlich mit einigen Rückschlägen, doch grundsätzlich hin zu noch mehr Gleichheit und Teilhabe. Um ein realistischeres Bild zu erhalten, beziehe ich mich des Öfteren darauf, was wohlmeinende, aber dennoch kritische Beobachter über die Demokratie zu sagen hatten, bevor die Amerikanische und die Französische Revolution versprachen, Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit in die Welt hinauszutragen. Sie wussten von Anfang an, dass es eine schwierige Aufgabe sein würde, die Macht mit dem Volk zu teilen, selbst wenn dieses aus heutiger Sicht klein und homogen wirken mag. Die vorsichtigen Befürworter der Demokratie aus dem antiken Athen, Rom und dem Florenz der Renaissance kommen in jedem einzelnen Kapitel zu Wort, zu Fragen, die uns heute noch immer beschäftigen. Sie sind eine ungemein bereichernde Quelle an selbstkritischem, dennoch pro-demokratischem Denken für unsere Zeit.
Dieses Buch besteht aus drei Teilen. Sie reflektieren die antike Vorstellung von einer Volksregierung als lebendiges Wesen, das von uns Durchschnittsbürgern erschaffen wird, und das wir durch unsere Entscheidungen stärken oder auch schwächen.
Die Ursprünge der Demokratie (Teil I: Anfänge und Mythen) sind weitaus weniger heroisch, als die moderne Mythologie behauptet. Der Ruf nach Gleichheit und Freiheit geht einher mit dem Bestreben, über andere zu herrschen – oder starke Anführer zu haben, die versprechen, innere und äußere Bedrohungen auszumerzen und ein flüchtiges Gefühl von Sicherheit zu erzeugen. Zeit und Erfahrung können derartigen Sehnsüchten nur selten etwas anhaben. Sie sind ebenso Teil der menschengemachten Demokratie wie der Wunsch nach Freiheit und Anerkennung.
Wenn eine Demokratie mehr als nur einige Jahrzehnte überstehen soll (Teil II: Anhaltende Kämpfe), dann stehen ihr permanente Auseinandersetzungen um das Gleichgewicht der Kräfte bevor. Mitunter führen Zweifel an der Regierung, an der Glaubwürdigkeit von Experten und anderen gebildeten Eliten, an Redefreiheit oder Einwanderung dazu, dass sich eine Demokratie in zwei verfeindete Lager aufspaltet. In der Römischen Republik, erzählte mir ein schonungslos realistischer Student der Alten Geschichte, spielten sich zwischen den Bürgern und den patriarchalischen Eliten »ungewöhnliche und fast wilde« Szenen ab, wenn »das ganze Volk gegen den Senat und der Senat gegen das Volk schrie, wie es lärmend durch die Straßen tobte, die Kaufläden geschlossen wurden«3 und Ähnliches mehr. Wie kontrovers manche Debatten auch sein mögen, so stellen sie in den meisten Demokratien doch eine unabdingbare Konstante dar. Und die Zwistigkeiten sind nicht immer so bedrohlich für die Demokratie, wie es zunächst scheinen mag. Es kommt darauf an, wie wir mit ihnen umgehen.
All diese Turbulenzen machen es schwierig zu bestimmen, wann die übliche Unruhe innerhalb einer Demokratie zu einer lebensbedrohlichen Krise ausartet (Teil III: Gefährliche Bedrohungen). Ängste und Ressentiments, die durch schlecht gehandhabte Ungleichheiten entstehen, sind fast immer der Auslöser dafür, dass Demagogen an Zuspruch gewinnen, nationale Ideologien aufkommen, Fortschritte im Kampf um Gleichberechtigung ausgebremst werden und der Autoritarismus mehr Zulauf bekommt.
Auch wenn ich davor warne, von der Demokratie mehr zu erwarten, als unsere menschliche Natur zulässt, bin ich doch der Ansicht, dass sie noch immer eine erstaunliche und wunderbare Errungenschaft ist.
Unter Zuhilfenahme von Geschichte und Philosophie, indem ich den Menschen an verschiedenen Orten und zu unterschiedlichen Zeiten zugehört und mich selbst hinterfragt habe, möchte ich ein realistisches Bild vermitteln, das uns dabei hilft, herauszufinden, was wir tun müssen, um mit den Machtkämpfen umzugehen, die sich unerbittlich durch all unsere Demokratien ziehen – und zu erkennen, warum sie es wert sind, dass wir uns weiterhin um sie bemühen.
Einige Namen wurden geändert, um die Privatsphäre und die Sicherheit der betroffenen Personen zu wahren.
1 Nachdem die Vereinigten Staaten 1776 ihre Unabhängigkeit von Großbritannien erklärten, wurde auch andernorts die Forderung nach Selbstbestimmung laut: Am Anfang standen die Französische Revolution von 1789 und der Sklavenaufstand gegen die französischen Kolonialherren auf der Karibikinsel Saint-Domingue (heute Haiti).
2 Siehe Kapitel 8.
3 Niccolò Machiavelli, Discorsi I.4.
ANFÄNGE UND MYTHEN
1.
Aus Feuer geboren
Siebzehn Jahre vor meiner Geburt kam die Demokratie nach Japan, als riesige Feuerbälle auf zwei Küstenstädte fielen und die Körper von Menschen, Hunden, Katzen, Ratten, Kühen, Krebsen, Bäumen, Büschen, Ameisen, Raupen, Bienen und anderen Lebewesen verglühen ließen. Die Überlebenden des Krieges waren wie betäubt angesichts der beiden Atombomben, die auf sie niedergegangen waren, sodass sie die Verfassung, die ihnen ihr ehemaliger Gegner auferlegte, anstandslos akzeptierten und zu einer Demokratie wurden.
Mein Vater war einer der Stabsoffiziere, die den Befehl an den Piloten der Enola Gay gaben, die Atombombe über Hiroshima abzuwerfen. Er war ein fünfundzwanzigjähriger Captain der US Air Force, der auf der winzigen Pazifikinsel Tinian stationiert war, und nur für den technischen Ablauf zuständig, wie er sagte. Als junger Offizier wusste er nicht, worin genau seine Mission bestand. Die amerikanische Regierung und ihre Militärberater glaubten, die Bomben würden den Krieg rasch und endgültig beenden. Der Zweck heiligt die Mittel. Doch wenn er darüber sprach, wirkte sein Blick unsicher.
Wir gingen damals oft in unserem Viertel spazieren, das heute eine schicke Einkaufsgegend ist, in der sich winzige hölzerne Schreine zwischen Kenzo- und Prada-Boutiquen verstecken. Hin und wieder kamen wir an einem unbebauten Grundstück vorbei, auf dem Schutt und vom Regen durchnässte Pornomagazine verstreut lagen. Vor dem Krieg stand hier ein großes Wohnhaus, sagte mein Vater dann. Er hatte noch die Ruinen gesehen, als die amerikanischen Soldaten Tokio einnahmen. Unser Haus stand auf den Trümmern einer japanischen Brautschule. Junge Frauen verbrachten dort ein Jahr und lernten, wie man japanische und westliche Speisen zubereitet, neben weiteren nützlichen Fertigkeiten, die man braucht, um als Ehefrau zu bestehen. Wenn meine Mutter im Garten Tulpen, Pfingstrosen und Krokusse pflanzte, stieß sie häufig auf Porzellanscherben aus der Schulkantine, die bei den Luftangriffen der US-Bomber auf Wohnviertel wie unseres zerstört wurde.
Japan hat seine eigenen Schöpfungsmythen, die in alten Manuskripten niedergeschrieben sind, den Kojiki. Die Sonnengöttin Amaterasu Ōmikami vereinigte sich mit ihrem Bruder Mond, und so wurde diese wunderschöne Insel geboren. Doch Japan kennt keine erbaulichen Geschichten über die Geburt seiner Demokratie, die mit der amerikanischen Militärokkupation nach dem Zweiten Weltkrieg Einzug hielt. Es gibt keine kleinen, aber dennoch unbesiegbaren anti-imperialistischen Helden, keine brillanten Verfassungsschreiber, nicht einmal einen ehrwürdigen Vater des Volkes. Nur zahllose Kriegserinnerungen, die so schmerzvoll sind, dass kaum jemand sich länger damit aufhalten will, und einen bebrillten, bescheidenen Meeresbiologen als Kaiser, der offiziell als Sonnengott und direkter Nachfahre von Amaterasu verehrt wurde – bis er in einer Radiosendung verkündete, dass er auch nur ein Mensch sei. Die amerikanischen Kulturwissenschaftler, die den ersten Entwurf dieser Rede verfassten, hatten die Anweisung, sie in Sprache und Form so japanisch wie nur möglich zu gestalten.
Aber spielt es denn eine Rolle, wie Demokratien entstehen, wenn sie anschließend gedeihen? Achtzig Jahre später ist Japan immer noch ein demokratisches Land, das im Vergleich mit anderen nicht schlecht abschneidet: 2022 befand sich Japan auf Platz 16 des Demokratieindex, vier Punkte hinter Kanada und 14 vor den Vereinigten Staaten, die deutlich weiter unten auf der Liste unter der Überschrift »Unvollständige Demokratien« auftauchten.4 In den vergangenen Jahren hat Japan seine Position weiter verbessert. Wenn ich heute mein Heimatland besuche und durch Tokio schlendere, fühlt sich das öffentliche Leben sehr viel entspannter an als früher. Die Menschen sehen weniger abgespannt und müde aus als noch vor einem Jahrzehnt, sie hasten nicht mehr so eilig durch die Straßen und die überfüllten Bahnhöfe. Mittlerweile werden Menschen von allen Kontinenten in Japan herzlich aufgenommen. Im Fernsehen sehe ich, wie Politikerinnen aus konkurrierenden Parteien zur Zusammenarbeit aufrufen, um mehr Frauen in die Regierung zu bringen. Der Fortschritt scheint im Gang zu sein.
Wenn man sich die außerordentlichen Veränderungen anschaut, was das Bauwesen, das Bruttonationaleinkommen und die Lebensqualität angeht, scheint Japan die strittige These zu bestätigen, dass aus etwas Schlechtem, sogar Schrecklichem doch noch etwas Gutes entstehen kann. 1951, sechs Jahre nach dem Abwurf der Atombomben, verabschiedete meine Mutter sich von ihrer geliebten Familie in Louisiana und reiste nach Nagasaki, wo sie vier Jahre lang Englisch an einer Mädchenschule unterrichtete, die auf einer steilen Klippe direkt über dem Meer lag. Die Grundmauern des roten Backsteingebäudes waren wundersamerweise unversehrt geblieben, während der Schulbau auf der gegenüberliegenden Straßenseite komplett zerstört worden war.
Meine Mutter hatte ihr Waldhorn mit über den Ozean gebracht und spielte gelegentlich mit dem Nagasaki-Stadtorchester. Westliche Musik war während des Kriegs verpönt gewesen, doch der Dirigent hatte Partituren von Mozart, Haydn und Beethoven versteckt. Das Orchester konnte eine Hornistin gut gebrauchen, denn die Blasinstrumente der Einwohner waren alle konfisziert und eingeschmolzen worden, vor allem um Munition zu fertigen, aber auch Zahnplomben und Brillengestelle. Schon bald nach ihrer Ankunft machten ihre Schülerinnen sie darauf aufmerksam, dass ihre bunt gestreiften und gepunkteten Kleider zu viel Aufsehen erregten, inmitten all dem nüchternen Weiß, Dunkelblau und Grau, das die Einwohner von Nagasaki üblicherweise trugen. Nur an den Festtagen holten die Frauen ihre Kimonos hervor, die mit Lotusblumen, Schmetterlingen, langhalsigen Kranichen oder sich überschneidenden Halbkreisen gemustert waren, die die endlosen Meereswellen darstellten.
Fünfzig Jahre später luden diese ehemaligen Schülerinnen meine Mutter und mich zu einem mehrgängigen Abendessen im eleganten Ginza-Viertel von Tokio ein. Wir knieten auf seidenen zabuton-Kissen, meine Mutter trug ihre übliche schwarze Polyesterhose, während ihre wohlfrisierten Schülerinnen aus Nagasaki Designerkleidung in allen Farben des Regenbogens präsentierten. Die Frauen und ihre Familien hatten es in der japanischen Nachkriegsdemokratie unter dem Schutz des amerikanischen Nuklearschirms zu Wohlstand gebracht. Sie waren zwar nicht reich, doch ihr Lebensstandard lag höher als der meiner Mutter, die von ihrer Lehrerpension lebte.
»Den Japanern geht es heute besser als den Amerikanern!«, entfuhr es ihr. Sie meinte damit nicht nur die Kleidung oder die offensichtlich gut gefüllten Bankkonten ihrer Freundinnen. In Japan haben weitaus mehr Menschen Zugang zu bezahlbarer medizinischer Versorgung als in Amerika, und ihre Arbeitsplätze sind nicht gefährdet. Sie fühlen sich sicherer, auf der Straße und zu Hause. Und es gibt weniger Ungleichheit. Selbst heute, in den frühen 2020er-Jahren, in denen die ökonomische Ungleichheit in vielen Demokratien immer mehr zunimmt, fällt der Abstand zwischen den Reichsten und den Ärmsten in Japan vergleichsweise gering aus.5 Meine Mutter verspürte einen Anflug von natsukashii – ein wunderbarer japanischer Begriff, der so viel wie »Nostalgie« oder »leichtes Heimweh« bedeutet – für das Land, in dem sie dreißig Jahre lang gelebt hatte. Durch den Krieg war Japan dazu gezwungen, eine Demokratie zu werden, doch das brachte den Menschen auch ökonomische Sicherheit und politische Stabilität.
In meinem japanischen Kindergarten hörten wir keine Schöpfungsmythen, sondern Geschichten von Gespenstern und halb toten Geistern und Kreaturen wie den obake, den Formwandlern. Es waren alte Sagen, doch ihre neuen geisterhaften Inkarnationen fanden sich überall: in den Cartoons für Kinder, die meine Schwester und ich uns im Fernsehen ansahen, in den klaffenden Lücken zwischen den Gebäuden, die sich während der 1960er- und 1970er-Jahre in Tokio ständig neu formierten, in den Gesichtern von Kriegsveteranen, die vor den Warenhäusern hockten oder an unsere Haustür kamen, um höflich um ein paar Münzen zu bitten, ihre Beinstümpfe in feuchte Lumpen gewickelt. Die Kindersendungen, die ich mir anschaute, waren voller Superhelden mit vage westlich klingenden Namen wie Ultraman, ausgesprochen »U-ru-tora-man«, Kampfmonstern, deren Feuer speiende Augen Zigtausende Tokioter (oder New Yorker) Hochhäuser in Schutt und Asche legen konnten. Solche Szenen urbaner Zerstörung verschafften mir Albträume.
Als die Wirtschaft in den 1960er-Jahren im Aufschwung war, erkannten findige japanische Marketingstrategen, dass die Menschen nach den düsteren und arbeitsamen Nachkriegsjahren dringend eine Aufmunterung brauchten. Mit der unerwarteten Unterstützung ihres Erzfeindes China ersannen sie eine Form des Eskapismus, der das ganze Land in einer warmen Umarmung zusammenbrachte, ganz ohne irgendwelche Mythen oder Götter bemühen zu müssen. Um die Entspannungsphase zwischen den beiden Nationen zu feiern, übersandte China seinem Nachbarn 1972 ein Geschenk: ein knuddeliges Pandapärchen namens Lan Lan und Kang Kang. Ganz Japan geriet außer sich vor Verzückung. Panda-Artikel überschwemmten die Läden, Straßen und Züge. Kinder und Erwachsene trugen stolz Panda-T-Shirts, Hüte und Rucksäcke; unzählige pelzige Mini-Pandas trudelten an Schlüsselringen durch das ganze Land. Kawaii! (»So süß!«) wurde zum Wort des Jahres.
Als Zehnjähriger lag mir mehr daran, cool zu wirken, als dass ich mich mit einem Panda-Anhänger hätte erwischen lassen. »Wieso sind alle so verrückt nach Pandas?«, fragte ich meine Mutter.
»Die Menschen arbeiten wirklich schwer«, antwortete sie. »Und der Krieg war eine furchtbare Zeit für sie. Vielleicht ist es einfach eine Erleichterung, sich zur Abwechslung mal mit etwas Hübschem wie Pandas zu beschäftigen.«
Die Pandamanie war also so etwas wie ein kollektives Hoffnungszeichen, dass die benachbarten Nuklearmächte endlich ein etwas weniger unfreundliches Gesicht zeigen würden. Mit Friedensbestrebungen und dem Wunsch, die Vergangenheit hinter sich zu lassen, erfanden sich die überarbeiteten, autoritätshörigen Japaner neu – als das verspielteste, unschuldigste, womöglich sogar liebenswerteste Volk der Welt. Was konnte daran schlecht sein? Wenige Jahre später verbreitete sich Kawaii weltweit mit Hello Kitty und siehe da! – Japan hatte ein neues nationales Markenzeichen. Wer braucht noch Mythen über inzestuöse Göttinnen, wenn man sein Land auf so eine fröhliche, moderne, weltoffene und lukrative Weise neu erfinden kann? Warum an die traurige Geschichte denken, wie die Demokratie nach Japan kam, und daran, welche Gräuel dieses mittlerweile so kriegsscheue Land unter seinen Nachbarn angerichtet hatte? Lasst uns einfach nach vorne schauen und die Vergangenheit vergessen. Schwärende Wunden mit einem Panda-Pflaster abzukleben, könnte tatsächlich dazu beigetragen haben, einige von ihnen zu heilen.
Doch das Leben im Nachkriegsjapan hatte mich gelehrt, dass es keine einfache Methode gibt, um zu ermitteln, wie stark oder schwach eine Demokratie ist. Als ich aufwuchs, hieß es immer, das demokratische, kapitalistische Japan sei tatsächlich ein Ein-Parteien-Staat. 2022, während ich dies schreibe, ist die konservative Liberaldemokratische Partei (LDP) seit 1955 an der Macht, mit nur zwei kurzen Unterbrechungen von 1993–1994 und von 2009–2012. Die Parteifunktionäre haben enge, vornehmlich männliche Netzwerke untereinander und mit den großen Unternehmen etabliert. Während des Kalten Krieges waren amerikanische Verbündete durchaus gewillt, ein gewisses Maß an Korruption und Autoritarismus zu ignorieren, wenn sich damit linke Elemente kleinhalten ließen. Der Prozentsatz weiblicher Abgeordneter im japanischen Parlament beträgt rund 10 Prozent. Die japanische Demokratie könnte schwächer sein, als es den Anschein hat.
Die Geburtsstunde der japanischen Demokratie – von einer ausländischen Atommacht initiiert, in einer Region, in der die nukleare Bedrohung auch heute noch sehr lebendig ist – hat Spuren hinterlassen, die nicht so bald verblassen werden. Artikel 9 der von den USA vorgegebenen Verfassung untersagt es Japan, Streitkräfte aufzubauen, mit denen es ein anderes Land angreifen könnte; damit ist es auf die Vereinigten Staaten und ihre Atomwaffen angewiesen. Im Land herrscht eine unterschwellige Nervosität, an die man sich gewöhnt, aber die man nie ganz vergisst, ähnlich wie die leichten Erdstöße, die man dort beinahe jeden Tag spüren kann. Man darf sich nicht vorstellen, dass sie sich zu einem katastrophalen Erdbeben der Stufe 7,5+ entwickeln könnten, sonst wäre das Leben unerträglich. Doch man lernt von Kindesbeinen an, dass sich das Schlimmste jederzeit wieder ereignen kann.
Die Zeit hat derartige Befürchtungen nicht gemildert. Jeden Sommer, wenn in Japan der Bombardierung von Hiroshima und Nagasaki gedacht wird, werden aus China sowie Nord- und Südkorea aggressive Forderungen laut, dass Japan sich für seine Kriegsverbrechen gegen Zivilisten, Kriegsgefangene und die sogenannten Trostfrauen, die den japanischen Soldaten während des Zweiten Weltkriegs als Sex-Sklavinnen dienten, offiziell entschuldigen solle. Meine japanischen Freunde wünschen sich, dass ihre Regierung endlich einlenkt und sich für die Missetaten ihrer undemokratischen Vorgänger entschuldigt, wie es die Deutschen bereits seit Jahrzehnten tun, und sich aufrichtig mit der Vergangenheit auseinandersetzt. Dem auszuweichen, weil man schwach wirken könnte, lässt einen erst recht so wirken.
Jahrzehnte nach der Pandadiplomatie und dem weltweiten Siegeszug von Hello Kitty machen sich die Japaner hinter ihrer unerschütterlichen Fassade noch immer Sorgen: Wer wird für uns kämpfen, wenn wir als die treuesten Alliierten der Vereinigten Staaten in einen dritten Weltkrieg mit unseren Nachbarn Nordkorea, China und Russland hineingezogen werden?
Also spielt es doch eine Rolle, wie eine Demokratie geboren wird. Und im Fall einer auferlegten Demokratie wie in Japan hinterlässt diese Geburt nicht nur sichtbare Spuren an der neuen Demokratie, sondern auch an der älteren, die dafür verantwortlich ist. Wenn in der ersten Selbstzweifel und Ängste über eine zu große Abhängigkeit von einer fremden Macht aufkommen, kann in der zweiten ein unverhältnismäßiger Eindruck von der eigenen Stärke entstehen, die als Ausdruck natürlicher oder gottgegebener Tugendhaftigkeit gesehen wird. Die alten Griechen nannten dies hybris: eine gefährlich unrealistische Einschätzung der eigenen Stärken und Ansprüche. Wer der Hybris verfällt, muss erst mit der Realität kollidieren, um zu begreifen, dass der eigenen Macht Grenzen gesetzt sind – vor allem durch andere Menschen, die zwar schwächer als man selbst sein mögen, aber sich dennoch nicht unterwerfen wollen.
Hinter dem Zweiten Weltkrieg verbirgt sich eine längere Geschichte, die die Anfänge der Demokratie in Japan noch komplizierter macht. 1853 lief der US-Admiral Matthew Perry mit wehender Stars-and-Stripes-Fahne in die Bucht von Tokio ein. Wie sich ein bekannter japanischer Autor zwei Jahrzehnte später erinnerte, lautete Perrys Botschaft: »Öffnet eure Häfen für uns, Herrscher und Bürger von Japan! Schließt euch dem freien Handel und der Gemeinschaft der Menschheit an! Wenn ihr uns abweist und euch weigert, Geschäfte mit uns zu machen, dann versündigt ihr euch gegen Gott.«6 In Japan wusste man, was das tatsächlich bedeutete: »Wir haben Kanonen, und wenn ihr nicht tut, was wir wollen, dann benutzen wir sie auch.« Zehn Jahre zuvor hatten die Briten einen Krieg gegen China angezettelt, als der Kaiser versuchte, den florierenden Opiumhandel zu unterbinden. Auf der ganzen Welt wurden die westlichen Großmächte immer aggressiver, sie setzten Kriegsschiffe und Waffen ein, um andere Völker dazu zu zwingen, unter den von ihnen festgelegten Bedingungen in den Freihandel einzutreten. Der japanische Herrscher gab Perrys Aufforderung nach.
Der Autor, Yukichi Fukuzawa, war gebildet und hatte die Welt bereist. Er fand, Japan solle eine Demokratie nach westlichem Vorbild werden und am Fortschritt, wie ihn der Westen definierte, teilhaben. Dennoch bestand er darauf, dass die Menschen über ihr eigenes Schicksal bestimmen und deshalb sicherstellen sollten, dass sie selbst das Ruder in der Hand behielten, um Japan in den breiten Fluss liberaler westlicher Demokratien zu steuern. Diese Eigenständigkeit war entscheidend, denn jedes autonome Volk braucht vor allem eines: Selbstachtung. Wenn es daran fehlt, breiten sich Ängste und Ressentiments aus. Ängste und Ressentiments wiederum öffnen der Tyrannei Tür und Tor. Also sollte sowohl Japan als auch seine neuen (erdrückend dominanten) westlichen Partner begreifen, »wie bösartig, abscheulich, empörend und schmerzvoll ein Ungleichgewicht der Kräfte ist«.7 Selbst dann, wenn der Mächtigere seine Überlegenheit gelegentlich dazu einsetzt, um einem zu helfen.
Der griechische Geschichtsschreiber Herodot schildert die erstaunliche Hybris des persischen Despoten Xerxes, der seine eigenen Kräfte derart überschätzt, dass er den Versuch wagt, ganz Griechenland zu erobern, und dabei auf erbitterten Widerstand trifft. Doch selbst die Befürworter der Demokratie – wie Herodot – waren sich im Klaren darüber, dass Tyrannen und Despoten nicht die Einzigen sind, die der Hybris verfallen können. Auch in funktionierenden Demokratien kann es passieren, dass das Verlangen Einzelner nach Macht, Reichtum, Ansehen und Freiheit außer Kontrolle gerät. Und eines der deutlichsten Anzeichen für Hybris ist die Überzeugung, dass man selbst oder die eigene Demokratie dagegen immun sei. Immer wieder in der Geschichte vom antiken Athen und Rom bis heute hat die Illusion, dass eine gute Demokratie vor Hybris gefeit sei, großen Schaden angerichtet.
4https://ourworldindata.org/grapher/democracy-index-eiu
5https://japan-forward.com/where-to-live-for-a-better-chance-at-income-equality-try-japan/
6 Yukichi Fukuzawa, An Outline of a Theory of Civilization (Bunmeiron no gairyaku), übers. v. David A. Dilworth und G. Cameron Hurst (Tokio, 1970 [1848]).
7 Ebd., S. 183, 188-9.
2.
Sind Demokratie und Tyrannei Gegensätze?
Häufig wird gesagt, Demokratie sei das Gegenteil von Tyrannei. Demokratie ist die Herrschaft der vielen. Tyrannei ist die Herrschaft einer Person oder einer alles kontrollierenden Partei. Die Demokratie ermöglicht es Menschen unterschiedlicher regionaler, ökonomischer und ethnischer Herkunft, an der Macht teilzuhaben und kleine und große Entscheidungen gemeinsam zu treffen, auch wenn sie leidenschaftliche Überzeugungen haben und nicht immer einer Meinung darüber sind, wie mehr Wohlstand und ein freieres, sichereres und besseres Leben erzielt werden können. In einer Tyrannei wird die politische Macht von einer Person oder Partei vereinnahmt, was alle anderen von der Pflicht entbindet, zeitraubende und ermüdende Debatten zu führen und Kompromisse zu suchen. Demokratien haben Gesetze, Gerichte, Polizei- und Streitkräfte, die alle gleichermaßen schützen sollen, unabhängig davon, wer sie sind oder wen sie gewählt haben. In einer Tyrannei dienen diese Institutionen dazu, das Machtmonopol des Herrschers zu erhalten.
Das habe ich als Kind des Kalten Krieges gelernt. Demokratie und Tyrannei sind Erzfeinde, und die Unterschiede waren klar umrissen. In Japan, wo ich geboren wurde, hatten wir eine Demokratie. Ebenso in Amerika, im westlichen Teil Europas und in einigen anderen Ländern, die über den Globus verstreut lagen. Tyrannei herrschte in den meisten Nachbarländern von Japan, in Ein-Parteien-Staaten wie der Sowjetunion, China und Nordkorea.
Wir hatten Glück gehabt.
Was man uns nicht gesagt hatte, war: Auch in einer Demokratie können sich tyrannische Impulse ausbreiten, unabhängig davon, wie stark ihre Institutionen oder wie freiheitlich ihre Anschauungen sind. Und das betrifft nicht nur eine Handvoll autoritärer Charaktere, die die Macht an sich reißen wollen. In bedrohlichen oder angespannten Situationen werden sich viele Menschen dabei ertappen, nach der totalen Kontrolle oder dem Sicherheitsversprechen zu verlangen, das die Tyrannei anbietet. Und derartige Sehnsüchte können uns derart verwirren, dass wir nicht mehr wissen, warum wir uns die mühevolle Arbeit der demokratischen Teilhabe überhaupt aufbürden sollen.
Vom Gegensatz zwischen Tyrannei und Demokratie hörte ich das erste Mal in meiner englischen Schule in Tokio. Tyrannei war etwas, das unglücklichen, widerstrebenden Menschen aufgezwungen wurde. Die moderne Demokratie wurde geboren, als die Massen sich erhoben und den Tyrannen zeigten, dass sie sich nicht mehr unterdrücken ließen und sich selbst am besten regieren können. 1776 revoltierten die Britischen Kolonien in Amerika gegen oppressive Monarchen und sicherten sich mehr Freiheiten, als es jemals zuvor auf der Welt gegeben hatte. Es gab Helden wie den unvergleichlichen und untadeligen George Washington, Offizier und Gentleman, und Thomas Jefferson, der wunderbare Prosa verfasste, eine romantische Seele hatte, eine Sklavin namens Sally Hemings liebte, die ihm sechs Kinder gebar und der er dennoch nicht die Freiheit schenkte. Diese Männer und viele andere verdienten sich Ruhm, indem sie sich der Tyrannei von Monarchen und der Britischen East India Company widersetzten – einem riesigen, rasch wachsenden Handelsimperium, dessen Interessen der Regierung in London weitaus mehr am Herzen lagen als das Wohl und die Wünsche der Kolonisten. Die Rebellen zogen in den Krieg und schufen das freie Amerika, ganz nach Jeffersons Devise:
Wir halten diese Wahrheiten für selbstverständlich: dass alle Menschen gleich geschaffen sind; dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten ausgestattet sind; dass dazu Leben, Freiheit und das Streben nach Glück gehören.
Die Amerikanische Revolution befeuerte einen weiteren großen Aufstand in Frankreich, wo die Bürger und Bauern 1789 einen langen, schweren Kampf für Liberté, Égalité, Fraternité gegen ihren absolutistischen König und die schmarotzende Aristokratie ausfochten.
Das Rezept für eine beispielhafte Demokratie schien wunderbar einfach zu sein. Es gab zwei Seiten, gänzlich ungleich in Status, militärischer Stärke und Finanzkraft: die Underdogs und die übermächtigen Giganten, David gegen Goliath. Könige und ihre aristokratischen Nutznießer standen bescheidenen Rebellen gegenüber, welche sich nicht länger als Untergebene behandeln lassen wollten, die die schwere Arbeit erledigten und Steuerabgaben zahlten. Sie wollten mitreden. Sie wollten Respekt. Sie wollten eine Chance, um der Armut zu entkommen. Sich von der Tyrannei zu befreien, hieß auch, andere als gleichwertig zu behandeln. Selbst ein Mann wie Abraham Lincoln, der in einer ärmlichen Holzhütte in Kentucky geboren wurde, konnte Präsident der Vereinigten Staaten werden.
Als wir älter wurden, bekamen wir eine etwas kompliziertere Version der Geschichte zu hören. Nach dem amerikanischen Bürgerkrieg existierten Sklaverei und Rassendiskriminierung weiterhin, selbst nachdem der Handel mit Menschen offiziell verboten worden war. Frauen mussten noch lange auf das Wahlrecht warten. Dennoch, sagten unsere Schulbücher aus der Ära des Kalten Kriegs, seien selbst Demokratien, in denen eklatante Ungleichheit herrscht, gegen die Tyrannei. Sie stünden für Freiheit und beschützten sie gegen despotische Alleinherrscher, Kommunisten und Faschisten. Das sei eine beachtliche Leistung. Und schließlich sei der Fortschritt bereits in vollem Gange, die Bürgerrechtsbewegung setze sich für Rassengleichheit ein, Frauen verlangten Zugang zu Verhütungsmitteln und das Recht auf Geburtenkontrolle. Die beiden großen Versprechen der Demokratie, Freiheit von der Tyrannei und Gleichberechtigung, seien bereits zum Greifen nah.
Ich wuchs in dem Glauben auf, dass eine lange Ära autokratischer Unterdrückung sowie moderne Methoden der Gehirnwäsche Völker wie die Sowjetunion und China hervorgebracht hätten, die mit uns, den Bewohnern der freien Welt, nichts gemein hatten. Sie waren autoritätshörig – wir nicht. Wir waren freiheitsliebend und sahen uns und andere als gleichwertig an. Doch stimmte das überhaupt? Waren wir tatsächlich so anders als unsere Feinde hinter dem Eisernen Vorhang? Wenn ich mir heute alte und neuere Demokratien in der ganzen Welt anschaue, klingt die Parole vom Fortschritt immer so, als könne die Kluft zwischen den demokratischen Idealen und der Realität schließlich doch noch überwunden werden. Aber was, wenn nicht? Was, wenn die meisten Menschen in Demokratien weitaus ambivalenter über Gleichheit denken, als unsere Parolen und Verfassungen es uns vorgaukeln? Und was, wenn kein freiheitsliebendes Volk jemals völlig immun dagegen ist, den dunklen Verlockungen der Tyrannei nachzugeben? Einer Macht, die weitaus größer ist als »Wir, das Volk«, und dazu in der Lage, Menschen zu überwachen und sie dazu zu zwingen, ihre subversiven oder unmoralischen Handlungen aufzugeben oder innere und äußere Feinde einfach auszuradieren?
Kürzlich habe ich eine ganz andere Entstehungsgeschichte wiederentdeckt, die genau diese Frage stellt. Wiederentdeckt, weil ich sie bereits mit sechzehn Jahren gehört habe, aber sie erst viele Jahrzehnte später mit der Welt um mich herum in Beziehung setzen konnte. Nachdem wir nach England umgezogen waren, begann ich, Altgriechisch zu lernen, bei einer sehr ungewöhnlichen Lehrerin. Ihr Körper, der in einem sackartigen Kittel steckte, hätte viel besser in einen chiton gepasst. Carolas Augen glänzten nostalgisch, wenn sie Passagen aus Homer rezitierte, als sei sie eine Göttin, die aus dem Olymp vertrieben wurde und in Letchworth gestrandet war, um mir und meiner Freundin Claire – wir waren die einzigen Schülerinnen, die Altgriechisch belegt hatten – vom Zorn des Achill zu singen. Eines schönen Tages stieg unsere Lehrerin mit uns in den Zug nach London und entführte uns in ihre geistige Heimat, indem sie uns die von den Engländern geraubten Parthenonfriese und Marmorstatuen im British Museum zeigte. Die bemalten rot-schwarzen Keramikgefäße erzählten Geschichten von Göttern und Göttinnen, Giganten und Menschen, deren Kämpfe das Fundament für die erste Demokratie der Welt gelegt hatten. Der berühmte Gründer Athens war Theseus, Sohn einer Sterblichen und des Meeresgottes Poseidon. Ein Held, der mit unglaublicher Energie gesegnet war, immer in Bewegung und auf der Suche nach öffentlicher Anerkennung – manche nennen ihn einen dēmagogos – daher stammt unser Begriff »Demagoge«. Er war unablässig damit beschäftigt, jemanden oder etwas zu unterwerfen; den rasenden Stier von Marathon, den Minotaurus und eine ganze Kollektion von Jungfrauen, unter ihnen auch ein Mädchen namens Helena, das später als Helena von Troja berühmt wurde.8
Diese Vergewaltigung eines jungen Mädchens, das noch ein halbes Kind war, verschaffte Theseus bei den griechischen Dichtern den Ruf eines Wüstlings. Doch der Tyrann Peisistratos ließ diese kritischen Verse später vernichten, um die Athener nicht zu brüskieren. Viele unter ihnen hatten den hyperaktiven Helden als Leitfigur und Vorbild für ihre eigenen Unternehmungen auserkoren, besonders wenn es darum ging, andere griechische Provinzen zu unterwerfen und ihrem Reich hinzuzufügen.
Die Vorliebe der Athener für Theseus ist umso bemerkenswerter, weil die Methoden, mit denen er die Demokratie begründete, sich auf sie besonders unangenehm auswirkten. Um sie zu einem Volk und einer Polis zu einen, ließ er alle alten Rathäuser und Verwaltungsgebäude in ihren Dörfern abreißen. Die Dorfbewohner hatten solche Angst vor Theseus’ selbstbewusstem Auftreten, sie waren so eingeschüchtert von seiner Rücksichtslosigkeit, dass sie nicht darum kämpften, ihre alten Tagungsstätten und andere lokale Institutionen zu behalten. Die Legende besagt, es sei Theseus gewesen, der auf der Akropolis ein einzelnes Rathaus erbaut und die Stadt nach der Göttin Athene benannt habe.9
So unbequem seine Methoden auch waren, die Gründung erwies sich als vorteilhaft für die Männer, die den Weg für die Demokratie bereiteten (auch wenn sie es noch nicht wussten). Denn somit konnten die Athener die Truppen leicht aufbringen, die sie brauchten, um die Amazonen zu besiegen – Horden kampflustiger, bewaffneter Frauen, die sich über ganz Osteuropa und Westasien ausgebreitet hatten. Diese Kriegerinnen attackierten die Athener mit Wucht, nachdem Theseus Antiope, die Schwester der Amazonenkönigin Hippolyte, geraubt und zur Ehe gezwungen hatte. Und noch Jahrhunderte später, nachdem die Athener eine breit angelegte Volksversammlung sowie andere demokratische Institutionen geschaffen hatten, zierten Darstellungen von Theseus’ Sieg über die Amazonen unzählige Amphoren – Tongefäße, die in griechischen Haushalten zur Aufbewahrung von Wein, Olivenöl und Getreide verwendet wurden.
Als ich diese Geschichten zum ersten Mal hörte, verstand ich sie noch nicht. Sie schienen nur eine Sammlung fantastischer Mythen zu sein, ebenso plausibel wie die Sendungen, die ich als Kind im japanischen Fernsehen angeschaut hatte, in denen menschengroße Superhelden gigantischen Monstern in den Straßen von Tokio den Garaus machten. Heute weiß ich, dass Gründungsmythen die Schlüssel sind zu all den Fantasien und Albträumen, die die Demokratien allerorts noch immer heimsuchen. Die Geschichten von Theseus verdeutlichen nicht nur, wie viel Unaufrichtigkeit, Vertuschung und Beschönigung sich in den Gründungsmythen der Demokratie finden, sondern auch, wie viele unterdrückte Wahrheiten sie enthalten. Denn solche Geschichten, voller wilder Fantasien über die Unterwerfung anderer unter den eigenen Willen, enthüllen sehr viel darüber, was die Menschen von ihren Anführern erwarten.





























