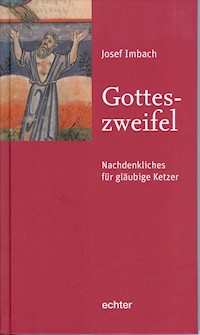8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Gütersloher Verlagshaus
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2011
Die christliche Erlösungslehre auf dem Prüfstand
- Eine kritische Neudeutung, in der die Erlösung ein Versprechen und keine Drohung mehr ist
Gott, der Vater, opfert Jesus, seinen Sohn, damit sein Zorn gegen die Menschen besänftigt werde – was wie mittelalterliche Ideologie klingt, ist offizielle Theologie der Kirchen. Bei jeder Abendmahls- oder Eucharistiefeier wird des »Opfers« Jesu gedacht: »Gestorben für unsere Sünden«.
Einer solchen »Opfertheologie« stehen heute viele Gläubige skeptisch gegenüber. Die Vorstellung, dass Gott seine Zuwendung zum Menschen von Verzicht, Sühne und Kasteiungen abhängig macht, ist ihnen unerträglich.
Josef Imbach nimmt diese Kritik ernst. Er greift die bestimmenden Merkmale der hergebrachten Erlösungslehre auf und deutet sie neu. So erschließt er ein Verständnis von Erlösung, das keinerlei Drohungen, dafür aber eine Verheißung beinhaltet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 339
Ähnliche
Gütersloher Verlagshaus. Dem Leben vertrauen
Inhaltsverzeichnis
Eine Art Vorwortoder:
Kein Lob des Opfers und kein Preis dem Tod!
Seit er meinen Bruder kreuzigen ließ, um sich mit mir zu versöhnen, weiß ich, was ich von meinem Vater zu halten habe. 1
Im Mittelpunkt von Ulrich Schaffers Roman Die Verbrennung steht eine nachdenkliche junge Frau namens Eva-Marie [!]. Irgendwann wirft die ihre Bibel ins Feuer. Warum sie das tut, sagt sie ihrem Gott, zu dem sie nach langem Suchen hingefunden hat: »Lange hattest du keine Chance gegen den Gott der Bibel, der in mir ist, dorthin platziert von den Worten, Hand-lungen und Gesten derer, die meinten, für mich glauben zu müssen. Ich laste es ihnen nicht an. Sie haben ihren Glauben so verstanden und darum auch so gelebt.«2 Zu welchem Gott Eva-Marie früher gebetet hat, beschreibt sie in einem Brief an ihren verstorbenen Vater, der ein strenggläubiger Pfarrer war:
Du hattest doch immer so schnell Gott auf deiner Seite, und gegen euch beide waren wir nichts. Wenn du gewusst hättest, wie finster Gott dadurch damals in meinem Herzen geworden ist, aber ich konnte es dir nicht sagen, dafür hatte ich den Überblick nicht. […] Du hast uns mit einem heiligen Gott erzogen, einem Gott, der keinen Ungehorsam duldet, der jede Sünde sieht. Das hat sich mir ganz tief eingeprägt. […]
Einen letzten Gedanken möchte ich noch loswerden. Ich rede von der Frage der Schuld. Für dich war Schuld etwas ganz Wichtiges. Wenn etwas nicht stimmte, hatte jemand Schuld. Der Schuldige musste gefunden werden. Es musste um Vergebung gebeten werden. Es musste bereinigt werden. Schuld, Schuld, Schuld.
Bis heute verfolgt mich diese Frage. Ich will nicht so tun, als gäbe es keine Schuld, will mich weder damals noch heute als schuldlos darstellen. Aber musste die Schuld so im Zentrum stehen, dass wir Kinder manchmal an nichts anderes denken konnten als an unsere Schuld? Und das hörte ja nicht bei uns auf. Vor Gott waren wir immer schuldig, auch für Dinge, die wir nicht wussten. Wir mussten darum auch für unsere unbekannten Sünden um Vergebung bitten. Nie haben wir genügt. Und daran arbeite ich bis heute noch. Ich bin nicht gut genug. Ich leiste nicht genug. Ich mache zu viele Fehler. Ich liebe nicht genug. Nicht genug. Nicht genug. Ungenügend. Vater, weißt du, wie dunkel das Leben dann aussieht? Was für einen unerbittlichen, grausamen, fordernden Gott hast du uns vorgestellt! Und dann hast du uns befohlen, ihn zu lieben. Und natürlich konnten wir auch das wieder nicht genug. Es gab kein Ende.
In der Tat, es gibt kein Ende – zumindest nicht im Rahmen einer Straf- und Opfertheologie, wie sie hier zum Ausdruck kommt. Die führt allenfalls dazu, dass Menschen unter Gottes drohenden Augen und seinem strafenden Blick seelisch verkümmern und psychisch zerbrechen.
Einen Gott, der stets nur fordert und den es nach immer neuen Entsagungen und Abtötungen seitens des Menschen verlangt, kann man nicht lieben, sondern bloß fürchten. Weil aber der Maßstab der Selbsthingabe und Selbstaufopferung nach oben hin offen ist, hat man ständig den Eindruck, nicht genug getan zu haben.
Entsprechende Erfahrungen reichen oft ganz tief hinab, bis in die Kindheit. Manche werden sich daran erinnern, wie sie während der Adventszeit angehalten wurden, aus Liebe zum Jesuskind auf ihre Lieblingsbeschäftigungen oder auf Süßigkeiten zu verzichten oder irgendwelche besondere Leistungen zu erbringen. Jedes Mal, wenn sie ein ›Öpferchen‹ gebracht hatten, durften sie einen Strohhalm in die Krippe legen, damit das Christuskind am Weihnachtsabend weich genug liegen konnte. Hat man den Kindern aber auch vermittelt, dass Beherrschung und Überwindung nur dann sinnvoll sind, wenn sie der Stärkung ihres Charakters dienen oder aber anderen zugute kommen? Oder wurde da vielleicht Verzicht nur um des Verzichtes willen gepredigt?
Noch immer sind viele Gläubige davon überzeugt, dass man sich den Himmel verdienen kann – oder muss. Und wie verdient man sich den Himmel? Durch Gebet, Leiden und Entbehrungen und durch gute Werke! Also durch Opfer. Praktisch läuft das darauf hinaus, dass der Mensch sich Gottes Zuwendung und Liebe durch Wohlverhalten erwirbt. Aber muss (oder kann!) man sich Gottes Zuwendung tatsächlich erarbeiten? Steht eine solche Glaubenspraxis nicht in einem eklatanten Widerspruch zur neutestamentlichen Rechtfertigungslehre? Angehörige der römisch-katholischen Kirche, welche befürchten, dass alles Büßen und Sühnen, dass tagelange Abtötungen oder über Monate hin praktizierte Askese noch immer nicht ausreichen würden, um ihre Sündenschuld tilgen und Gott gnädig zu stimmen, haben auch heute noch die Möglichkeit, Ablässe zu gewinnen und sich so von den zu im Jenseits zu erwartenden Folterqualen freizukaufen. Die Frage ist dann bloß, ob Gott sich an das hält, was die Kirchenoberen in seinem Namen versprechen.
Sühne, Leiden, Opfer und Blut – das sind die Schlüsselbegriffe, welche in der christlichen Erlösungslehre seit Jahrhunderten verwendet werden und mittels derer manche Prediger ihre eigene theologische Hilflosigkeit verbrämen, beispielsweise indem sie lauthals verkünden, dass Jesus die Menschheit durch sein »Leiden«, durch sein »kostbares Blut« und durch sein »Kreuzesopfer« »erlöst« hat. Was wiederum dazu führte, dass Jesu Tod oft geradezu verherrlicht wurde! Hat Gott sich vielleicht über Jesu Tod gefreut? Ist Jesus selber begeistert in den Tod gegangen? Hat er nicht vielmehr den ›Vater‹ im Ölgarten gebeten, ihm den Leidenskelch zu ersparen? Wie aber kommen römisch-katholische Christusnachfolger und Jesusjüngerinnen dann dazu, während der Eucharistiefeier nach dem Einsetzungsbericht einen Preisgesang auf Jesu Tod anzustimmen (»Wir preisen deinen Tod. Wir glauben, dass du lebst. Wir hoffen, dass du kommst zum Heil der Welt.«)? Halbwegs erträglich ist diese im Grunde makabere Todespreisung nur deshalb, weil der Text von einer sentimentalen Melodie umrahmt wird – oder weil sich die Anwesenden beim Absingen nichts dabei denken. In der offiziellen römisch-katholischen Liturgie hingegen heißt es richtig und nachvollziehbar: »Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. « Wohl kommt der Rede vom erlösenden ›Sühnetod‹ Jesu im Christentum eine zentrale Bedeutung zu. Die Frage bleibt allerdings, ob es sich dabei um eine zeitlos gültige Glaubenswahrheit oder um ein zeitbedingtes Deutungsmodell handelt.
Und überhaupt: Was assoziieren die Gläubigen heute mit der Rede vom ›Erlösungstod‹ Jesu? Vermutlich gilt nach wie vor für viele, was die »schöne Seele«, eine tieffromme Dame, in Goethes Roman Wilhelm Meisters Lehrjahre diesbezüglich von sich bemerkt: »Es war mir eine Bibelwahrheit, dass das Blut Jesu Christi uns von allen Sünden reinige.« Doch plötzlich gibt sie sich Rechenschaft, dass sie »diesen so oft wiederholten Spruch noch nie verstanden« hat! 3
Begriffe wie Kreuzesopfer, Sühnetod oder Rechtfertigung stoßen zunehmend auf Unverständnis oder lösen Abwehrreaktionen aus. Aber auch andere Ausdrücke wie Erlösung, Heil oder Gnade sind inhaltsleer geworden, weil sie an den Realitäten abperlen wie die Regentropfen am Autolack. Deshalb ist es notwendig, die damit gemeinten Sachverhalte zu übersetzen und diesbezügliche Missverständnisse zu beheben. Dass dabei gerade die nach wie vor weitverbreitete ›Opfertheologie‹ nicht nur der Erläuterung, sondern auch einschneidender Korrekturen bedarf, versteht sich von selbst.
In diesem Buch werden die verschiedenen mit der Erlösungslehre verknüpften Themenbereiche so behandelt, dass jedes Kapitel eine Einheit darstellt. Das hat den Vorteil, dass alle mit der Lektüre bei jenen Fragen beginnen können, die sie besonders beschäftigen.
Theologie im Märchenoder:
Die Tragik der ›Opferseelen‹
Dass Märchen wahr sind, hat sich inzwischen fast überall herumgesprochen. Ähnlich wie die Mythen der Völker berichten sie von Dingen, die nie geschehen sind, und die sich doch täglich neu ereignen. »In ihnen gibt es Liebe, Hass, Treue und Verrat, Angst und Gottvertrauen, böse und gute Mächte wie im ›echten‹ Leben auch, und wie hier muss jede der geschilderten Gestalten sich mit diesen widerstreitenden Gefühlen, Eigenschaften, schicksalhaften Verstrickungen auseinandersetzen – einmal mit gutem, einmal mit schlimmem Ausgang, auch das wie im ›richtigen‹ Leben.«1
Für ein angemessenes Verständnis besonders der Volksmärchen erweist sich die Tiefenpsychologie als überaus hilfreich. Ihr verdanken wir unter anderem die Einsicht, dass in den alten Märchenerzählungen auch urtümliche, in der seelischen Struktur verankerte Bilder und Symbole ihren Ausdruck finden. C. G. Jung und seine Schule sprechen in diesem Zusammenhang von Archetypen. Wenn man mit Jung davon ausgeht, dass das Unbewusste von religiösen Inhalten mitgeprägt ist, wird man sich nicht wundern, dass zahlreiche Märchen auch religiös relevante Fragestellungen aufgreifen. Ein geradezu klassisches Beispiel dafür ist das in der grimmschen Sammlung enthaltene Märchen Das Mädchen ohne Hände, in welchem es letztlich um eine Thematik geht, die in den Religionen eine zentrale Rolle spielt, nämlich um Opfer und Gnade.2
Ein Müller war nach und nach in Armut geraten und hatte nichts mehr als seine Mühle und einen großen Apfelbaum dahinter. Einmal war er in den Wald gegangen, Holz zu holen, da trat ein alter Mann zu ihm, den er noch niemals gesehen hatte, und sprach: »Was quälst du dich mit Holzhacken, ich will dich reich machen, wenn du mir versprichst, was hinter deiner Mühle steht.« »Was kann da anders sein als mein Apfelbaum?«, dachte der Müller und sagte Ja und verschrieb es dem fremden Manne. Der aber lachte höhnisch und sagte: »Nach drei Jahren will ich kommen und abholen, was mir gehört«, und ging fort.
Als der Müller nach Hause kam, trat ihm seine Frau entgegen und sprach: »Sage mir, Müller, woher kommt der plötzliche Reichtum in unser Haus? Auf einmal sind alle Kisten und Kasten voll, kein Mensch hat’s hereingebracht, und ich weiß nicht, wie es zugegangen ist.« Er antwortete: »Das kommt von einem fremden Manne, der mir im Wald begegnet ist und mir große Schätze verheißen hat, ich habe ihm dagegen verschrieben, was hinter der Mühle steht; den großen Apfelbaum können wir wohl dafür geben.« »Ach, Mann«, sagte die Frau erschrocken, »das ist der Teufel gewesen; den Apfelbaum hat er nicht gemeint, sondern unsere Tochter, die stand hinter der Mühle und kehrte den Hof.«
Die Müllerstochter war ein schönes und frommes Mädchen und lebte die drei Jahre in Gottesfurcht und ohne Sünde. Als nun die Zeit herum war, und der Tag kam, wo sie der Böse holen wollte, da wusch sie sich rein und machte mit Kreide einen Kranz um sich. Der Teufel erschien ganz frühe, aber er konnte ihr nicht nahe kommen. Zornig sprach er zum Müller: »Tu ihr alles Wasser weg, damit sie sich nicht mehr waschen kann, denn sonst habe ich keine Gewalt über sie.« Der Müller fürchtete sich und tat es. Am andern Morgen kam der Teufel wieder, aber sie hatte auf ihre Hände geweint, und sie waren ganz rein. Da konnte er ihr wiederum nicht nahen und sprach wütend zu dem Müller: »Hau ihr die Hände ab, sonst kann ich ihr nichts anhaben.« Der Müller entsetzte sich und antwortete: »Wie könnt ich meinem eigenen Kinde die Hände abhauen!« Da drohte ihm der Böse und sprach: »Wo du es nicht tust, so bist du mein, und ich hole dich selber.« Dem Vater ward angst und er versprach, ihm zu gehorchen. Da ging er zu dem Mädchen und sagte: »Mein Kind, wenn ich dir nicht beide Hände abhaue, so führt mich der Teufel fort, und in der Angst hab ich es ihm versprochen. Hilf mir doch in meiner Not und verzeihe mir, was ich Böses an dir tue.« Sie antwortete: »Lieber Vater, macht mit mir, was Ihr wollt, ich bin Euer Kind.« Darauf legte sie beide Hände hin und ließ sie sich abhauen. Der Teufel kam zum dritten Mal, aber sie hatte so lange und so viel auf die Stümpfe geweint, dass sie doch ganz rein waren. Da musste er weichen und hatte alles Recht auf sie verloren.
Der Müller sprach zu ihr: »Ich habe so großes Gut durch dich gewonnen, ich will dich zeitlebens aufs Köstlichste halten.« Sie antwortete aber: »Hier kann ich nicht bleiben. Ich will fortgehen. Mitleidige Menschen werden mir schon so viel geben, als ich brauche.«
Darauf ließ sie sich die verstümmelten Arme auf den Rücken binden, und mit Sonnenaufgang machte sie sich auf den Weg und ging den ganzen Tag, bis es Nacht ward. Da kam sie zu einem königlichen Garten, und beim Mondschimmer sah sie, dass Bäume voll schöner Früchte darin standen. Aber sie konnte nicht hinein, denn es war ein Wasser darum. Und weil sie den ganzen Tag gegangen war und keinen Bissen genossen hatte und der Hunger sie quälte, so dachte sie: »Ach, wäre ich darin, damit ich etwas von den Früchten äße, sonst muss ich verschmachten. « Da kniete sie nieder, rief Gott den Herrn an und betete. Auf einmal kam ein Engel daher, der machte eine Schleuse in dem Wasser zu, sodass der Graben trocken ward und sie hindurchgehen konnte. Nun ging sie in den Garten, und der Engel ging mit ihr. Sie sah einen Baum mit Obst, das waren schöne Birnen, aber sie waren alle gezählt. Da trat sie hinzu und aß eine mit dem Munde vom Baume ab, ihren Hunger zu stillen, aber nicht mehr. Der Gärtner sah es mit an, weil aber der Engel dabei stand, fürchtete er sich und meinte, das Mädchen wäre ein Geist, schwieg still und getraute nicht zu rufen oder den Geist anzureden. Als sie die Birne gegessen hatte, war sie gesättigt und versteckte sich in das Gebüsch. Der König, dem der Garten gehörte, kam am anderen Morgen herab, da zählte er und sah, dass eine der Birnen fehlte, und fragte den Gärtner, wo sie hingekommen wäre; sie läge nicht unter dem Baume und wäre doch weg. Da antwortete der Gärtner: »Vorige Nacht kam ein Geist herein, der hatte keine Hände und aß eine mit dem Munde ab.« Der König sprach: »Wie ist der Geist über das Wasser hereingekommen? Und wo ist er hingegangen, nachdem er die Birne gegessen hatte?« Der Gärtner antwortete: »Es kam jemand in schneeweißem Kleide vom Himmel, der hat die Schleuse zugemacht und das Wasser gehemmt, damit der Geist durch den Graben gehen konnte. Und weil es ein Engel muss gewesen sein, so habe ich mich gefürchtet, nicht gefragt und nicht gerufen. Als der Geist die Birne gegessen hatte, ist er wieder zurückgegangen.« Der König sprach: »Verhält es sich, wie du sagst, so will ich diese Nacht bei dir wachen.«
Als es dunkel war, kam der König in den Garten und brachte einen Priester mit, der sollte den Geist anreden. Alle drei setzten sich unter den Baum und gaben acht. Um Mitternacht kam das Mädchen aus dem Gebüsch gekrochen, trat zu dem Baum und aß wieder mit dem Munde eine Birne ab; neben ihr aber stand der Engel im weißen Kleide. Da ging der Priester hervor und sprach: »Bist du von Gott gekommen oder von der Welt? Bist du ein Geist oder ein Mensch?« Sie antwortete: »Ich bin kein Geist, sondern ein armer Mensch, von allen verlassen, nur von Gott nicht.« Der König sprach: »Wenn du von aller Welt verlassen bist, so will ich dich nicht verlassen.« Er nahm sie mit sich in sein königliches Schloss, und weil sie so schön und fromm war, liebte er sie von Herzen, ließ ihr silberne Hände machen und nahm sie zu seiner Gemahlin.
Nach einem Jahr musste der König über Feld ziehen, da befahl er die junge Königin seiner Mutter und sprach: »Wenn sie ins Kindbett kommt, so haltet und verpflegt sie wohl und schreibt mir’s gleich in einem Briefe.« Nun gebar sie einen schönen Sohn. Da schrieb es die alte Mutter eilig und meldete ihm die frohe Nachricht. Der Bote aber ruhte unterwegs an einem Bache, und da er von dem langen Wege ermüdet war, schlief er ein. Da kam der Teufel, welcher der frommen Königin immer zu schaden trachtete, und vertauschte den Brief mit einem andern, darin stand, dass die Königin einen Wechselbalg zur Welt gebracht hätte. Als der König den Brief las, erschrak er und betrübte sich sehr, doch schrieb er zur Antwort, sie sollten die Königin wohl halten und pflegen bis zu seiner Ankunft. Der Bote ging mit dem Brief zurück, ruhte an der nämlichen Stelle und schlief wieder ein. Da kam der Teufel abermals und legte ihm einen andern Brief in die Tasche, darin stand, sie sollten die Königin mit ihrem Kinde töten. Die alte Mutter erschrak heftig, als sie den Brief erhielt, konnte es nicht glauben und schrieb dem Könige noch einmal, aber sie bekam keine andere Antwort, weil der Teufel dem Boten jedes Mal einen falschen Brief unterschob; und in dem letzten Briefe stand noch, sie sollten zum Wahrzeichen Zunge und Augen der Königin aufheben.
Aber die alte Mutter weinte, dass so unschuldiges Blut sollte vergossen werden, ließ in der Nacht eine Hirschkuh holen, schnitt ihr Zunge und Augen aus und hob sie auf. Dann sprach sie zu der Königin: »Ich kann dich nicht töten lassen, wie der König befiehlt, aber länger darfst du nicht hier bleiben. Geh mit deinem Kinde in die weite Welt hinein und komm nie wieder zurück.« Sie band ihr das Kind auf den Rücken, und die arme Frau ging mit weiniglichen Augen fort.
Sie kam in einen großen wilden Wald, da setzte sie sich auf ihre Knie und betete zu Gott, und der Engel des Herrn erschien ihr und führte sie zu einem kleinen Haus, daran war ein Schildchen mit den Worten: »Hier wohnt ein jeder frei.« Aus dem Häuschen kam eine schneeweiße Jungfrau, die sprach: »Willkommen, Frau Königin«, und führte sie hinein. Da band sie ihr den kleinen Knaben von dem Rücken und hielt ihn an ihre Brust, damit er trank, und legte ihn dann auf ein schönes gemachtes Bettchen. Da sprach die arme Frau: »Woher weißt du, dass ich eine Königin war?« Die weiße Frau antwortete: »Ich bin ein Engel, von Gott gesandt, dich und dein Kind zu verpflegen.« Da blieb sie in dem Hause sieben Jahre und war wohl verpflegt, und durch Gottes Gnade wegen ihrer Frömmigkeit wuchsen ihr die abgehauenen Hände wieder.
Der König kam endlich aus dem Felde wieder nach Haus, und sein erstes war, dass er seine Frau mit dem Kinde sehen wollte. Da fing die alte Mutter an zu weinen und sprach: »Du böser Mann, was hast du mir geschrieben, dass ich zwei unschuldige Seelen ums Leben bringen sollte!« Und sie zeigte ihm die beiden Briefe, die der Böse verfälscht hatte, und sprach weiter: »Ich habe getan, wie du befohlen hast.« Und sie wies ihm die Wahrzeichen, Zunge und Augen. Da fing der König an noch viel bitterlicher zu weinen über seine arme Frau und sein Söhnlein, dass es die alte Mutter erbarmte und sie zu ihm sprach: »Gib dich zufrieden, sie lebt noch. Ich habe eine Hirschkuh heimlich schlachten lassen und von dieser die Wahrzeichen genommen, deiner Frau aber habe ich das Kind auf den Rücken gebunden und sie geheißen, in die weite Welt zu gehen, und sie hat versprechen müssen, nie wieder hierher zu kommen, weil du so zornig über sie wärst.« Da sprach der König: »Ich will gehen, so weit der Himmel blau ist, und nicht essen und nicht trinken, bis ich meine liebe Frau und mein Kind wiedergefunden habe, wenn sie nicht in der Zeit umgekommen oder hungers gestorben sind.«
Darauf zog der König umher, an die sieben Jahre lang, und suchte sie in allen Steinklippen und Felsenhöhlen, aber er fand sie nicht und dachte, sie wäre verschmachtet. Er aß nicht und trank nicht während dieser ganzen Zeit, aber Gott erhielt ihn. Endlich kam er in einen großen Wald und fand darin das kleine Häuschen, daran das Schildchen war mit den Worten: »Hier wohnt jeder frei.« Da kam die weiße Jungfrau heraus, nahm ihn bei der Hand, führte ihn hinein und sprach: »Seid willkommen, Herr König!« Und sie fragte ihn, wo er herkäme. Er antwortete : »Ich bin bald sieben Jahre umhergezogen und suche meine Frau mit ihrem Kinde, ich kann sie aber nicht finden.« Der Engel bot ihm Essen und Trinken an, er nahm es aber nicht, und er wollte nur ein wenig ruhen. Da legte er sich schlafen und deckte ein Tuch über sein Gesicht.
Darauf ging der Engel in die Kammer, wo die Königin mit ihrem Sohne saß, den sie gewöhnlich Schmerzenreich nannte und sprach zu ihr: »Geh heraus mitsamt deinem Kinde, dein Gemahl ist gekommen.« Da ging sie hin, wo er lag, und das Tuch fiel ihm vom Angesicht. Da sprach sie: »Schmerzenreich, heb deinem Vater das Tuch auf und decke ihm sein Gesicht wieder zu.« Das Kind hob es auf und deckte es wieder über sein Gesicht. Das hörte der König im Schlummer und ließ das Tuch noch einmal gerne fallen. Da ward das Knäbchen ungeduldig und sagte: »Liebe Mutter, wie kann ich meinem Vater das Gesicht zudecken, ich habe ja keinen Vater auf der Welt. Ich habe das Beten gelernt, unser Vater, der du bist im Himmel; da hast du gesagt, mein Vater wäre im Himmel und wäre der liebe Gott; wie soll ich also einen so wilden Mann kennen? Der ist mein Vater nicht.« Wie der König das hörte, richtete er sich auf und fragte, wer sie wäre. Da sagte sie: »Ich bin deine Frau und das ist dein Sohn Schmerzenreich.« Und er sah ihre lebendigen Hände und sprach: »Meine Frau hatte silberne Hände.« Sie antwortete: »Die natürlichen Hände hat mir der liebe Gott wieder wachsen lassen.« Und der Engel ging in die Kammer, holte die silbernen Hände und zeigte sie ihm. Da sah er erst gewiss, dass es seine liebe Frau und sein liebes Kind war und küsste sie und war froh und sagte: »Ein schwerer Stein ist von meinem Herzen gefallen.« Da speiste sie der Engel Gottes noch einmal zusammen, und dann gingen sie nach Haus zu seiner alten Mutter. Da war große Freude überall, und der König und die Königin hielten noch einmal Hochzeit, und sie lebten vergnügt bis an ihr seliges Ende.
Besitzansprüche, die Ängste erzeugen
Offenbar geht dieses Märchen davon aus, dass es Menschen gibt, die unverschuldet Not und Leid erdulden und die deshalb so handeln, dass sie anderen Leid und Not zufügen. Es ist dies einer der Gründe, warum die Menschen aller Zeiten und in allen Kulturen immer wieder darüber nachgedacht haben, wozu das Böse und das durch dieses hervorgerufene Leid gut sein sollen. Und warum selbst Unschuldige leiden müssen.
Es sind dies Fragen, die sehr wohl berechtigt sind, die wir aber hier nicht aufwerfen dürfen, und zwar deshalb, weil auch die auftretenden Personen sich nicht damit auseinandersetzen. 3 Tatsächlich verliert ja keine einzige von ihnen auch nur einen Gedanken darüber, warum ein guter Gott, zu dem das Mädchen in aller Einfalt des Herzens betet, nicht verhindert, dass ein Vater, wenn auch ungewollt, einen Pakt mit dem Teufel eingeht und seinem unschuldigen und frommen Kind deshalb die Hände abhacken muss. Und nicht der geringste Zweifel wird laut gegenüber diesem Gott, der, obwohl er doch der biblischen Vorstellung zufolge nicht nur über die himmlischen Heerscharen, sondern auch über die höllischen Mächte gebietet, dem Teufel erlaubt, die Briefe zu vertauschen und so zusätzliches Unheil und weitere Grausamkeiten heraufzubeschwören. Diesbezügliche Spekulationen führen zwar auf dem direktesten Weg auf das dornige Gebiet der Theodizee, vor allem aber an deren Grenzen – und gleichzeitig immer weiter weg von dem, was dieses Märchen mitzuteilen hat.
Nicht um Gott also geht es hier, sondern einzig und allein um das, was Menschen, häufig unwillentlich und unwissentlich, einander antun – und wie sie aus den daraus entstandenen unheilvollen Situationen wieder herausfinden können.
Wir haben keinen Grund zu der Annahme, dass der Müller seine Armut selbst verschuldet hat. Er begibt sich in den Wald, um Holz zu sammeln. Warum aber macht er ausgerechnet dort die Bekanntschaft mit dem alten Mann, in welchem er erst später den Teufel erkennt? Selten nur erscheint der Wald im Märchen als Symbol der Geborgenheit; in der Regel steht er für das Unbewusste. Es eignet ihm etwas Beunruhigendes und Bedrohliches, denn überall lauern wilde Tiere und ungeahnte Gefahren. Der Mensch verliert den Überblick, sein Horizont ist eingeengt. Und deshalb kann der Müller eigentlich gar nicht anders, als das überaus verlockende Angebot des Unbekannten annehmen. Ahnungslos verschreibt er dem Teufel seine Tochter und verschachert so um eines augenblicklichen Vorteiles willen sein eigen Fleisch und Blut.
Gewiss beruht dieser ganze Handel auf einem Missverständnis. Diese Tatsache jedoch erinnert uns daran, dass und wie Menschen unschuldigerweise ›schuldig‹ werden können. Außerdem scheint die Unwissenheit des Müllers, die zu dem Teufelspakt führt, darauf hinzudeuten, dass er seine Tochter unbewusst als seinen Besitz betrachtet; sie gehört ihm genauso, wie der Apfelbaum hinterm Haus, der jeden Frühling mit schöner Regelmäßigkeit erblüht und jeden Herbst seine Früchte hergibt.
Im Mittelpunkt des Geschehens steht nun allerdings nicht der Müller, sondern die Tochter. Die Frage ist also, wie sich die uneingestandenen Besitzansprüche des Vaters auf das Mädchen auswirken. Dieses hat sich ausschließlich nach den Wünschen seines Vaters zu richten, dessen ganze weitere Existenz offenbar davon abhängt, dass er, entsprechend dem Willen des Teufels, seinem Kind die Hände abschlägt.
Nach einem alten Glauben hat der Böse keine Macht über einen Menschen, wenn dieser einen Kreis um sich zieht. Es ist dies einer der halbherzigen aber letztlich unnützen Versuche der Tochter, sich dem Vater gegenüber zu behaupten. Ein weiterer derartiger Vorstoß wird vom Vater aufgefangen. Er nimmt ihr das reinigende Wasser weg, welches sie vor dem Bösen schützen könnte. Damit ist der Wille des Mädchens gänzlich gebrochen. Hin- und hergerissen zwischen dem Verlangen, sein eigenes Leben zu leben, und dem Gehorsam, zu dem es sich gegenüber dem Vater verpflichtet fühlt, verzichtet es schließlich auf jeden Widerstand und lässt sich die Hände abschlagen. Würde es sich nämlich dazu aufraffen, sein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen, so stünde dieser Entschluss im Widerspruch zu den Wünschen des Vaters, was wiederum quälende Schuldgefühle zur Folge hätte. Indem es sich seinem Willen fügt, gibt es sich selber auf: »Macht mit mir, was Ihr wollt, ich bin Euer Kind.«
Besitzansprüche seitens der Eltern gegenüber ihren Kindern äußern sich in der Regel in ganz bestimmten, mehr oder weniger offen gezeigten Erwartungshaltungen.
Mehr als früher gibt sich heute die Psychologie Rechenschaft über die grundlegende Bedeutung, welche der Beziehung zwischen den Eltern und ihren Kindern zukommt für deren späteres Leben. Einigermaßen unterrichtet sind wir auch über Fehlentwicklungen und pathologische Störungen, die diese Beziehung gefährden.
Vielleicht weniger nur aus Gründen der materiellen Not, von denen unser Märchen spricht, sondern häufiger wohl aus der geheimen Angst heraus, einmal zu vereinsamen, kann es geschehen, dass Eltern ihre Kinder am liebsten für immer an sich binden möchten. So entstehen jene Tragödien, die Menschen zunächst zur Selbstaufgabe und irgendwann zur Verzweiflung führen. Sie wurden ja lange genug wie ein Besitz behandelt, über den man verfügen kann, und die Beharrlichkeit, mit der man sie davon abgehalten hat, ein eigenständiges Denken zu entwickeln, wird schließlich dazu führen, dass sie ihrem Über-Ich selbst dann noch gehorchen, wenn sie spüren, dass sie auf diese Weise langsam zugrunde gehen. Die Folgen werden nicht ausbleiben; sie manifestieren sich im beruflichen Versagen, in der gesellschaftlichen Isolation, in Krankheiten schließlich, die aber bloß körperliche Symptome eines seelischen Leidens darstellen. Die Eltern ihrerseits sind natürlich davon überzeugt, dass sie nur das Beste wollen für ihre Kinder. Dabei geschieht es nicht selten, dass diese ›Liebe‹ sich als blutsaugerisch und erpresserisch erweist.
Ähnliche Mechanismen sind auch in partnerschaftlichen Bindungen wirksam, wenn man Ansprüche und Forderungen stellt, welche das menschliche Vermögen der Partnerin oder des Partners schlichtweg übersteigen. Wenn sich die anderen diesen Erwartungen nicht gewachsen zeigen, bestraft man sie (oft eher unbewusst als beabsichtigt) mit Liebesentzug. Damit schließt sich der Teufelskreis. Die ständige Befürchtung, dem Partner oder der Partnerin nicht zu genügen und deshalb abgelehnt zu werden, vergrößert nur den Leistungsdruck und damit die Angst, der Zuneigung und Liebe verlustig zu gehen. Wenn das ganze Denken und Tun fast nur noch von dieser Angst bestimmt wird, muss ein Mensch verkümmern; er wird, was das Märchen vom Mädchen ohne Hände sehr drastisch illustriert, zu einem seelischen Krüppel.
Im Garten der Unschuld
Würde die Tochter ihrem Vater widersprechen, so litte sie unter unerträglichen Schuldgefühlen. Wenn sie sich seinen Wünschen fügt, führt das zur Selbstaufgabe. In jedem Fall scheint ihr das Tor zum blühenden Leben für immer verschlossen, es sei denn …
… es sei denn, es gelänge ihr, einen neuen Anfang zu machen. In der Tat verzichtet sie auf die Belohnung, die ihr der Vater für ihre Unterwürfigkeit in Aussicht stellt: »Ich habe so großes Gut durch dich gewonnen, ich will dich zeitlebens aufs Köstlichste halten.« Es ist dies eine sehr verbreitete Art, mittels derer man meint, zwischenmenschliche Beziehungen konsolidieren zu können. Während man auf unerfüllte Erwartungen mit Liebesentzug reagiert, wird Entgegenkommen mit einem ›Liebesangebot‹ honoriert; dieser Begriff aus der Geschäftssprache scheint hier am Platz. Die Tochter hingegen begreift intuitiv, dass der ›Geschäftssinn‹ die denkbar schlechteste Grundlage darstellt für zwischenmenschliche Beziehungen: »Hier kann ich nicht bleiben, ich will fortgehen.« Sie spricht damit nur aus, was wir alle kennen. Bekanntlich können wir uns von manchen belastenden Dingen innerlich erst richtig distanzieren, wenn wir auch räumlich Abstand gewinnen zu unserer gewohnten Umgebung.
Auf diese Weise scheint sich ein Prozess der Gesundung anzubahnen. Schon in der folgenden Nacht gelangt das Mädchen zu einem Garten, dessen fruchtbehangene Bäume ans biblische Paradies erinnern. Nun ist aber der Zugang zu diesem Garten von einem Wasserlauf versperrt, der jedoch von einem Engel zum Stillstand gebracht wird. In der Bibel ist der (Paradies-) Garten ein Sinnbild für den sündenfreien Urzustand des Menschen. Eine Mauer oder ein Wasserlauf oder sonst ein Hindernis, welche den Zugang zum Garten erschweren, symbolisieren die Schwierigkeiten und Hindernisse, die der Mensch überwinden muss, um zu einer besseren Einsicht und damit auf eine seelisch höhere Entwicklungsstufe zu gelangen. Jedenfalls kommt denn auch die Müllerstochter, nachdem sie den Wassergraben durchschritten hat, zu der Erkenntnis, dass sie – wie jeder Mensch – ein Anrecht darauf hat, ihre elementarsten Bedürfnisse zu befriedigen. Um ihren Hunger zu stillen, isst sie eine von den ›verbotenen‹ Früchten. Sie lernt also, dass es ihr gutes Recht ist, etwas von dem für sich zu beanspruchen, von dem sie bisher gemeint hat, dass es ›eigentlich‹ nur den anderen gehöre. Es ist dies ein Schritt, der sie von ihren unmotivierten Schuldgefühlen weg- und zu einer ›neuen Unschuld‹ hinführt: Man darf sich nehmen, was man braucht, denn nur so kann man leben, ohne seine Persönlichkeit zu verlieren und sich selber aufzugeben.
Wer sich je in einer ähnlichen Situation befunden hat wie diese Müllerstochter, wird die Botschaft des Märchens auf Anhieb verstehen: Du brauchst kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn du nicht länger auf die mehr oder weniger offenen Erpressungsversuche anderer Menschen eingehst; wenn du auf die Stimme deines Herzens mehr hörst als auf dein Über-Ich; wenn du dich endlich entschließt, deine Vorstellungen zu verwirklichen, deine Träume umzusetzen und zu deinen Sehnsüchten zu stehen, mit einem Wort, wenn du endlich den Mut findest, dein Leben zu leben.
Den Psychotherapeuten zufolge macht gerade dieses Problem sehr vielen Menschen zu schaffen. Ein klassisches Beispiel dafür findet sich bei Nossrat Peseschkian. Es handelt sich dabei um den Bericht einer 45-jährigen Hausfrau und Mutter von zwei Kindern, die Peseschkian wegen Depressionen, Angstzuständen, Magen-Darm-Beschwerden und Kreislaufstörungen aufsuchte:
Bisher habe ich eigentlich immer Rücksicht auf andere genommen. Rücksicht auf meinen Mann, auf meine Kinder, meine Eltern, Verwandten, Bekannten, Nachbarn und so weiter. Ich wollte es allen Leuten recht machen und bekam so ein total gestörtes Verhältnis zu mir selbst. Daher kam auch meine Entscheidungsschwäche. Ich traf meine Entscheidungen immer mit Blick darauf: Was sagen die anderen dazu, ist es ihnen recht, was denken sie, sind sie zufrieden? Hatte ich mich aber entschieden und sah, dass jemand mit meiner Entscheidung nicht einverstanden war, lenkte ich sofort ein und tat Dinge, die ich überhaupt nicht tun wollte. Dauernd hatte ich Zweifel und Schuldgefühle. Unstimmigkeiten in meiner Umgebung bedrückten mich. Ich war stark abhängig von der Meinung und dem Wohlwollen anderer. Hierzu kam, dass ich mir immer zu viel Arbeit aufgeladen habe, die ich einfach nicht bewältigen konnte. Die Hausarbeit wuchs für mich zu einem unüberwindlichen Hindernis heran. Ich resignierte, wurde mutlos und bekam starke Angstzustände und Depressionen, die mit Medikamenten behandelt wurden. […] Wenn etwas nicht klappte, wenn ich irgendetwas nicht zur Zufriedenheit meines Mannes erledigte, wenn er mir mal Vorwürfe machte, habe ich sofort resigniert, anstatt darüber zu sprechen. Ich habe mir immer gesagt: Wozu, es hat ja doch keinen Sinn. Ich verlor immer mehr Selbstbewusstsein, hatte keine Initiative mehr, mir war alles gleichgültig. Wenn ich mal wieder am Ende meiner Kräfte war, habe ich mich nicht etwa geschont, sondern immer weitergemacht, bis ich nicht mehr konnte. Es war wie ein Zwang. Eine innere Stimme in mir sagte: Du musst, und eine andere: Ich kann nicht, ich will nicht mehr. […] In der Psychotherapie fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Ich sah plötzlich, dass ich auch so frei sein kann und dass es nur ganz allein an mir liegt, dieses zu erreichen. Mir ist jetzt überhaupt erst klar, unter welchem Druck ich in all den Jahren gestanden habe. 4
Unser Märchen ruft also nur in Erinnerung, was im alltäglichen Leben Geltung hat, nämlich dass es Situationen geben kann, in denen man sich den Wünschen anderer versagen und ihnen so wehtun muss, um sich selber nicht aufzugeben. Und dass ein solches Verhalten trotz möglicher erziehungsbedingter Schuldgefühle in keiner Weise schuldhaft ist. Der Müllerstochter kommt dies erst zum Bewusstsein, nachdem sie den Graben zum Garten durchschritten hat.
Wie sie von zu Hause wegzog, sagte sie zum Vater: »Mitleidige Menschen werden mir schon so viel geben, als ich brauche.« Im Klartext: Was ich brauche ist Mitleid. Erinnern wir uns bloß daran, wie die Müllerstochter sich dem König vorstellt: »Ich bin ein armer Mensch, von allen verlassen, nur von Gott nicht.« Bezeichnend ist aber auch dies: Noch bevor das Märchen sagt, dass der König das Mädchen liebt, sagt der König: »Wenn du von aller Welt verlassen bist, so will ich dich nicht verlassen.« Und er lässt der Müllerstochter silberne Hände machen. Und macht sie zur Königin. Und wir sind damit schon wieder beim Opfer!
Gott durch den Abgott ersetzen
Immer wieder verfallen Menschen in den Fehler, ihre Beziehungen zu den anderen nach früheren Beziehungsmustern zu gestalten. Nicht weniger häufig geschieht es, dass man sich nach dem Scheitern einer Beziehung einem Menschen zuwendet, der genau das Gegenteil des früheren Partners verkörpert.
Für das Mädchen ohne Hände scheint das Letztere zuzutreffen. Der Vater betrachtete die Tochter als seinen Besitz. Dem König ist sie Geliebte und Gemahlin. Sann der Vater nur auf seinen eigenen Vorteil, so denkt der König ausschließlich an ihr Wohl. Der Vater gebärdete sich autoritär; der König hingegen überströmt geradezu von Mitleid. Der Vater hat ihr die Hände abgehackt; der König lässt ihr neue Hände machen.
Entgegen allem äußeren Anschein hat sich die Lage der Müllerstochter nur wenig verändert. Früher war ihr Vater sozusagen ihr Gott. Zumindest trägt sein Bild gottähnliche Züge. Immer war sein Wunsch ihr Befehl. Und nun ist der König ihr Abgott. Einem Abgott versucht man die Wünsche von den Augen abzulesen. Und muss doch immer befürchten, dem Angebeteten nicht zu genügen.
Die beiden lieben sich? Sie sind einander treu? Sie verstehen einander? Gewiss lieben sie sich. Und ganz gewiss sind sie einander treu. Nur verstehen können sie einander nicht. Wer aber einen anderen Menschen liebt, wünscht sich nichts sehnlicher, als dass wenigstens dieser eine Mensch einen verstehen möchte. Es ist dies die vielleicht wichtigste Voraussetzung für eine wahrhaft glückliche Beziehung. Dass gerade diese Voraussetzung hier fehlt, deutet das Märchen an, indem es das in der Literatur verbreitete Motiv von den vertauschten Briefen aufgreift. Der Sinn dieser Episode liegt auf der Hand: Der König und die Königin reden und leben aneinander vorbei.
Wohl ist aus der Müllerstochter eine Königin geworden. Aber damit sind ihre persönlichen Probleme keineswegs aus der Welt geschafft. Allerdings dauert das ganze Glück gerade nur ein Jahr, eine Zeitspanne, während derer man sich wohlfühlen kann, wenn jemand alles für einen tut: Endlich bin auch ich wer! Ich werde geliebt, bejaht, auf Händen getragen! Aber dieses neue Selbstwertgefühl wird schon sehr bald von Selbstzweifeln überlagert: Im Grunde bin ich ja total angewiesen auf einen anderen Menschen; wie wäre es denn, wenn ich allein und ganz und gar auf mich selber gestellt wäre? Nicht einmal zwei linke Hände hätte ich. Im Grund weiß ich doch ganz genau: Ich kann nichts, ich tauge zu nichts, zu nichts bin ich nütze. Intuitiv fühlt die Königin, wie unfrei und abhängig sie ist. Wie der Mond nur durch die Sonne zum Leuchten kommt, so bleibt die Königin ganz auf den Lichtglanz des Königs angewiesen. Ihr Sein und Dasein hängt einzig von ihm ab. Er ist es, der ihre Existenz gleichsam legitimiert.
Außerdem: Wie soll die Königin je eigenverantwortlich denken und handeln können, wenn der König ihr in allem zuvorkommt, und damit verhindert, dass sie, und sei es ein einziges Mal, irgendetwas anpacken kann oder irgendwo zupacken muss? Mit ihren silbernen Händen sitzt sie in einem goldenen Käfig. Eugen Drewermann kommentiert: »So schön die silbernen Hände sein mögen, die er [der König] ihr anfertigt – sie ersparen der Müllerstochter, eigene Organe zum Zugreifen entwickeln zu müssen. Der königliche Gemahl vermag in seiner gottgleichen Rolle also alles zu wirken und zu erreichen – nur nicht, daß seine Geliebte selbstständig und eigenständig wird; sie lebt bei ihm in einem Paradies, und doch bleibt sie subjektiv stets nur die gnädig Aufgenommene und Geduldete.« 5
Dem gleichen pädagogischen Irrtum, dem der König unterliegt, fallen immer wieder Eltern zum Opfer, die ihre ganze Lebenshoffnung bis zur Selbstaufgabe ausschließlich auf die Kinder konzentrieren, um deren Fortkommen zu fördern – und dabei nicht merken, wie sie diese gerade so in ihrer Persönlichkeitsentfaltung behindern und in ihrem Leben einengen. Manche Eltern können sich bis zum Letzten aufopfern, wenn es darum geht, ihren Söhnen und Töchtern zu ermöglichen, was ihnen selber versagt geblieben ist, damit wenigstens die Kinder einmal das leben können, was sie nicht leben durften.
Psychologische Mechanismen der geschilderten Art sind natürlich nicht nur zwischen Eltern und Kindern wirksam, sondern spielen auch in partnerschaftlichen Beziehungen eine Rolle. Erinnert sei an die leidige Tatsache, dass manche Menschen dazu neigen, andere in ihrer Freiheit einzuschränken, indem sie diese in ihrer Über-Sorge (die sie mit Liebe verwechseln) derart an sich pressen, dass ihnen die Luft zum Atmen wegbleibt. Wer einen Menschen so an sich fesselt, hat ihn bereits verloren; er entzieht ihm ja jenen Freiraum und jene Freiheit, ohne die sich nicht leben lässt.
Es ist also durchaus folgerichtig, dass die Königin sich gezwungen sieht (oder, wie das Märchen sagt, gezwungen wird), ihren Gemahl zu verlassen. Das Märchen fragt hier nicht, ob es andere Wege und Möglichkeiten gäbe; es behauptet lediglich, dass eine (wie sich erst später herausstellen wird) zeitweilige Trennung notwendig sein kann, um zu sich selber hin-und (wie sich ebenfalls erst im Nachhinein erweist) zum Partner oder zur Partnerin zurückzufinden.
Bei Menschen, die es gewohnt sind, die Moral an rein juristischen oder kirchenrechtlichen Maßstäben zu messen, mag diese Lösung (der Begriff ist hier im doppelten Wortsinn zu verstehen) auf Bedenken stoßen: Muss man die in einer partnerschaftlichen Beziehung einmal eingegangenen Verpflichtungen nicht um jeden Preis aufrechterhalten? Ist es legitim, die eigenen Bedürfnisse in den Vordergrund zu stellen? Entzieht man sich nicht der Verantwortung, wenn man plötzlich eigene Wege geht?
Unser Märchen scheint es da eher mit dem Jesuswort zu halten, nach welchem der Mensch nicht für den Sabbat da ist, sondern der Sabbat für den Menschen (vgl. Markus 2,27). Um zu sich selbst zu finden, muss die Müllerstochter erneut auf-und ausbrechen.
Es ist dies die Situation des Menschen, der mit seinem Sinnen und Trachten am Ende ist, der keine Antwort mehr hat auf die Frage nach dem Warum und Wozu, der sich selber nicht mehr zu helfen weiß und dem niemand mehr helfen kann. Und der keinen Menschen hat, dem er seine Not mitteilen könnte. Hermann Hesse hat diesen Sachverhalt in der Schluss-Strophe seines bekannten Gedichts Im Nebel so ausgedrückt: 6
Seltsam, im Nebel zu wandern! Leben ist Einsamsein. Kein Mensch kennt den andern, Jeder ist allein.
»Hier wohnt ein jeder frei.«
Mit ihrem kleinen Sohn Schmerzenreich findet sich die Königin in einem »großen wilden Wald« wieder. Dort trifft sie auf einen »Engel des Herrn«, der sie zu einem kleinen Haus führt, an welchem geschrieben steht: »Hier wohnt ein jeder frei.« Wie zum Beweis dafür werden sie und ihr Kind von einem Engel sieben Jahre lang verpflegt.
Ganz allmählich reift in der Königin die Einsicht heran, dass ihr Dasein seine Berechtigung nicht erst aus dem Lebensopfer gewinnt, das sie für andere bringt – beispielsweise für ihren Vater, dessen Willen sie sich sklavisch fügte, oder für ihren Gemahl, von dem sie sich beschenken ließ und sich dabei abhängig fühlte. Zum ersten Mal in ihrem Leben macht sie