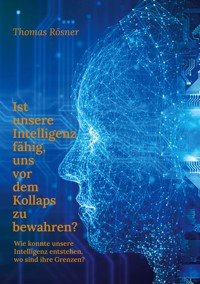
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die menschliche Intelligenz und unser Bewusstsein entstanden in den letzten 2,5 Millionen Jahren, das ist eine extrem kurze Zeit für die biologische Evolution. Vielmehr basiert diese Entwicklung auf einer anderen Art von Evolution, deren Datenbank völlig unabhängig vom Genpool existiert, der kulturellen Evolution. Sie wird in diesem Buch dargestellt bis hin zu ihrer Wirkung im Anthropozän mit all seinen globalen Problemen. Dabei stellt sich die Frage nach den Grenzen unserer Intelligenz, die möglicherweise nicht ausreicht um die Menschheitsprobleme zu lösen. Bisher haben wir unseren Geist für fast allmächtig gehalten, wir sind ins Weltall vorgestoßen, haben Atomwaffen entwickelt und Pandemien besiegt. Warum aber führen wir immer noch Kriege, ist das intelligent? Was ist eigentlich Intelligenz, wie intelligent sind Tiere und gibt es wirklich künstliche Intelligenz?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 418
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Kapitel 1 Informationsverarbeitung
1.1 Künstliche Intelligenz
Was ist und kann KI?
Was hat KI mit Nervennetzen zu tun?
Können Computer denken?
1.2 Grundlagen
Informationsverarbeitung und Genetik
Escherichia coli
Vielzeller Hydra
Informationsverarbeitung und Leben
Zusammenfassung
Kapitel 2 Intelligenz von Mensch und Tier
2.1 Intelligenz - Mensch
System 1 und 2
System 1: Funktionsweise
System 2: Funktionsweise
Weltmodell
Kreativität, Sprache
2.2 Intelligenz - Tiere
Reflexe
Instinkte
Emotionen
Gefühle
Zusammenfassung
2.3 Intelligenz - Gefühle
Arten von Gefühlen
Gefühle und Fuzzy Logik
Unscharfes Denken
Gefühle: Modell
Diskussion
2.4 Intelligenz - Dualität
Abstraktes Denken
Duales Denken
Kreativität und Aufmerksamkeit
2.5 Roger Penrose
Zusammenfassung
Kapitel 3 Anthropogenese
3.1 Paläoanthropologie
Hominini, die Entstehung des aufrechten Ganges
Die Gattung Homo, Werkzeuge
Homo habilis
Homo ergaster
Hände und Werkzeuge
Sozialstruktur, Lernen
Universeller Lebensraum
Homo erectus
Homo sapiens
Nachgefragt
3.2 Anthropogenese - Lernen
1. Genetische Informationsspeicherung
2. Automatisches Lernen
3. Lernen von den Eltern
4. Lernen in der Population
5. Kooperatives Lernen
6. Anhäufung von Wissen
3.3 Anthropogenese – Kulturelle Evolution
Gemeinschaft
Kollektive Gemeinschaften
Kulturelle Evolution
Kumulatives Wissen durch Variation und Selektion
Entstehung der Kulturellen Evolution
Intelligenz
Zwischenbilanz
3.4 Anthropogenese - Sprache
Gesten und Gebärden
Kommunikation und Kooperation
Algorithmen
Rationales Denken
3.5 Anthropogenese - Konkurrenz & Kooperation
Das Gefangenendilemma
Unkooperatives Lernen
Kooperation?
Zusammenfassung
Kapitel 4 Evolution
4.1 Biologische Evolution (kurz: BE)
Population
Genpool
Umwelt
Reproduktion
Variation
Selektion (natürliche Zuchtwahl)
Genfluss
Gendrift
Evolutionsprozess – Eigenschaften
Gruppenselektion
4.2 Kulturelle Evolution (kurz: KE)
Gruppe / Sippe / Population
Datenbank - Genpool
Umwelt
Reproduktion
Variation
Selektion
Fluss und Drift von kollektivem Wissen
Evolutionsprozess – Eigenschaften
Gruppenselektion
Besonderheiten der Kulturellen Evolution
4.3 Kopplung beider Evolutionsprozesse
Geschwindigkeit
Gehirngröße, Sprache
Zusammenfassung
Kapitel 5 Bewusstsein
5.1 Bewusstsein - Einleitung
Dualisten
Physikalisten
Naturalisten
5.2 Bewusstsein - Intentionalität
Begriff der Intentionalität
Intentionalität - Modell
Modelleigenschaften
5.3 Qualia
Atome
Fledermaus
Zombie
Mary
Qualia oder Gefühle?
5.4 Wahrheit und Erkenntnis
Wahrheit
Wahrnehmung
Objekte
Begriffe
Repräsentationen und Sprache
Selbstbewusstsein
Wir-Bewusstsein
Bilanz
Schlussfolgerung
Kapitel 6 Zivilisation
6.1 Neolithische Revolution
Produkte, Produktionsmittel
Produktionsverhältnisse
Politisch-kulturelle Verhältnisse
Neolithische Revolution und Kulturelle Evolution
Verallgemeinerung
6.2 Gegenwart
Weltbevölkerung
Langfristige Ziele setzen?
Wissenschaft
KE im internationalen Rahmen?
Marktwirtschaftlich-Kulturelle Evolution
Schlussfolgerung
6.3 Anthropozän
Ökologischer Fußabdruck
Biodiversität, biologische Vielfalt
Nachhaltigkeit
Kriege
Bilanz
6.4 Zivilisation - Perspektiven
Mars
Planeten erkunden
Der einsame Raumfahrer
Hawkings Vision
Zwei letzte Fragen
Literaturverzeichnis
Index
Informationen zum Autor
Einleitung
Wir versprechen uns landläufig sehr viel von unserer Intelligenz. Sie wird es ermöglichen, uns von selbstfahrenden Autos zu einem Reiseziel schaukeln zu lassen, sie wird uns fast unendlich viel regenerative Energie bescheren und wir werden zum Mond reisen können und von weitem die Erde betrachten. Andererseits kann uns Intelligenz geradewegs ins Verderben führen. Eine Reihe von Ländern (Russland, China, USA, Indien) sind dabei Atomraketen zu entwickeln, für die es keine Abwehrmöglichkeiten mehr gibt – zumindest gegenwärtig nicht. Diese so genannten Hyperschallraketen (Fluggeschwindigkeit 5 – 8 Mach) sind gleitende, steuerbare Geschosse mit interkontinentaler Reichweite, ihre Bahnen sind nicht vorhersehbar und es ist kaum möglich sie zu orten. Bisherige Interkontinentalraketen hatten z.T. ballistische Flugbahnen, die berechenbar waren, sodass man sie mit Gegenraketen treffen konnte – das war der SDI Raketenschirm von Ronald Reagan. Diese Zeiten sind vorbei, die irrwitzige Rüstungsspirale dreht sich weiter.
Unsere Intelligenz haben wir genutzt, um riesige Fischfangflotten zu bauen, die ununterbrochen auf den Weltmeeren mit kilometerlangen Netzen herumfahren, den tiefen Meeresboden abrasieren und verwüsten und mit industrieller Gewalt die Meere leerfischen können. Das geschieht im Namen der Freiheit der „Meeresnutzung“. Ebenso wenig ist zu verstehen, warum Teile des größten tropischen Regenwaldes der Erde, des Amazonas-Regenwaldes, abgeholzt werden, obwohl Wälder eine entscheidende Rolle spielen bei der Bindung von CO2 und damit beim Kampf gegen den Klimawandel.
Intelligenz ist also zu allem zu gebrauchen, zum Erreichen von Zielen der Vernunft als auch zur brutalen Durchsetzung so genannter Interessen bis hin zur gegenseitigen Vernichtung.
Woher kommt diese janusköpfige Erscheinung der Intelligenz? Sind wir doch keine vernunftbegabten Tiere oder sind wir einer Höllenmacht ausgeliefert?
Selbst wenn wir uns noch einige Jahrzehnte darum kümmern, dass die Wirtschaft brummt, wir alle Arbeit haben und weiter machen können wie bisher, werden wir genau dadurch unsere alte Mutter Erde ruinieren. Wir befinden uns im Zeitalter des Anthropozän, in dem der Mensch die wichtigste Einflussgröße auf das Klima und die Biosphäre der Erde geworden ist. Diese glasklar beweisbare Situation wird von Populisten bestritten, die deswegen Populisten heißen, weil sie den einfachen Wunsch vieler Menschen nach einem angenehmen und zukunftssicheren Auskommen missbrauchen um Angst und Widerstand zu erzeugen. Aber ihr Schlachtruf „weiter so wie bisher“ ist das genaue Gegenteil von Zukunftssicherheit.
Die Corona Pandemie stellte eine unmittelbare Lebensbedrohung dar, die die Menschen aufrüttelte und zur Akzeptanz harter Maßnahmen bewog. Die Probleme, die im Anthropozän vor uns stehen, sind aber meist noch keine unmittelbare persönliche Bedrohung, sondern betreffen unsere weitere Zukunft und sind nur mit wissenschaftlichen Modellen zu erklären. Die Situation ist sogar noch schwieriger, denn die Vorhersagen werfen die Frage auf, ob wir uns unsere Bedürfnisse überhaupt leisten können. Schon die einfache, phantastische Forderung nach gerechtem Wohlstand in unserer Welt ist höchst problematisch, denn wie sollte die ungleiche wirtschaftliche Lebenssituation zwischen den Entwicklungsländern und den reichen Industrieländern ausgeglichen werden? Schon jetzt ist unsere Erde völlig übernutzt, wir verbrauchen weit mehr natürliche Ressourcen, als die Erde wieder regenerieren kann. Wenn also die reichen Länder den armen so viel abgeben würden, dass ein völliger Ausgleich erreicht ist, ist das KEINE Lösung des Problems – die Welt würde weiterhin im gleichen Umfang übernutzt werden.
Die industrielle Landwirtschaft hat eine so hohe Produktivität erreicht, dass nachweislich der Hunger auf der Erde zurückgedrängt werden konnte. Aber genau diese Art der Landwirtschaft hat die Natur ruiniert, anders kann man das leider nicht beschreiben. Sie ist der wichtigste Grund für das Artensterben, die ungeheure Reduktion der Biodiversität sowie die Tatsache, dass es nur noch wenige Hotspots von intakten, sich frei entwickelnden Ökosystemen auf der ganzen Welt gibt. Der Autofahrer mag sagen, dass es doch ganz praktisch ist, wenn es kaum noch Insekten gibt, die die Frontscheiben unserer schön schnell fahrenden Autos verschmieren. Wenn allerdings die chinesischen Bauern mit Pinselchen an den Blüten der Pflanzen herumwedeln um sie selbst zu bestäuben, weil es keine Bienen mehr gibt, wird die ganze Dramatik der Situation offensichtlich.
Biodiversität zählt gegenwärtig nicht zu den besonders interessierenden Themen, auch die ‚Fridays for Future‘ Bewegung ist mehr am allgemeinen Klima interessiert, weil z.B. rauchende Schornsteine als Luftverpester leicht zu erkennen sind. Es ist schwer zu vermitteln, warum wir uns überhaupt um Biodiversität kümmern sollten, wir bevorzugen sowieso eine technologische, künstliche, selbst geschaffene Welt. Dabei wird aber vergessen, dass wir auch biologische Wesen sind, die wie alles Leben von der Umwelt abhängen. Das Problem ist, dass wir den größten Teil der Prozesse und Wechselwirkungen in der Biosphäre überhaupt nicht verstanden haben. Wir sind nicht in der vorteilhaften Situation wie vor Corona, wo wir schon sehr viel über Viren und Pandemien wussten, nur dadurch waren wir wehrhaft. Aber über die Wirkungen unserer Brutalität gegenüber der Pflanzen- und Tierwelt wissen wir fast nichts, nur wenige tapfere Wissenschaftszweige befassen sich überhaupt damit. Die Bereitschaft, dafür große finanzielle Mittel bereit zu stellen ist fast nicht vorhanden, es ist ja wichtiger, die Wirtschaft zu fördern. Wenn wir unser Zerstörungswerk fortsetzen, werden wir bei zukünftigen Katastrophen in der Biosphäre nicht einmal untersuchen können, warum sie früher bei intakter Natur nicht auftraten, denn es gibt sie nicht mehr. Wir wissen, dass die Natur außerordentlich vernetzt ist, dieses Netz wurde in hunderten Millionen Jahren geflochten. Wir zerreißen es im Zeitraum eines Wimpernschlages und verlassen uns darauf, dass es reicht, wenn wir uns um Kühe, Schweine und Geflügel kümmern und ein paar Weizenarten. Wenn die Tiere krank werden, schütten wir Antibiotika in die Ställe, wenn das nicht reicht, machen wir Gentechnik. Wenn das nicht reicht, werden wir schon eine Lösung finden, wir sind schließlich intelligent.
Das Corona Virus Sars-Cov-2 verlässt seinen Wirt durch Aerosole in der Atemluft und hält sich in bewegter Luft nicht lange, es fällt zu Boden und kann einen anderen Wirt nicht mehr erreichen. In ruhender Luft hält es sich länger, kann aber einen anderen Wirt nur dann erreichen, wenn der das Virus aktiv einatmet, es kann sich schließlich nicht selbst bewegen, es ist ein lebloses Partikel. Die Übertragung zwischen Wirten ist also ein Problem des Abstandes der Beteiligten, die wiederum abhängt von der Dichte der Personen in einer bestimmten Umgebung. Die Fortpflanzungsfähigkeit des Virus ist daher eine direkte Funktion der Dichte der Menschen, d.h. im globalen Maßstab der Anzahl der Menschen auf der Erde und ihrer Mobilität. Daher konnte das Virus früher nicht existieren, sondern erst seitdem es sehr viele Menschen gibt und die Globalisierung Fahrt aufnahm. Mit anderen Worten: Die Evolution hat eine neue ökologische Nische hervorgebracht sowie eine Kreatur, die beide ideal zueinander passen. Wie oft wird das noch passieren? Wie viele Viren werden diese ökologische Nische auch noch nutzen, die einen so perfekten Übertragungsweg bietet?
Wir könnten solche neuen Bedrohungen völlig vermeiden, wenn die Anzahl der Menschen auf der Erde sinken würde. Das Problem der Überbevölkerung tritt damit ebenso in Erscheinung wie bei anderen globalen Problemen wie Biodiversität und Klimaschutz. Die Überbevölkerung ist die gravierendste Einzelursache für die Klimakrise auf der Welt, die Politiker sind jedoch unisono einig im Verschweigen und Verdrängen dieses Problems, denn sie alle wollen gewählt werden. Das geht sehr gut mit dem Versprechen von Wachstum und weniger gut mit Maßnahmen, um viel Geld aufzuwenden um die Länder mit hohem Bevölkerungswachstum auf einen besseren Entwicklungsweg zu bringen.
Wenn man versucht, die Gesamtsituation der Entwicklung der menschlichen Gesellschaft zu beschreiben, fällt eine gewaltige Diskrepanz auf: Auf der einen Seite sind wir in der Lage, technologische Höchstleistungen zu erbringen. Wir können uns tatsächlich vornehmen, den Mars zu erreichen und uns in der dortigen feindlichen Umwelt zu etablieren. Auf der anderen Seite sind wir außerstande, drängendste kulturelle Probleme zu lösen, wie die effektive Zusammenarbeit im globalen Maßstab. Die Globalisierung der wirtschaftlichen Vernetzung ist längst Tagesgeschäft, die Globalisierung der Zusammenarbeit bei der Lösung der Weltprobleme ist bestenfalls Flickschusterei, wir stehen ratlos vor eskalierenden kriegerischen Konflikten und produzieren immer mehr Waffen zur gegenseitigen Bedrohung. Die Waffen sind technologisch perfekt, ihr Sinn ist mittelalterlich und einer fortgeschrittenen Zivilisation unwürdig.
Kurz: Wir beherrschen die Technologien aber unsere Kultur ist unterentwickelt.
Dabei ist unter Kultur die Gesamtheit unserer Techniken zur Organisation unseres Gemeinwesens zu verstehen, insbesondere im globalen Maßstab.
Die genannte Diskrepanz ist m.E. der Hauptgrund, weshalb wir nicht gewappnet sind für die Zukunft. Wenn die Entwicklung der Künstlichen Intelligenz gegenwärtig vom Militär vereinnahmt und maßgeblich vorangetrieben wird, zeigt das wieder einmal, dass etwas schiefläuft. Wenn deutsche Konzerne Geflügelfleisch nach Afrika exportieren und durch konkurrenzlos niedrige Preise die dortigen bäuerlichen Familienbetriebe ruinieren, ist das grausam. Wenn deutsche Firmen Mittel zur Vernichtung von „Unkraut“ produzieren dürfen, deren Anwendung aufgrund ihrer Giftigkeit und Gefährlichkeit für die Umwelt und die Menschen in Europa verboten ist, und die Produktion nur stattfindet, weil ein Export z.B. nach Indien möglich ist, ist das unerträglich.
Was wird passieren, wenn ein Asteroid auf die Erde zufliegt, wie sind wir darauf vorbereitet, wer wird uns retten? Vielleicht Amerika mit Trump an der Spitze, der wie immer mit Wahlkampf beschäftigt ist?
Man kann diese Liste der unverständlichen Missverhältnisse beliebig fortsetzen, es stellt sich die Frage nach dem Grund dieser Situation. Liegt er vielleicht in einem strukturellen Defizit unserer Intelligenz? Ist diese Intelligenz nur fähig, logisch-rationale Probleme zu lösen, aber keine kulturellen? Sind unsere biologischen Bedürfnisse so dominant, dass wir nicht anders können, als verschwenderisch zu leben? Wie hat sich überhaupt unser Zusammenleben etabliert, tun wir das nur, weil es große wirtschaftliche Vorteile bringt und wir deshalb die damit verbundenen lästigen Probleme in Kauf nehmen?
Alle diese Fragestellungen zeigen, dass es nötig sein wird, grundlegende Eigenschaften des Phänomens der Intelligenz zu verstehen. Dabei soll kein endloser theoretischer Diskurs dieses ‚Dinges an sich‘ begonnen werden, sondern es werden praktische Fragen gestellt wie z.B.: Wie unterscheidet sich unser Denken von dem der Tiere? Welche kognitiven Gemeinsamkeiten gibt es und wie groß sind die Unterschiede? Ist unser Denken der Informationsverarbeitung in Computern ähnlicher als dem Denken von Tieren?
Diese Fragen haben eine sehr enge Verbindung zu dem Problem, wie unser Denken und Bewusstsein entstanden. Wenn der Unterschied zu Tieren gering wäre, würde man schneller akzeptieren, dass unsere kognitiven Fähigkeiten evolutionär aus dem Tierreich entstanden und keine besonderen Erklärungen wie z.B. ein göttliches Design benötigen. Wäre hingegen ein sehr großer Sprung zwischen dem tierischen Denken und unserer Intelligenz festzustellen, hätten all jene recht, die versuchen unsere intellektuellen Fähigkeiten analytisch zu untersuchen und die Gehirnstrukturen aufzuklären, d.h., das Gehirn aus sich selbst heraus zu erklären.
Zunächst soll nur festgehalten werden, dass die beiden Probleme
A) Beschreibung der Struktur und Eigenschaften menschlicher Intelligenz und Abgrenzung zu anderen Formen von Intelligenz,
B) Entstehung unserer Intelligenz
sehr eng zusammenhängen. Einerseits werden dadurch die Schwierigkeit und Komplexität der einzelnen Fragestellungen klar und andererseits ist die Beantwortung beider Fragen leichter geworden, indem jede einen Teil der Antwort auf die andere enthält.
Wenn man Problem B betrachtet, muss man offenbar zurückgehen in die Entstehungsgeschichte von Homo sapiens. Oben wurde aber beschrieben, dass letzten Endes Probleme unserer heutigen Existenz untersucht werden sollen. Es mag der Eindruck entstehen das sei etwas weit hergeholt, aber zu diesem Ansatz sagt Sebastian Junger:
Zwei der Verhaltensweisen, die nur dem frühen Menschen eigen waren, sind das systematische Teilen von Nahrung und die altruistische Verteidigung der Gruppe. Andere Primaten verhielten sich kaum so, aber die Hominiden taten es, und dieses Verhalten half, sie auf einen evolutionären Weg zu bringen, der die moderne Welt schuf. [101]
Warum gingen wir diesen Weg nicht weiter? Wann und warum ging auf diesem Weg etwas schief?
Viele Menschen werden der Annahme zustimmen, dass unsere besondere Intelligenz entstanden ist durch eine oder mehrere glückliche Mutationen in unserer Evolution, die die Leistungsfähigkeit des Gehirns revolutionär veränderte. Die Verbindung zur Intelligenz von Tieren wäre praktisch belanglos und es würde nichts bringen, die Evolution genauer zu betrachten.
Ich werde versuchen zu zeigen, dass diese Meinung recht verlockend aber grundfalsch ist, sie gibt dem Effekt der genetischen Mutation ein so großes Gewicht, das er in der Evolution niemals hatte. Evolution gibt es immer nur als eine Reihe von kleinen Schritten für lokale Optimierungen. Völlig neuartige Anpassungen gab es grundsätzlich nur in langen Zeiträumen, die von einem ebenso lang andauernden, konstant wirkenden Selektionsdruck charakterisiert waren. Was war also der lang andauernde Selektionsdruck, der unsere Intelligenz erzwang? Und warum war dieser Druck dergestalt, dass sich unser Bewusstsein entwickeln musste, ist nicht das Bewusstsein eine völlig neue Qualität?
Warum wirkte dieser Zwang nicht auch auf andere Tierspezies, sondern nur auf die Hominiden?
Noch einmal: Warum muss man sich mit dem Problem der Entstehung der Intelligenz herumschlagen, wenn man sich (laut Titel dieses Buches) um unsere Zukunft Sorgen macht?
Man wird sehen, dass es einen verblüffenden Zusammenhang von Intelligenz und Kultur gibt und damit einen Zugang zur Erklärung des eingangs genannten Widerspruchs zwischen intellektueller Leistungsfähigkeit und kulturellem Versagen.
Die theoretische Grundlage dafür ist eine bestimmte Form der Evolution, die nicht genetischer Natur ist und ausschließlich beim Menschen auftritt. Sie funktioniert völlig vergleichbar wie die biologische Evolution auf der Grundlage der drei Darwinschen Module Vererbung, Variation und Selektion. Sie führt ebenfalls zu einer höheren Fitness, basiert aber nicht auf den Genen und hat deutlich andere Effekte. Z.B. wirkt sie unvergleichlich schneller als die biologische Evolution und es ist mit ihr erklärbar, warum sich unser Gehirn in einer unglaublich kurzen Zeit so schnell entwickelte, vergrößerte und den qualitativen Sprung zum Bewusstsein schaffte.
Diese so genannte Kulturelle Evolution ist kein neues Konzept und wird in der Wissenschaft schon länger intensiv diskutiert, sogar mit zunehmender Aufmerksamkeit. Besondere Beiträge kamen vom Leipziger Institut für evolutionäre Anthropologie (M. Tomasello), von namhaften amerikanischen Wissenschaftlern (P.J. Richerson, R. Boyd) sowie einer ganzen Reihe von Fachrichtungen, u.a. Philosophie (G. Schurz).
Allerdings wird die Kulturelle Evolution z.T. nur bezogen auf die letzten 70.000 Jahre der menschlichen Entwicklung, das ist die Zeit seit den ersten Höhlenzeichnungen und dem Nachweis, dass Homo sapiens kulturelle Fähigkeiten erlangte. Diese Eingrenzung ist aber nicht notwendig, wenn man den Begriff der Kultur deutlich umfassender ansetzt, was eigentlich auch allgemein anerkannt ist. Stellt man den Begriff der Kulturellen Evolution in diesen größeren Rahmen, bietet er ein enormes Potential für ein besseres Verständnis der genannten Probleme.
Schließlich ein Wort zu meinem Vorgehen.
Grundsätzlich halte ich es für absolut notwendig, religiöse oder ideologische Standpunkte zu vermeiden. Ich halte sie für völlig unproduktiv und ungeeignet, tragfähige Lösungen für irgendwelche Probleme der Menschheit zu finden. Die geschichtliche Erfahrung mit allen Religionen und Ideologien zeigen, dass sie immer nur statt zu Lösungen zu ausufernden Konflikten geführt haben. Auch Ansätze aus Moral und Ethik sind nicht sehr hilfreich, da sie kaum Überzeugungskraft haben, sie haben meist nur den Charakter von unbeweisbaren, unsicheren Behauptungen. Die einzige akzeptable und nachweislich erfolgreiche Methode ist die Wissenschaft, die allerdings ihren Preis hat: Sie ist mühselig und verlangt immer nach Beweisen.
Im Falle der Mathematik sind diese Beweise eindeutig und benötigen keine Diskussionen. Lediglich die Eleganz und Durchsetzungskraft von Theorien ist ein Streitpunkt, die Theorien selbst sind es nicht. Im Falle außerordentlich komplexer Theorien, die z.B. Hundert Seiten konzentrierten mathematischen Textes zur Beweisführung benötigen, war es vorgekommen, dass nach der Veröffentlichung ein Fehler entdeckt wurde. Im Allgemeinen sind mathematische Theorien aber schlicht wahr.
Das ist im Bereich der Lebenswissenschaften grundsätzlich anders. Sie benötigen für Ihre Arbeit Hypothesen, die anschließend durch weitere Untersuchungen und Prüfungen überarbeitet werden. Auch ausformulierte Theorien können später revidiert und als falsch oder ungenau erkannt werden. Das entscheidende Credo der Wissenschaften lautet deshalb, dass niemand das Recht hat, den Unterschied zwischen hypothetischen Annahmen und bewiesenen Fakten zu verwischen oder zu vertuschen. Im Gegenteil, es besteht die Pflicht zur Klarstellung.
Genau dieses Vorgehen ist der Grund für den Erfolg der Wissenschaft und letztlich für unseren Fortschritt. Religionen und Ideologien haben dieses Prinzip immer grundsätzlich umgekehrt, sie gehen von (oft sogar absurden) Voraussetzungen aus, die nicht hinterfragt werden dürfen und als ewige Wahrheit ausgegeben werden. Daraus werden dann notwendige Verhaltensweisen und Zukunftsvorhersagen abgeleitet, meistens sogar ohne logische Ansprüche. Aber selbst mit klarer Logik kann aus falschen Voraussetzungen etwas „abgeleitet“ werden, allerdings nichts was wahr ist.
Eine entscheidende Unsicherheit besteht sehr oft darin, dass nicht definierte Begriffe verwendet werden. Abermals kann man nicht die Forderung erheben, dies mit mathematischer Strenge zu tun. Mutige Hypothesen verlangen manchmal direkt die Verwendung ‚weicher‘ Begriffe, die selbst im Laufe der Untersuchungen präzisiert werden müssen.
Im vorliegenden Themenbereich ist z.B. der Begriff Intelligenz zunächst nicht definiert. I.A. wird der Leser das tolerieren und davon ausgehen, dass dieses Wort für eine Konversation geeignet ist. Wenn man allerdings fragt, ob Bakterien oder Computer intelligent sind, kommen Probleme auf.
Ich werde mich bemühen, damit offen umzugehen.
Kapitel 1 Informationsverarbeitung
Ein bekanntes Maß der Intelligenz ist der so genannte Intelligenzquotient IQ, bei dem die mentale Leistungsfähigkeit eines Menschen bestimmt wird im Vergleich zu einer Referenzgruppe. Der IQ beschreibt also per definitionem die menschliche Intelligenz, aber auch nur quantitativ und nicht durch eine begriffliche Definition.
Eine solche Eingrenzung des Begriffes Intelligenz auf den Menschen ist heutzutage nicht mehr üblich, inzwischen ist der Begriff Künstliche Intelligenz allgemein bekannt und es ist weitgehend akzeptiert, dass auch Tiere intelligent sind. Alle diese Formen von Intelligenz haben eines gemeinsam, sie basieren immer auf Informationsverarbeitung. Dieser Begriff ist bestimmt leichter zu fassen als die Intelligenz und ich will versuchen, ihn darzustellen. Am einfachsten ist die Beschreibung dessen, was man unter Künstlicher Intelligenz (KI) versteht.
1.1 Künstliche Intelligenz
Im Silicon Valley sind autonom fahrende Autos von Google auf öffentlichen Straßen ohne Sicherheitsfahrer zugelassen, medizinische Diagnostik ist auf einigen Gebieten ohne Computer nicht mehr möglich und Überwachungskameras erkennen und identifizieren auf öffentlichen Plätzen Passanten. Navigationsgeräte sind uns längst vertraut und an die sprachliche Kommunikation mit verschiedenen Geräten sind wir bereits gewöhnt. Bei all dem sollen KI-Methoden eine entscheidende Rolle spielen, die letztlich lernfähige Computerprogramme sind.
Früher wurden Computer als intelligente Idioten betrachtet, die nur das taten, was Programmierer ihnen beigebracht hatten – warum sollte das plötzlich anders sein? Ist der Begriff KI möglicherweise nur ein Vermarktungstrick? Oder ist es tatsächlich gelungen, Computern eine Intelligenz beizubringen, die möglicherweise irgendwann einmal mit uns konkurrieren kann?
An einigen Ereignissen der letzten Zeit kann man erkennen, dass KI weit mehr ist als nur ein Modewort.
Andreas Menn weist darauf hin, dass 2000 Wissenschaftler vor einiger Zeit einen öffentlichen Brief geschrieben haben, in dem sie eindringlich vor der Entwicklung autonomer Waffen warnen. Es geht dabei u.a. um Waffen tragende Drohnen, die selbständig und ohne jede menschliche Kontrolle Feinde erkennen und vernichten. Es heißt darin:
Künstliche Intelligenz (KI) hat einen Punkt erreicht, an dem der Einsatz solcher Systeme in wenigen Jahren möglich ist, nicht in Jahrzehnten. [102]
Diese Entwicklung sei so entscheidend wie zuvor nur die Erfindung der Atomwaffe und des Schießpulvers. Zu den Unterzeichnern gehören Stephen Hawking und Elon Musk.
Nicht nur das Militär hat die KI als Schlüssel zu völlig neuartigen Waffen entdeckt, sondern auch die Wirtschaft setzt mit massiven Investitionen auf KI.
In Focus-online heißt es:
Es ist ein Wettkampf von globalem Ausmaß – der Kampf um Künstliche Intelligenz (KI). Bislang beherrschen die USA diese Schlüsseltechnologie. [103]
Das enorme wirtschaftliche Potential der KI resultiere daraus, dass sie sich in nahezu jedem Lebensbereich einsetzen lässt. Es wird berichtet, dass China aufholen will und gewaltige Investitionen tätigt. Das Land erwartet im Jahr 2030 einen Zuwachs des BIP aufgrund des Einsatzes der KI um 7 Billionen $, die USA hingegen nur um 3,7 Billionen $.
Europa spielt im Kampf um KI eine untergeordnete Rolle, tätigt deutlich geringere Investitionen und der strenge Datenschutz behindert Innovationen. Einen Vergleich bietet die Zahl angemeldeter Patente im Bereich maschinelles Lernen bis 2015:
USA 1489, China 754, Deutschland 140.
Der Anteil an den weltweiten Investitionen in die KI beträgt für die USA 48%, für China 38%.
Man kann also feststellen, dass sich die Wirtschaft offenbar von KI enorme Gewinne verspricht. Es handelt sich nicht um visionäre Ideen Einzelner, sondern um die nächste Umwälzung in der gesamten Produktionsweise.
Gegenwärtige Grenzen der Anwendung von KI werden im folgenden Bericht sichtbar:
Es wurden Versuche unternommen, autonom fliegende Düsenjäger zu entwickeln. Jedoch wurde festgestellt, dass Kampfpiloten außerordentlich schnell auf hoch komplexe Situationen reagieren können und zwar nicht rational, sondern intuitiv. Das kann gegenwärtig nicht von Computern realisiert werden, auch nicht mit KI- Programmen. Es fragt sich: Was ist das für eine Form von Intelligenz, die die Piloten zu diesen Leistungen befähigt? Und ist sie evtl. von rein logisch arbeitenden Computern grundsätzlich nicht zu erbringen?
Was ist und kann KI?
Künstliche Intelligenz bedeutet zum größten Teil, dass man Computer so programmiert, dass sie lernen können.
Betrachten wir als Beispiel die Aufgabe, in einem Bild einer Verkehrssituation zu erkennen, ob sich darin ein Verkehrsschild befindet. Solche Bilder liefert eine im Auto verbaute Kamera und viele Autofahrer werden es zu schätzen wissen, dass sie auf ihrem Display z.B. die im Moment gültige Geschwindigkeitsbeschränkung sehen, die die Kamera (bzw. der mit ihr verbundene Computer) vorher erfasst hatte. Wenn ein Computer lernen soll diese Aufgabe zu lösen, füttert man ihn mit vielen Bildern von Verkehrssituationen zusammen mit der Information, ob darin ein Verkehrsschild zu sehen ist oder nicht. Man nennt diese Menge von Informationen eine Lernstichprobe und der Computer soll durch ihre Verarbeitung „lernen“, in einem Bild ein Verkehrsschild zu erkennen. Das Lernen kann natürlich nicht einfach darin bestehen, die Stichprobe abzuspeichern, denn die Erkennung von Verkehrsschildern soll auch in Bildern klappen, die denen in der Stichprobe nicht einmal ähnlich sind.
Ein derartiges Lernverfahren nennt man supervised learning, also betreutes Lernen ähnlich wie in einem Lehrer-Schüler-Verhältnis.
Das Lernergebnis kann verbessert werden, wenn der Lehrer aufpasst, ob der Schüler/Computer weitere ihm gestellte Aufgaben korrekt bewältigt, also in unbekannten Bildern bei der Erkennung von Schildern keine Fehler macht. Im Falle eines Fehlers muss der Schüler einen Korrekturschritt machen, also sein bisheriges Erkennungsverfahren korrigieren. Das ist die altbekannte Trial and Error Methode.
Was hat KI mit Nervennetzen zu tun?
KI ist nicht entstanden aus dem Versuch, Nervenzellen mathematisch nachzubilden um dann womöglich unsere Methoden des Denkens nachahmen zu können. Sie werden also im Folgenden nichts über unser Denken erfahren, sondern nur etwas über die Mathematik, die der KI zugrundliegt. Man wird sehen, warum der Anteil der Kreativität der Programmierer an KI immer noch sehr hoch ist.
1958 veröffentlichte der Psychologe und Informatiker Frank Rosenblatt das Konzept des sog. Perzeptrons das ein mathematisches Modell einer Nervenzelle darstellt. Dieses Konzept begründete eine der wichtigsten Methoden der Künstlichen Intelligenz, die ich kurz vorstellen möchte.
Nervenzelle und ihre abstrakte Struktur
Die Dendriten leiten die ankommenden Aktionspotentiale zur Nervenzelle, das Axon leitet es weiter zu nachfolgenden Zellen. In jedem Falle erfolgt die Kopplung über Synapsen.
Die Synapse
In der Synapse befindet sich ein sehr schmaler Spalt, über den das elektrische Potential durch chemische Prozesse weitergeleitet wird. Dadurch entsteht ein gewisser elektrischer Widerstand und durch ihn eine Gewichtung des ankommenden Aktionspotentials für die Erzeugung des Aktionspotentials in der nachfolgenden Zelle.
Entscheidend für die Kopplung der Neuronen sind die Gewichtungen, mit denen die Aktionspotentiale von einem Neuron zum nächsten übertragen werden bzw. mit denen die Synapsen arbeiten. In ihnen drückt sich praktisch das chemisch gespeicherte Wissen einer Nervenzelle aus. Damit kann man ein mathematisches Modell einer Nervenzelle formulieren:
Mathematisches Modell eines Neurons: Das Perzeptron
Mit x sind die Inputsignale bezeichnet und mit w die Gewichte, die durch die Synapsen realisiert werden. Der Output ist 1, wenn die gewichtete Summe aller Inputs größer als 0 ist, ansonsten -1
Man kann diese Bausteine auch hintereinanderschalten, so dass die Ausgänge von einigen Zellen die Eingänge der nächsten sind, es entsteht ein Nervennetz.
Dieses mathematische Modell ist tatsächlich außerordentlich einfach, es ist lediglich eine Rechenvorschrift für die Entscheidung, ob ein Punkt im n+1 - dimensionalen Raum auf der einen oder anderen Seite einer Hyperebene liegt. Außerdem hat es nur ein minimales ‚Gedächtnis‘, die Parameter der Hyperebene. Das Modell wird natürlich wesentlich komplizierter, wenn man Nervennetze aus vielen Neuronen betrachtet, dann bestehen Ähnlichkeiten mit sog. abstrakten Automaten [104].
Einfaches Beispiel eines Nervennetzes: feed forward perceptron
Jeder Punkt in dieser Grafik entspricht einem Perzeptron, das gesamte Netz besteht aus 3 Schichten. Heute wird in der Literatur die Bezeichnung Perzeptron für ganze Netze verwendet, daher hier feed forward perceptron.
Wie kann ein Perzeptron lernen?
Das Wissen einer Nervenzelle sind die synaptischen Gewichtungen, weshalb Lernen Einstellen bzw. Ermitteln dieser Gewichte bedeutet. Nehmen wir einmal an, dass das Perzeptron erlernen soll, den Buchstaben A zu identifizieren, d.h. zu entscheiden, ob ein gegebener Buchstabe ein A ist oder nicht. Dazu bieten wir dem Perzeptron eine Folge von Buchstaben an. Wenn es einen Fehler macht, also ein A nicht erkennt oder einen anderen Buchstaben fälschlich als A ansieht, korrigieren wir die Gewichte, ansonsten lassen wir sie unverändert.
Im o.g. mathematischen Modell besteht der Input eines Perzeptrons aus Zahlen, um also ein A eingeben zu können, muss man es in Pixel zerlegen und das sind Zahlen. Ebenso kann man ganze Bilder codieren und ein Perzeptron damit füttern, was in der Tat bei vielen Anwendungen geschieht.
Die entscheidende Frage besteht darin, ob diese Trial and Error Lernmethode überhaupt zu einem Ziel führt, ob das Lernziel auf diese Weise überhaupt erreichbar ist. Die Leistung von Rosenblatt bestand darin, dass er Korrekturformeln für die Gewichte angegeben und bewiesen hat, dass das Verfahren zum Ziel führt, man sagt, es konvergiert [105].
Das war 1958 und eigentlich der Beginn der KI. Viele waren davon begeistert aber ebenso viele sahen es als eine Anmaßung an, diesen einfachen Formalismus als eine künstliche Intelligenz zu bezeichnen. Außerdem stellte sich sehr bald heraus, dass das Verfahren nur unter sehr strengen Voraussetzungen konvergiert, die in der Praxis kaum erfüllt sind. Man versuchte dann das Lernverfahren zu verbessern, so dass es bei möglichst vielen praktischen Aufgabenstellungen verwendbar war. Viele Jahre lang gelang das nicht und erst 1986 veröffentlichten David E. Rumelhart u.a. den sog. back-propagation Algorithmus, der zum Ziel führte.
Neben vielen Vorteilen haben die o.g. Methoden aber weiterhin gravierende Nachteile, z.B.
Bei vielen praktischen Aufgaben kann man die zu untersuchenden Objekte durch verschiedenste Eigenschaften beschreiben, die als Input für das Netz verwendbar sind. Es kann aber sein, dass gewisse Eigenschaften für die zu lösende Aufgabe unwichtig sind oder dass wichtige Eigenschaften fehlen. Z.B. kann es ungenügend sein, Bilder nur durch sehr grobe Pixel darzustellen. In unserem Gehirn werden Bilder nicht nur durch Pixel beschrieben, sondern auch durch Helligkeit, Kontrast, Gradienten, auftretende Linienmuster, Abstand zum Betrachter oder Änderungen durch Bewegung. Für alle diese Merkmale gibt es im Gehirn verschiedene Zentren für ihre Auswertung (sog. Kerne). Wenn man unpassende Eigenschaften für die Beschreibung der Objekte und die Eingabe in das Netz verwendet, wird man keine Lösung bekommen.
Die Anzahl der Schichten und der Knoten (d.h. einzelne Perzeptrons) in jeder Schicht sowie die Art ihrer Verknüpfung bezeichnet man als die Netztopologie. Selbstverständlich hängt das Lernergebnis stark von dieser Topologie ab. Es gibt aber keine Methode, um eine günstige Topologie zu entwerfen, man kann das nur raten und ausprobieren. Das macht das Ganze sehr aufwändig und schwerfällig.
Man sieht, dass die Kreativität der Programmierer sehr gefragt ist. Andererseits waren diese Lernmethoden seit Anfang der 90er Jahre sehr erfolgreich. Beispiele sind Erkennung von Handschrift (Adressen auf Briefen!), Gesichtserkennung (Passkontrolle!), Spracherkennung, teilautonomes Fahren von Fahrzeugen, wahrscheinlich auch Einsatz von Drohnen.
Derartige Erfolge wurden erreicht für Neuronale Netze mit sehr vielen (und unterschiedlich strukturierten) ‚Neuronen‘ in unterschiedlicher Verschaltung, für die es gelang, konvergierende Lernalgorithmen zu entwickeln. Ein einzelnes Perzeptron kann das natürlich nicht leisten, der back-propagation Algorithmus spielt aber immer noch eine sehr wichtige Rolle.
Eine grundlegende Beschränkung dieser Lernmethoden bleibt bestehen: Sie bleiben abhängig vom betrachteten Problemkreis und der dazugehörigen Lernstichprobe. Z.B. kann man nicht verlangen, dass dasselbe KI-System sowohl Gesichter erkennt als auch Verkehrszeichen und Schreibschrift. Für die Gesichtserkennung spielen biometrische Daten (Augenabstand) eine Rolle, für Verkehrszeichen ihre Farbe und Form und für Schreibschrift ist es entscheidend, die einzelnen Buchstaben und Wörter voneinander zu isolieren. Für jede dieser Aufgaben gibt es spezielle Lösungen aber keine allumfassende. Noch schwieriger wäre es, wenn man von einer KI verlangen würde, eine Klasse weiterer Objekte identifizieren zu können, für die sie gar nicht trainiert wurde. Das könnte man dann fast schon als Kreativität bezeichnen.
Können Computer denken?
Wir haben hier nur eine, allerdings sehr wichtige Methode Künstlicher Intelligenz vorgestellt, es gibt weitere. Man kann sich nun die Frage stellen, wie sich KI-Methoden von bisherigen Computeranwendungen unterscheiden. Warum sollten sie so viel besser sein und sogar „intelligent“?
Eine klassische Computeranwendung im wissenschaftlichen Bereich ist die Lösung eines linearen Gleichungssystems. Dafür gibt es Formeln, die man in vorgegebenen Arbeitsschritten anwenden muss. Man sagt, es gibt eine Lösungsmethode oder ein Lösungsmodell. Wenn dann ein lineares Gleichungssystem mit konkreten Zahlen gegeben ist, kann man mit der allgemeinen Lösungsmethode eine Lösung berechnen. Man könnte dann sagen, der Computer hätte das Problem gelöst. Dies ist aber keine kreative oder gar schöpferische Lösung, denn der Computer hat nur eine vorher bekannte (und einprogrammierte) Rechenvorschrift abgearbeitet. Die eigentliche schöpferische Arbeit liegt darin zu beweisen, dass die Rechenvorschrift alle möglichen linearen Gleichungssysteme löst und darin, den Computer entsprechend zu programmieren. Ebenso verhält es sich mit neuronalen Netzen. Die eigentliche kreative Leistung bestand darin, die Konvergenz der Lernmethode zu beweisen und sie auf den Rechner zu bringen.
Wir haben also zwei Arten von Problemlösung vor uns: Die Entwicklung einer Lösungsmethode für eine ganze Klasse von Problemen (allgemeine Lösungsformeln für lineare Gleichungssysteme, allgemeine Korrekturformeln für das Lernen in neuronalen Netzen) und die Lösung eines konkreten Problems aus dieser Klasse. Die erste Form erfordert Ideen und Kreativität, die zweite nur Logik.
Die eigentliche Lösung liegt in der Entwicklung der Lösungsmethode und das ist eine mathematische Arbeit und eine Arbeit des Programmierers. Somit löst ein Computer keine Probleme, sondern berechnet nur (stumpfsinnig) eine Lösung nach dem vorgegebenen Verfahren. Ich habe noch keinen Computer gesehen, der im schöpferischen Sinne je ein Problem gelöst hätte, auch keinen, der Algorithmen der künstlichen Intelligenz anwendet.
Das heißt, dass KI – bisher – NICHT bedeutet, dass Computer kreativ-schöpferisch arbeiten können, sie bleiben Logikmaschinen. Der Begriff Künstliche Intelligenz ist insofern irreführend.
Der große Vorteil der KI-Methoden besteht darin, dass erstmalig die Fähigkeit zum Lernen auf Computern realisiert werden kann und dass sie dadurch für viele Probleme der Praxis anwendbar sind, die bisher nicht lösbar waren.
Beim gegenwärtigen Stand der Dinge muss aber zunächst der Programmierer die zu erlernende Problemlösung durchdringen bzw. selbst einiges lernen (s.o.: Objekteigenschaften, Netztopologie), bevor er die weitere Lernprozedur einer Maschine überlassen kann. Daher benötigen die Autokonzerne, die an der Realisierung des autonomen Fahrens (Level 5) arbeiten, nicht immer weniger Programmierer (weil die Künstliche Intelligenz die Arbeit übernimmt), sondern immer mehr und mehr und das Ziel rückt in immer weitere Ferne.
Auch das Lernen bzw. Trainieren eines neuronalen Netzes ist sehr aufwändig. Im o.g. Fall muss ein mit allen Sensoren (Kameras, Radar, Lidar) sowie einem Computer (mit dem implantierten neuronalen Netz) ausgestatteter Testwagen vorhanden sein. Mehrere Testfahrer müssen nun alle erdenklichen Situationen im Straßenverkehr vorführen, so dass das neuronale Netz die Informationen erhält, wie der Fahrer in jeder Situation reagiert. Man kann sich vorstellen, dass das eine kaum überschaubare Anzahl von Verkehrssituationen ist: Berufsverkehr, Tag/Nacht, Regen/Schnee/Nebel, Stau, Unfall voraus, Fahrräder/Fußgänger/Motorräder, Kreuzungsregelung durch Verkehrspolizisten, Blaulicht/Feuerwehr, Autobahn/Bundesstraße/städtische Nebenstraße ...... Es reicht offensichtlich nicht, dem Computer die Straßenverkehrsordnung einzuprogrammieren.
Bei den bisherigen Beispielen wurde grundsätzlich angenommen, dass das Lernen stattfindet, bevor die Anwendung erfolgt. Bezogen auf das autonom fahrende Auto heißt das, dass der Hersteller eine fertige Lösung anbietet, das Auto lernt also nicht mehr weiter, schon gar nicht eigenständig. Es mag sein, dass mancher das annimmt, wenn von KI und Lernen die Rede ist, das ist aber ein Irrtum. Ich glaube, dass kein Hersteller das Risiko eingehen würde ein Auto zu bauen, das selber ohne Kontrolle in der Welt des Verkehrs versucht, sein eigenes Verhalten zu verbessern. Allerdings wäre es prinzipiell denkbar, dass das Lernen mit Kontrolle fortgesetzt wird. Das Fahrzeug dürfte dann nicht voll autonom fahren, sondern der Fahrer müsste immer bereit sein, in Notfällen die Kontrolle zu übernehmen. Genau diese Situationen müssten dann zur Fortsetzung des Lernprozesses genutzt werden. Vielleicht könnte ein Auto, das noch lernen muss, sogar billiger angeboten werden, der Hersteller würde schließlich davon profitieren.
Eine ähnliche Situation gibt es in der Nuklearmedizin bei der Diagnostik der Myokardischämie (mangelnde Herzdurchblutung) mit Hilfe eines vollautomatischen Diagnoseprogrammes, das auf der Basis von KI-Methoden entwickelt wurde. Das System ist für den Arzt wie ein Kollege, der seine Meinung zum untersuchten Patienten äußert und der Arzt kann das akzeptieren oder korrigieren. Wenn er dann seine endgültige Diagnose wieder in das System eingeben würde (das ist nur ein geringer Aufwand von ein paar Minuten), könnte es weiterlernen. Noch viel größer wäre der Nutzen für das ganze Gesundheitssystem, wenn die Daten von allen das System verwendenden Ärzten zentral erfasst würden und der Lernprozess dann auf einer immer umfangreicheren Datenbasis basieren würde. Das so verbesserte System würde jeder beteiligte Arzt im Gegenzug erhalten. Diese sehr wünschenswerte Verbesserung der Gesundheitsfürsorge scheitert aber an einem Verwaltungsproblem, der Datensicherheit. Offenbar sind viele Beteiligte sehr skeptisch, Patientendaten über das Internet zu schicken, das wird schlicht verboten, obwohl dafür natürlich technische Lösungen denkbar sind.
Man muss feststellen, dass bisherige KI-Anwendungen nicht bedeuten, dass der Computer kreativ-schöpferisch arbeitet, das tun nur die Programmierer.
Für Mathematiker gab es daher einen Grund danach zu fragen, ob schöpferisches Denken überhaupt nötig ist und im Prinzip hat der Mathematiker David Hilbert genau diese Frage gestellt. In der Mathematik herrscht die phantastische Situation, dass man genau sagen muss, welche Aussagen man zugrunde legt, um eine neue Aussage zu beweisen. Oft gibt es sogar einen ‚letzten Grund‘, d.h. eine kleine Menge relativ einfacher Aussagen, auf die man sich stützt, die sogenannten Axiome. Z.B existiert in der Arithmetik das Peanosche Axiomensystem, bestehend aus 5 Axiomen, die definieren, was eine natürliche Zahl ist. Viele wahre Sätze der Arithmetik lassen sich ausschließlich mit Hilfe der Logik aus diesen Axiomen herleiten. Für die Euklidische Geometrie gelang David Hilbert sogar der Nachweis, dass sich alle wahren Aussagen aus einer von ihm angegebenen Menge von Axiomen herleiten lassen. Eines dieser Axiome ist das Parallelenaxiom, das völlig unseren anschaulichen Vorstellungen von der Parallelität zweier Geraden entspricht. Der Mathematiker Riemann hat dieses Axiom einmal weggelassen und nachgesehen, was dann noch an wahren Aussagen übrigbleibt. Es ergab sich die sog. Riemannsche Geometrie und plötzlich stellte sich heraus, dass Einstein genau diese Beschreibung benötigte für die Formulierung seiner Relativitätstheorie.
Zurück zu Hilbert. Er stellte auf einem Mathematikerkongress die Forderung auf, für alle mathematischen Theorien eine axiomatische Grundlegung zu ermitteln, kurz, er forderte ein Axiomensystem für die ganze Mathematik.
Was hätte das für Konsequenzen? Bildlich gesprochen wäre es dann möglich, diese Axiome einem Computer zu übergeben und ihn alle wahren mathematischen Sätze nur durch Anwendung der Logik ableiten zu lassen. Damit wäre bewiesen, dass Kreativität nicht mehr nötig ist!
Wir müssen uns aber keine Sorgen machen, schöpferisches Denken wird niemals ersetzbar sein. Den Beweis dafür lieferte der Mathematiker Kurt Friedrich Gödel (1906 – 1978). Er zeigte, dass ein formales System von Aussagen nicht gleichzeitig logisch widerspruchsfrei und vollständig sein kann, d.h., das von Hilbert geforderte Axiomensystem existiert nicht! Übrigens ist schon das Peanosche Axiomensystem nicht vollständig, d.h., es gibt arithmetische Aussagen, die sich aus diesen Axiomen weder beweisen noch widerlegen lassen.
Schöpferisches Denken wird also immer nötig sein und wir können zusammenfassen: Computer können nicht wirklich denken, ihnen fehlt – bis jetzt - die Kreativität.
Es könnte aber sein, dass Computer uns gegenüber in der Zukunft einen unüberbrückbaren Vorteil haben. Wenn es gelänge, unser Wissen über die Welt in ein computerlesbares, universelles Format (analog dem Format von Begriffen in unserem Gehirn) zu bringen, wäre ihr Lerntempo beim Einspeichern dieses Wissens so hoch, wie wir es niemals erreichen werden. Unsere schulische und berufliche Ausbildung dauert gegenwärtig 11 bis 20 Jahre, um das Wissen unserer Vorfahren – teilweise – aufzunehmen, vielleicht könnten Computer das in ein paar Tagen erledigen.
Aber Achtung: Der Begriff ‚Wissen‘ fokussiert auf die ‚Bedeutung‘ einer Information und man muss die formale Darstellung einer Information unterscheiden von dem bezeichneten Objekt/Verhältnis/Erscheinung in der Realität. Da unser Wissen sich auf die Realität bezieht, in der wir leben, müssten Computer ein Verständnis für diese Realität haben, sie müssten eigentlich selbst in ihr existieren. Das ist aber gegenwärtig nicht der Fall, jetzige Computer/Roboter/Handys/Navigationsgeräte ‚leben‘ in einer vollkommen eigenen, wohl definierten, begrenzten Umwelt, nur deshalb sind sie erfolgreich.
Gegenwärtig gibt es einen Hype um den Chatbot ChatGPT, der eine sehr hohe Leistungsfähigkeit erreichte um Fragen zu vielen Wissensgebieten zu beantworten. Er ist sogar in der Lage, zu vorgegebenen Themen umfangreiche Texte zu liefern, z.B. zu einem schulischen Thema einen Hausaufsatz zu schreiben. Bei all dem handelt es sich aber um formale, bereits codierte Informationen etwa wie in einem Lexikon. Der Bot hat weiterhin keine Ahnung von dem, was er da beschreibt ebenso wenig wie ein Navi, das nicht weiß was eine Straße ist. Es scheint aber so zu sein, dass Chatbots aufgrund riesiger Datenbasen und spezialisierter Software auf bestimmten Gebieten zu Problemen Informationen darstellen können, sodass man nicht mehr unterscheiden kann, ob sie ein Mensch oder Chatbot geliefert hat. Bisher ist es aber so, dass vorher die Programmierer in ein solches Gebiet eindringen müssen und ihr Verständnis dann dem Computer einprogrammieren, d.h. die schöpferische Leistung liegt bei den Programmierern. An der Börse sind KI Methoden schon längere Zeit ein Thema, seitdem aber ChatGPT eine so hohe Aufmerksamkeit fand beschloss Alphabet, eine entsprechende KI Abteilung für Anwendungen an der Börse zu gründen, ChatGPT war offenbar nicht schlau genug für dieses Gebiet. Die Welten, in denen KI-Systeme „leben“, sind offenbar immer noch klar umgrenzt und künstlich.
Nach Gödels Theorie können Computer unser schöpferisches Denken nicht ersetzen, es bleibt daher die Frage, wie in unserem Denken eigentlich Kreativität realisiert wird. Wie finden wir Lösungen für ein Problem, dem wir noch niemals im Leben begegnet sind? Wenn wir das besser verstehen, könnten wir diese Fähigkeit vielleicht doch in gewissem Maße den Computern verleihen, so dass sie intelligenter werden?
Im nächsten Kapitel werde ich darstellen, dass Kreativität vom Unterbewusstsein realisiert wird, es käme also darauf an, die Gefühlswelt des Unterbewusstseins zu erforschen.
1.2 Grundlagen
Jede Form von Intelligenz bedeutet auch Informationsverarbeitung, aber wann und warum kam Informationsverarbeitung eigentlich in die Welt?
Informationsverarbeitung und Genetik
In der Biologie ist Informationsverarbeitung die grundlegende, dominierende Erscheinung, ohne Informationsverarbeitung gibt es kein Leben. Watson und Crick entdeckten 1953 den Träger der Erbinformationen, die Doppel Helix Struktur der DNA. Jede Zelle besitzt diese Erbinformationen und benötigt sie zur Produktion von Proteinen. Ein grundlegender Mechanismus ermöglicht die Verdopplung dieses Riesenmoleküls und damit die Zellteilung, also die Selbstkopie einer Zelle. Um ein benötigtes Protein herzustellen, wird die notwendige Teilinformation von der DNA abgelesen und in eine sogenannte Messenger RNA kopiert. Dieses Molekül wandert zu einem Ribosom genannten Zellbestandteil, in dem die entsprechende Proteinsynthese stattfindet. Man kann daher das Ribosom als Zentralprozessor der Zelle auffassen, in dem die in der DNA gespeicherte Information verarbeitet wird. Seit Beginn der Existenz von Leben werden Informationen also chemisch gespeichert und auch chemisch verarbeitet. Diese Form der Informationsverarbeitung ist als sehr logisch zu charakterisieren, das zu produzierende Proteinmolekül ist eindeutig genetisch definiert und seine Produktion ist zwingend. Ein komplexer Satz von Molekülstrukturen (z.B. Chlorophyll, Enzyme) ist erforderlich, um eine Zelle etwa in die Lage zu versetzen, die Energie von Lichtphotonen in chemische Energie umwandeln zu können, eine Meisterleistung der Evolution.
Ein umfangreiches Wissen ist genetisch wie in einer Datenbank gespeichert, wie und in welcher Reihenfolge alle notwendigen Stoffsynthesen ablaufen müssen. Die synthetisierten Stoffe sind die Endprodukte des Prozesses, der Prozess selbst ist die Informationsverarbeitung.
Neben diesem Prozess innerhalb von Zellen trat aber immer eine zweite Ebene der Informationsverarbeitung auf. Jedes Lebewesen benötigt Nährstoffe um auf der Grundlage der DNA körpereigene Stoffe überhaupt herstellen zu können. Diese Nährstoffe muss es in der Umwelt finden und dazu ist es gezwungen, Informationen zu gewinnen und zu verarbeiten.
Das soll im Folgenden an zwei Beispielen erläutert werden.
Escherichia coli
Escherichia coli ist ein Bakterium bzw. Einzeller ohne Zellkern. Der Neurobiologe und Hirnforscher Gerhard Roth beschreibt die Fähigkeiten dieses Wesens so:
Auf der Membran von E. coli sitzen mehr als ein Dutzend Typen von Chemorezeptoren, die Nahrung und Baustoffe wie Zucker oder Aminosäuren, aber auch Gifte wie Schwermetalle erkennen, und Mechanorezeptoren, mit denen Hindernisse wahrgenommen werden.
Die Flagellen - E. coli besitzt davon sechs Stück - sind 15 bis 20 Nanometer dicke Proteinfäden, die im und gegen den Uhrzeigersinn rotieren können. Dies besorgt ein in der Membran sitzender Flagellenmotor von nur 45 Nanometer Durchmesser, der zu den technischen Meisterwerken der Natur gehört. Es handelt sich um einen Motor, den ein von außen nach innen verlaufender Protonenstrom antreibt, ähnlich wie bei einer Turbine.
Dieser Bewegungsapparat funktioniert höchst trickreich: Sobald die Nahrungsrezeptoren die Gegenwart von Nahrung, zum Beispiel Glucose, registriert haben, lagern sich die 6 Flagellen zusammen und beginnen gegen den Uhrzeigersinn zu rotieren, was das Bakterium vorantreibt. Nach etwa einer Sekunde überprüfen die Chemorezeptoren, ob sich die Konzentration der Nahrung erhöht hat. Ist dies der Fall, so wird die Bewegung in der bisherigen Richtung fortgesetzt. Nimmt hingegen der Gradient ab, oder melden Giftrezeptoren die Anwesenheit schädlicher Substanzen, dann lösen sich die Flagellen voneinander und beginnen unabhängig voneinander im Uhrzeigersinn zu rotieren, dies führt dazu, dass das Bakterium 'taumelt', das heißt sich ungerichtet bewegt, aber nur für sehr kurze Zeit von - im Durchschnitt 0,1 Sekunden. Danach setzt wieder die Rotation gegen den Uhrzeigersinn ein, und das Bakterium bewegt sich in eine neue, zufällige Richtung. [106 S.80]
Die Rezeptoren steuern und prüfen die neue Richtung genauso wie beschrieben, so dass das Bakterium immer Nahrung sucht und Gifte vermeidet. Durch die Mechanorezeptoren ist es möglich, auch Hindernissen auszuweichen.
Wir haben bei E. coli also schon eine Trennung von Sensorium und Motorium vor uns - eine Trennung, die aller komplexen Verhaltenssteuerung zugrunde liegt. [106 S.81]
Im Weiteren stellt Roth den intrazellulären Kommunikationsweg dar, auf dem die Information von den Rezeptoren zum Flagellenmotor gelangt. Dabei wird festgestellt, dass das Bakterium ein Gedächtnis besitzt, zumindest im Sekundenbereich. Es ist sehr beeindruckend, wie detailliert der gesamte chemische Prozess der Informationsverarbeitung aufgeklärt ist.
E. coli besitzt kein Nervensystem, keinen Verstand und keine Einsicht, sein Verhaltensrepertoire ist von genialer Einfachheit. [106 S.84]
Für das Leben von E. coli sind also chemische Gradienten in seiner Umwelt entscheidend, d.h. Konzentrationsunterschiede von Nahrungs- und Giftstoffen. Dazu muss mit Hilfe der Rezeptoren nicht nur die Konzentration bestimmter Stoffe in der Umwelt messbar sein, sondern auch der Gradient, also der Unterschied zur Konzentration zu einem früheren Zeitpunkt – die also gespeichert werden muss. Das leisten die Rezeptoren und geben dann ihre Messresultate in Form chemischer Signale weiter. Die Codierung ist damit für jeden einzelnen Rezeptor vollzogen. Die Decodierung folgt unmittelbar indem Informationen ausgewertet werden um einen der beiden Arbeitszustände des Motors auszulösen. Es kann z.B. passieren, dass sowohl die Konzentration der Nährstoffe als auch der Giftstoffe ansteigt, dann wird offenbar, dass es sich um einen Entscheidungsprozess bzw. um Informationsverarbeitung handelt.
Man muss sich klar machen, dass E.coli eines der einfachsten Organismen unserer Welt ist und dennoch ein verhaltenssteuerndes System darstellt, das Informationsverarbeitung betreibt. Obwohl es ein recht einfaches Verhalten zeigt, ist dieses nicht durch physikalische Gesetze beschreibbar, es gibt keine Möglichkeit, sein Verhalten vollständig für ein längeres Zeitintervall vorherzusagen. E.coli ist eine prokaryotische Zelle, d.h., sie besitzt keinen Zellkern und hat ein 10.000-fach kleineres Volumen als eukariotische Zellen, aus denen Pflanzen und Tiere bestehen. Dennoch ist es in der Lage, sich selbständig Nahrung zu suchen und sich zu vermehren. Es kommt übrigens im menschlichen und tierischen Darm vor.
Bereits bei diesem einfachen Lebewesen gibt es ein Sensorium und ein Motorium und beide sind gekoppelt durch Information und Informationsverarbeitung! Beides ist biochemisch realisiert. Der einzige Zweck, den das Wesen verfolgt, ist das eigene Überleben und die Fortpflanzung. Dies scheint simpel zu sein, erfordert aber eine völlig neue Entität, die es vor der Entstehung des Lebens nicht gab: Informationsverarbeitung.
E.coli ist ein sehr gutes Modell für ein System das sein Verhalten steuert, allerdings noch nicht als intelligent bezeichnet werden kann.
Vielzeller Hydra
Eine weitere Stufe der Komplexität der Informationsverarbeitung wird erreicht bei Vielzellern, die ein Nervensystem besitzen und eines der einfachsten Beispiele dafür ist der Süßwasserpolyp Hydra.
Den größten Anteil der Zellen der Außenhaut bilden Epithelmuskelzellen, die längs des Körpers angeordnet sind. Dadurch kann sich der Polyp schnell zusammenziehen. Auch die Innenhaut, die einen Hohlraum umschließt, enthält Muskelzellen, die aber ringförmig angeordnet sind. Kontrahieren sie, streckt sich der Körper. Der Hohlraum hat die Aufgaben eines Verdauungstraktes als auch eines Gefäßsystems, er wird daher als Gastrovaskulartrakt bezeichnet.
Hydra besitzt einige spektakuläre Besonderheiten:
In der Außenhaut befinden sich an jedem Tentakel ca. 3000 Nesselzellen in 4 verschiedenen Arten. Wenn ein Opfer die Tentakel berührt, schießt innerhalb von 3 Mikrosekunden aus einer Nesselzelle eine Kapsel heraus, die Gift enthält und das Opfer lähmt oder tötet.
Die Fortpflanzung ist geschlechtlich (die meisten Polypen sind Zwitter) oder ungeschlechtlich möglich durch Knospung, Längs- oder Querteilung.
Hydra besitzt unter idealen Bedingungen eine Lebenserwartung von mehreren hundert Jahren, d.h., es gibt praktisch keinen Alterungsprozess.
Hydra vulgaris
In der Haut des Polypen liegt ein Nervennetz ohne Ganglien oder ein Gehirn. Es gibt Sinneszellen für chemische, mechanische und elektrische Reize sowie Licht und Temperatur. Die Nahrung besteht aus Plankton und anderen Kleintieren des Wassers, die mit Hilfe der Tentakel gefangen und in die Mundöffnung geführt werden.
Autor: Corvana File: Hydravulgaris.jpg CC BY-SA 3.0 Verkleinert, Farbskala Grautöne
Fortbewegung von Hydra per Überschlag. Sie kann sich etwa 2 cm pro Tag fortbewegen.
Hydra ist also ein Jäger, obwohl dieses Tier kein Gehirn besitzt. Das Nervennetz steuert wie bei allen Tieren die Muskulatur und die externen Reaktionen auf Sinnesreize (Nesselzellen), es liegt wiederum zwischen Sensorik und Motorik. Beeindruckend ist die Vielfalt der Sinneswahrnehmungen.
Der Neurologe und Bewusstseinsforscher Antonio Damasio richtet die Aufmerksamkeit auf die Nervenzellen, die das Gastrovaskularsystem steuern. Die ringförmige Muskulatur muss so arbeiten, dass Nahrung hineingelangt und Verdauungsrückstände durch den Mund wieder hinaus transportiert werden.
Die Nervennetze aktivieren entlang des Verdauungstraktes ... Peristaltikwellen, die sich bei genauerem Hinsehen nicht sonderlich stark von unseren eigenen unterscheiden, und sorgen so für den Substanztransport. [107]
Er weist darauf hin, dass die Nervennetze
...homöostatische Notwendigkeiten mit den Verhältnissen der äußeren Umwelt in Einklang bringen.
Dies leisten sie, obwohl Hydra kaum ein Gedächtnis hat und demzufolge auch kaum Lernen kann. Es ist also ein Wesen mit Nerven aber ohne Geist.
Zu den kognitiven Fähigkeiten, die bereits E.coli besitzt, also
Wahrnehmung und Aufmerksamkeit,
Erinnerung und
Problemlösen
Kommt hinzu die
Wahrnehmung von Objekten,
Orientierung im Raum, die den verschiedenen Bewegungsmöglichkeiten zugrunde liegt.
Offenbar ist für diesen Zuwachs an Fähigkeiten ein Nervennetz erforderlich. Die Steuerung eines Muskelsystems ist ein komplizierter Vorgang, der in einer bestimmten zeitlichen Reihenfolge und in Zusammenarbeit verschiedener Muskelsegmente realisiert werden muss (s. obige Darstellung). Das sind praktisch Algorithmen und keine einfachen logischen Entscheidungen. Vor der Bewegung muss zunächst ein Grund für diesen Aufwand ermittelt worden sein, was natürlich auf den Sinneseindrücken basiert und einer entsprechenden Schlussfolgerung über die Umwelt. Einen solchen Gesamtprozess können vermutlich nur Nervensysteme steuern.
Ein weiterer Aspekt ist, dass Hydra als ein Vielzeller Nervennetze zu seiner eigenen Organisation benötigt. Das folgt schon aus der Notwendigkeit, den Gastrovaskulartrakt u.a. mit Hilfe von Peristaltikwellen der Ringmuskulatur zu steuern.
Informationsverarbeitung und Leben
Man sieht an den o.g. Beispielen, dass bereits für die einfachsten Lebewesen die Erfassung von Informationen über die Außenwelt entscheidend ist für die Identifikation und Aufnahme von Nahrung. Auf dieser Grundlage können, mit Hilfe der in der DNA gespeicherten Informationen, die für das Leben benötigten Stoffe hergestellt werden. Völlig analog ist die Fortpflanzung von der Informationsverarbeitung abhängig.
So ist das Leben von Anfang an mit dem Prinzip der Informationsverarbeitung verbunden.





























