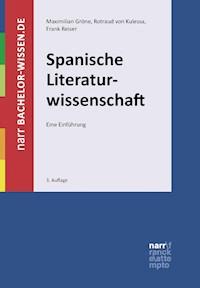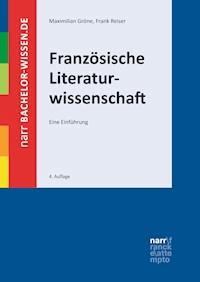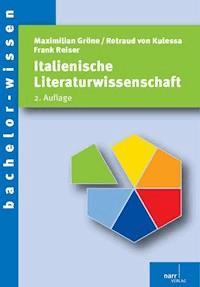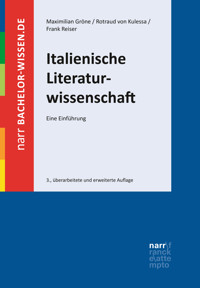
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Narr Francke Attempto Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: bachelor-wissen
- Sprache: Deutsch
Der Band bachelor-wissen Italienische Literaturwissenschaft richtet sich speziell an die Studierenden und Lehrenden in den literaturwissenschaftlichen Modulen der italienzentrierten Bachelor-Studiengänge. Die anschauliche Aufbereitung des fachlichen Grundwissens wird dabei von anwendungsorientierten Übungseinheiten gerahmt, die eine eigenständige Umsetzung des Erlernten ermöglichen und einen nachhaltigen Kompetenzerwerb unterstützen. Im Zentrum steht dabei einerseits die Methodik der Textanalyse, wobei neben traditionellen literarischen Texten auch das Medium Film mit in die Darstellung einbezogen wird. Im Weiteren werden die zentralen literatur- und kulturwissenschaftlichen Forschungsansätze vorgestellt und damit die notwendige theoretische Basis für eine weiterreichende Textinterpretation gelegt. Der Veranschaulichung, Vertiefung und Anwendung dienen durchgängig originale Textauszüge und themenspezifische Aufgaben. Unter www.bachelor-wissen.de steht ferner eine Plattform für ergänzende Materialien zu den Lektionen des Bandes und für den Zugriff auf die Übungslösungen bereit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 520
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Maximilian Gröne / Rotraud von Kulessa / Frank Reiser
Italienische Literaturwissenschaft
Eine Einführung 3., überarbeitete und erweiterte Auflage
PD Dr. Maximilian Gröne ist Akademischer Oberrat für Romanische Literaturwissenschaft an der Universität Augsburg.
Prof. Dr. Rotraud von Kulessa ist ordentliche Professorin für Romanische Literaturwissenschaft an der Universität Augsburg.
Dr. Frank Reiser ist Akademischer Oberrat am Romanischen Seminar der Universität Freiburg i. Br.
Idee und Konzept der Reihe: Johannes Kabatek, Professor für Romanische Philologie mit besonderer Berücksichtigung der iberoromanischen Sprachen an der Universität Zürich.
narr BACHELOR-WISSEN.DE ist die Reihe für die modularisierten Studiengänge
die Bände sind auf die Bedürfnisse der Studierenden abgestimmt
das fachliche Grundwissen wird in zahlreichen Aufgaben vertieft
der Stoff ist in die Unterrichtseinheiten einer Lehrveranstaltung gegliedert
auf www.bachelor-wissen.de finden Sie begleitende und weiterführende Informationen zum Studium und zu diesem Band
3., überarbeitete und erweiterte Auflage 2024
2., aktualisierte Auflage 2012
1. Auflage 2007
DOI: https://doi.org/10.24053/9783381124121
© 2024 • Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KGDischingerweg 5 • D-72070 Tübingen
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Alle Informationen in diesem Buch wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Fehler können dennoch nicht völlig ausgeschlossen werden. Weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen übernehmen deshalb eine Gewährleistung für die Korrektheit des Inhaltes und haften nicht für fehlerhafte Angaben und deren Folgen. Diese Publikation enthält gegebenenfalls Links zu externen Inhalten Dritter, auf die weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen Einfluss haben. Für die Inhalte der verlinkten Seiten sind stets die jeweiligen Anbieter oder Betreibenden der Seiten verantwortlich.
Internet: www.narr.deeMail: [email protected]
ISSN 1864-4082
ISBN 978-3-381-12411-4 (Print)
ISBN 978-3-381-12413-8 (ePub)
Inhalt
Vorwort zur dritten, überarbeiteten und erweiterten Auflage
Die modularisierten Studiengänge der Italoromanistik an den deutschsprachigen Universitäten haben in den letzten Jahrzehnten eine konzeptuelle Umgestaltung erfahren. Dies ist nicht zuletzt eine Folge der sog. Bologna-Reform, die auf eine größere Vergleichbarkeit der Studienanforderungen abzielt, vor allem aber auch eine Entwicklung von fachlichen Wissensständen hin zu einem kompetenzorientierten Lehren und Lernen einfordert. Dem entspricht der Grundgedanke der Reihe bachelor-wissen, die auf die Vermittlung der grundlegenden wissenschaftlichen Theorien und Analysemethoden ausgerichtet ist. Der Stoff ist in 14 thematischen Einheiten auf die Kernlänge eines Semesters abgestimmt und ermöglicht die Strukturierung entsprechender universitärer Lehrveranstaltungen. Die Herangehensweise setzt auf eine fachlich-anspruchsvolle, zugleich jedoch verständliche Darstellung, die auf anschauliche Beispiele zurückgreift. Dabei sollen das Verständnis für zentrale fachliche Leitfragen und Problemfelder hervorgerufen werden, Techniken im Umgang mit literarischen und filmischen Texten vermittelt und eingeübt werden und durch die Möglichkeit der Selbstkontrolle ein nachhaltiger Effekt erreicht werden. Einen besonderen Stellenwert haben in diesem Zusammenhang die zahlreichen Aufgaben in den einzelnen Abschnitten, welche mit den zugehörigen und auf der websitewww.bachelor-wissen.de abrufbaren Musterlösungen einen interaktiven Zugang zu den Themen des Bandes eröffnen. Die vier textanalytischen und gattungsspezifischen Einheiten 4, 6, 8 und 13 werden zudem jeweils durch spezielle Übungs- und Vertiefungseinheiten ergänzt, welche die vorgestellte Methodik exemplarisch anwenden und intensiviert Übungsgelegenheiten anbieten. Eine weitere Vertiefung der behandelten Aspekte findet sich in Form von Zusatzmaterialien ebenfalls auf www.bachelor-wissen.de.
Der vorliegende Band der Reihe bachelor-wissen eignet sich gleichermaßen für den akademischen Unterricht wie für das Selbststudium. Er versteht sich als eine möglichst universell einsetzbare Einführung in die analytische Methodik der italoromanistischen Literatur- und Filmwissenschaft. Darüber hinaus werden wesentliche literatur- und kulturwissenschaftliche Theorien erläutert und bilden die Grundlage für den fachwissenschaftlich kompetenten Umgang mit Texten in den weiteren Studienabschnitten. Die vorliegende dritte Auflage wurde sorgfältig aktualisiert, überarbeitet und um umfangreiche Partien erweitert.
Augsburg/Freiburg i.Br., August 2024
Rotraud v. Kulessa, Maximilian Gröne und Frank Reiser
Kompetenz 1: Literaturwissenschaftlich denken und arbeiten
1Begriff ‚Literatur‘
Literatur ‚an und für sich‘
1.2Literatur medial
ÜberblickIn diesem ersten Kapitel beschäftigen wir uns mit der Definition von ‚Literatur‘ als Gegenstandsbereich der Literaturwissenschaft. Wir ziehen dazu Beispieltexte aus der italienischen Literatur heran und suchen notwendige oder typische Eigenschaften von Literatur. Anschließend lernen Sie einige medientheoretische Grundlagen von Literatur als Schrift-Kunst kennen.
1.1Literatur ,an und für sich‘
Aufgabe 1.1? Lesen Sie folgende Texte kurz an und überlegen Sie, welche von ihnen Sie zur Literatur im engeren Sinne zählen würden.
Überlegen Sie sich weitere Unterscheidungskriterien neben den bereits angeführten.
1
Text 1.1Benedetto Croce: La poesia (1936) Ma che cosa è poi la letteratura? Quale è la sua definizione, ossia la sua natura, nascimento o genesi nello spirito umano, e con ciò stesso, l’ufficio suo? Ho cercato in molti libri, e in quasi tutti quelli di estetica, di poetica e di retorica, e (sarà stato per non aver cercato bene) non ho trovato risposta alla domanda, o non l’ho
5
trovata soddisfacente; […] E affinché, d’altra parte, l’indagine procedesse con la debita avvedutezza e correttezza, ho cominciato col domandarmi se l’espressione letteraria sia da identificare con uno degli altri quattro modi di espressione […] sentimentale o immediata, la poetica, la prosastica e la pratica od oratoria; per passare poi a ricercare, nel supposto che non s’identifichi, quale sorta di relazione
10
abbia con queste. (Croce: 1953, 1f.)
1
Text 1.2Italo Calvino: Se una notte d’inverno un viaggiatore (1979) Ho riflettuto sul mio ultimo colloquio con quel Lettore. Forse la sua intensità di lettura è tale da aspirare tutta la sostanza del romanzo all’inizio, cosicché non ne resta più per il seguito. A me questo succede scrivendo: da qualche tempo ogni romanzo che mi metto a scrivere s’esaurisce poco dopo l’inizio come se già vi
5
avessi detto tutto quello che avevo da dire. (Calvino: 1979, 197)
Text 1.3Filippo Tommaso Marinetti: Marcia futurista (1916)
1
Text 1.4Gaspara Stampa: Rime (1530) Se, così come sono abietta e vile
donna, posso portar sì alto foco,
perché non debbo aver almeno un poco
di ritraggerlo al mondo e vena e stile?
Abb. 1.1Gaspara Stampa (1523–1554)
5
S’Amor con novo, insolito focile,
ov’io non potea gir, m’alzò a tal loco,
perché non può non con usato gioco
far la pena e la penna in me simile?
9
E, se non può per forza di natura,
pollo almen per miracolo, che spesso
vince, trapassa e rompe ogni misura.
12
Come ciò sia non posso dir espresso;
io provo ben che per mia gran ventura
mi sento il cor di novo stile impresso.
(Stampa: 1995, 71f.)
1
Text 1.5Luigi Pirandello: Sei personaggi in cerca d’autore (1921) IL SUGGERITORE (leggendo c. s.). “Scena Prima. Leone Gala, Guido Venanzi, Filippo detto Socrate.”
Al Capocomico:
Debbo leggere anche la didascalia?
5
IL CAPOCOMICO. Ma si! si! Gliel’ho detto cento volte!
IL SUGGERITORE (leggendo c. s.). “Al levarsi della tela, Leone Gala, con berretto da cuoco e grembiule, è intento a sbattere con un mestolino di legno un uovo in una ciotola, Filippo ne sbatte un altro, parato anche lui da cuoco. Guido Venanzi ascolta, seduto.”
10
IL PRIMO ATTORE (al Capocomico). Ma scusi, mi devo mettere proprio il berretto da cuoco in capo?
IL CAPOCOMICO (urtato dall’osservazione). Mi pare! Se sta scritto li!
Indicherà il copione.
(Pirandello: 1937, 26f.)
Text 1.6Corriere della Sera (16.04.2024) Dacia Maraini: “Segnali di intolleranza. Preoccupa il modo in cui esponenti politici attaccano il libro di Valentina Mira”
1
Che strazio sentire i politici prendersela con un libro che racconta una storia d’amore in un tempo di conflitti sociali e punta la lente sui fatti di Acca Larenzia, quartiere in cui l’autrice ha abitato per anni. Parlo di Valentina Mira e del suo bel libro dal sapore pasoliniano che si intitola Dalla stessa parte mi troverai. […] Il libro
5
racconta la storia dell’amore fra Mario Scrocca, il giovane che dieci anni dopo il fatto, viene accusato di avere partecipato al delitto politico e una sua compagna di scuola del quartiere. Scrocca viene denunciato, arrestato e incarcerato. Ma in prigione, in una cella antisuicidio, muore in circostanze poco chiare, e il caso è chiuso come suicidio. La sua innamorata Rossella, poi diventata sua moglie,
10
continua a sostenere che Scrocca è stato suicidato, come si usava sotto Stalin, e come si usa oggi sotto Putin. (Corriere della Sera, martedì 16 aprile 2024, p. 55)
1
Text 1.7Giovanni Boccaccio: Decameron, 1,3 (ca. 1335–1355) E fattolsi chiamare, e familiarmente ricevutolo, seco il fece sedere e appresso gli disse: – Valente uomo, io ha da più persone intese che tu se’ savissimo e nelle cose di Dio senti molti avanti; e per ciò io saprei volentieri da te quale delle tre Leggi tu reputi la verace, o la giudaica o la saracina o la cristiana.
Abb. 1.2Giovanni Boccaccio (1313–1375)
5
Il giudeo, il quale veramente era savio uomo, s’avvisò troppo bene che il Saladino guardava di pigliarlo nelle parole per dovergli muovere alcuna quistione, e pensò non potere alcuna di queste tre più Luna che l’altra lodare, che il Saladino non avesse la sua intenzione; per che, come colui il qual pareva d’aver bisogna di risposta per la quale preso non potesse essere, aguzzato lo ’ngegno, gli venne
10
prestamente avanti quello che dir dovesse; e disse: – Signor mio, la quistione la qual voi mi fate è bella, e a volervene dire ciò che io ne sento, mi vi convien dire una novelletta, qual voi udirete. Se io non erro, io mi ricordo aver molte volte udite dire che un grande uomo e ricco fu già, il quale, intra l’altre gioie più care che nel suo tesoro avesse, era uno anello bellissimo e prezioso; […] (Boccaccio:
15
2001, 62)
Suche nach Kriterien Ein erster Blick auf die sieben Texte führt dazu, dass wir einige spontan, ohne sie überhaupt eingehend zu lesen, in die Kategorie Literatur einordnen, so die Texte 1.4 und 1.5, die uns aufgrund ihrer Anordnung und des Schriftbildes sofort an ein Gedicht (1.4) und ein Drama (1.5) denken lassen. Diese spontane Einordnung verdanken wir wiederum unserem Vorwissen (vgl. hermeneutischer Zirkel, Einheit 4.1), das unser Bewusstsein für literarische Gattungen (vgl. Einheit 2.2) beeinflusst. Ähnlich verhält es sich mit Text 1.6. Hier verrät uns die Quellenangabe, dass es sich um einen Zeitungsartikel handelt, den wir spontan nicht zur Literatur zählen würden. Unsere Entscheidung wird in allen drei Fällen durch textexternes Wissen bestimmt bzw. durch eine Form von ParatextParatext Paratext (vgl. 11.2.1), d. h. in diesem Fall einen für sich sprechenden Titel, nämlich den einer bekannten italienischen Tageszeitung. Es stellt sich natürlich die Frage, warum ein Presseartikel für uns nicht zur ‚Literatur‘ zählt. Entscheidend ist hier wohl der Aspekt der Erwartung der Leserschaft, die mit der Presse vor allem den Zweck der Information verbindet. Ein weiteres Unterscheidungskriterium wäre also der Zweck oder die Funktion Zweck/Funktion einer schriftlichen Äußerung bzw. eines Textes. Um diesen für die einzelnen Texte zu klären, müssen wir uns nun jeweils ihrem Inhalt Inhalt zuwenden. In allen sieben Texten geht es im weiteren Sinne um die Literatur selbst, um das Schreiben, das Lesen, das Erzählen. Der Inhalt ist als Unterscheidungskriterium also erst einmal nicht sachdienlich. Es kommt hinzu, dass sich der Sinn der Texte 1.3 und 1.4 nicht beim ersten Lesen enthüllt. Erkennen wir Text 1.4 zwar aufgrund formaler Kriterien und aufgrund des Paratextes, nämlich des Titels (Rime), sofort als Literatur, erweist sich Text 1.3 als Problem. Nur vor dem Hintergrund des Titels in Zusammenhang mit literaturhistorischem Wissen erschließt sich der Sinn bzw. Unsinn und damit der Zweck dieses Textes. Der Titel sowie die Nennung des Autors weisen auf die Bewegung des FuturismusFuturismus Futurismus hin, der über die Literatur hinaus alle kulturellen Bereiche Abb. 1.3Vordere Umschlagseite des Buchs Zang Tumb Tumb (1914) von Filippo Tommaso Marinetti der ersten zwei Jahrzehnte des 20. Jh. umfasst. Als Begründer der Bewegung gilt Filippo Tommaso Marinetti (1876–1944), der in Paris mit der französischen Avantgarde-Kultur in Berührung kam. Die Futuristen setzten sich vor allem mit der modernen technischen Entwicklung auseinander und versuchten, Gegenstände und Figuren in Einzelteile zu zerlegen und in ihrer Bewegung darzustellen, wobei die formale Neuerung im Vordergrund stand. Der Titel unseres Textes sowie der Paratext weisen auf die Verbindung zur Musik hin, insbesondere zur Marschmusik, wodurch der Text einen militärischen Charakter erhält. In der Tat haben wir es mit einer Art literarischem Manifest zu tun, das vor allem den Zweck der Provokation erfüllt.
Schauen wir uns nun Text 1.4 an. Auch hier handelt es sich um einen Text über die Dichtung selbst. Gaspara Stampa (1523–1554) verteidigt, wenn auch verschlüsselt, ihre Dichtung und vor allem die Tatsache, dass sie als Frau dichtet. Beide Texte haben eines gemeinsam: die Sprache steht im Mittelpunkt und verweist gleichsam auf sich selbst. Das Gedicht der Gaspara Stampa ist in hohem Maße komponiert bzw. strukturiert. Zunächst durch die Verse, die die Sätze in gleich lange metrische Einheiten (hier Elfsilbler, it. endecasillabo) teilen, dann durch die Strophen (2 Quartette und 2 Terzette, also ein Sonett, it. sonetto), schließlich durch den Reim, der die Worte an den Versenden durch ihren Gleichklang ab der letzten betonten Silbe assoziiert, wodurch sich für den Gesamttext das Schema /abba abba cdc dcd/ ergibt (zur lyrischen Form siehe 4.4). Weiter fallen Besonderheiten in der Sprache sprachlich-stilistischen Gestaltung auf. Schon im zweiten Vers wird der reguläre Rhythmus unterbrochen, indem das Substantiv „Donna“, das eigentlich in Bezug auf die Syntax (Satzbau) und den Inhalt noch in den ersten Vers gehört, in den zweiten Vers herübergezogen wird. Dieses Phänomen bezeichnet man als Enjambement. Das in den folgenden Vers übergehende Element wird damit besonders betont. ,Donna‘, die Frau, erscheint so als ein Schlüsselbegriff für das Verständnis dieses Gedichtes. In der Tat geht es um die Frau als Dichterin. Ebenso begegnen wir Metaphern wie „alto foco“ für die Liebe und Leidenschaft oder Wortspielen (Paronomasien) wie in Vers 8 („la pena et la penna“). Auf der Satzebene werden Verfahren wie das Asyndeton (unverbundene Reihung) eingesetzt, die eine verstärkende Funktion auf den Inhalt ausüben. Allen diesen Eigenheiten ist gemeinsam, dass der Text eine eigentümliche, von der ‚Normalsprache‘ abweichende Sprache verwendet, die sich nicht darauf beschränkt, den Inhalt des Textes darzustellen, sondern auch eine gewisse Aufmerksamkeit auf die Art und Weise dieser Darstellung lenkt. Diese Eigenschaft von Texten bezeichnet man üblicherweise mit dem Begriff Poetizität, poetisch Poetizität Poetizität (poeticità).
Der Grad der Abweichung Abweichung von der Normalsprache wird in Text 1.1 zweifelsohne noch stärker akzentuiert. Der Sinn tritt hier vollkommen hinter die Sprache zurück, die als Einzelsprache nicht mehr zuzuordnen ist. Es handelt sich vielmehr um ein Spiel mit sprachlichen Phänomenen, d. h. mit Buchstaben und Lauten, die in ihrer Kombination aus Lautmalerei (Onomatopöie) und Wortspiel (Paronomasie) den Titel Marcia futurista illustrieren. Der Selbstbezug der Sprache hat hier ein sehr hohes Maß erreicht. Dasselbe gilt für den Grad der Abweichung von der Normalsprache.
Das Moment der Abweichung Deviationsstilistik im Formalismus als Kennzeichen literarischer Texte ist durchaus naheliegend. Es begegnet uns in der verbreiteten Vorstellung, ‚Literatur‘ sei im Gegensatz zu alltäglicher Sprachverwendung eine Form stilistisch anspruchsvollen, ‚guten‘ Schreibens – insgesamt gesehen zumindest, wobei es freilich auch ‚minderwertige‘ Literatur gibt, die diesen Anspruch zwar nicht einlöst, aber dennoch an ihm gemessen werden kann und wird. Auch Literaturwissenschaftler haben auf diesen Gesichtspunkt abgehoben, am nachhaltigsten die russischen Formalisten. ! Formalismus (‚Formale Schule‘): zwischen 1914 und 1930 in Moskau und Leningrad tätige Gruppe von Sprach- und Literaturwissenschaftlern Für sie war es die wesentliche Aufgabe von Literatur, ästhetische Wahrnehmung zu ermöglichen und zu schulen, den Leser ein ‚neues Sehen‘ zu lehren. Voraussetzung dafür war, die eingeschliffenen, gewohnten, ‚automatisierten‘ Wahrnehmungsmuster mit gezielter Verfremdung und Erschwerung der Form zu durchbrechen. Unter weitgehender Absehung vom Inhalt verstanden die FormalismusFormalisten literarische Texte als Summe der ‚Verfahren‘, d. h. (verfremdender) Bearbeitungen des sprachlichen Ausdrucks (was Klang, Bildlichkeit, Rhythmus, Reim ebenso einschließt wie Metaphorik, Satzbau und Erzähltechniken). Dahinter steckt der Gedanke, dass man ein Medium – also hier Sprache, aber die Theorie galt auch etwa für die bildende Kunst und ihre Wahrnehmung – ‚spürbar‘ macht, wenn man von der Ökonomie des praktischen Gebrauchs abweicht, also etwa Sprache nicht so verwendet, wie sie im Alltag benutzt wird, sondern anders, neu – wie dies Stampas Gedicht und Marinettis Manifest tun. Innovation und Abweichung wird so zum entscheidenden Wesensmerkmal ‚poetischer‘ Sprache und damit der Literatur.
Wissen wir nun, was Literatur kennzeichnet? Das Kriterium der Problematik der ‚Abweichung‘Abweichung und Innovation besitzt den bereits erwähnten Vorteil, literarische Texte mit einem formalen Anspruch zu assoziieren, und entspricht zudem einer Menge insbesondere lyrischer Texte; indes hat es Schwächen, die nicht übersehen werden dürfen. Wenn nämlich die Formalisten die innovative Überbietung gewohnter sprachlicher Muster – und das heißt: der jeweils vorhergehenden, etablierten literarischen Verfahren – als Wesen und Auftrag der Literatur bestimmen, dann wird deutlich, dass wir erst dann entscheiden können, ob ein Text ‚literarisch‘ ist, wenn wir wissen, ob und worin er sich von vorhergehenden literarischen Texten unterscheidet, deren Literarizität wir dann wiederum erst in Abgrenzung zur Tradition vor ihnen zu bestimmen haben und so weiter – man kommt so, streng genommen, an kein Ende. Zieht man stattdessen die ‚Alltagssprache‘ als Vergleichsgröße heran, so wird das Sprachempfinden des jeweiligen Lesers der Gegenwart zum ausschlaggebenden Kriterium. Im Falle Calvinos, dessen Texte in relativer zeitlicher Nähe zu uns stehen, mag die dadurch bedingte Verzerrung noch gering sein, bei sehr alten Texten aber zeigt sich rasch, dass der Leser der Gegenwart sehr viel schwerer zu entscheiden vermag, ob ein Text von der damaligen ‚Normalsprache‘ abweicht, also ‚poetisch‘ ist oder nicht (wie z. B. im Fall von Text 1.7) – ganz zu schweigen von anderen Variablen einer jeden Sprache, in der Terminologie der Linguisten etwa diatopische (d. h. regionale), diastratische (sozial-schichtenspezifische) oder diaphasische (anlassabhängige) Varietäten, die es schwer machen, eine ‚Norm‘ und damit die ‚poetische‘ Abweichung festzustellen. Und selbst wenn es ginge, macht einerseits manche Abweichung noch keine Literatur (Dialekte beispielsweise), andererseits gibt es auch Literatur, die keine wesentliche sprachliche Verfremdung erkennen lässt, wie zum Beispiel Text 1.1 und Text 1.2.
Wer diese Texte liest, ‚Imaginatives‘ Schreiben: Fiktionalität wird bei hinreichender Kenntnis des Italienischen zunächst kaum jenen sprachlichen oder formalen Widerstand, jene Verfremdung spüren können, die unser erster Ansatzpunkt auf der Suche nach Literarizität gewesen war. Wenn wir Text 1.1 und 1.2 miteinander vergleichen, stellen wir fest, dass die Texte sich inhaltlich beide mit der Literatur befassen. Der Text 1.1 behandelt gar die Fragestellung dieser Einheit „Was ist Literatur?“, während Text 1.2 von der Beziehung zwischen LeserIn und SchriftstellerIn handelt. Nur beim Weiterlesen von Calvinos Text bemerken wir nach gewisser Zeit den Unterschied. Der Roman bzw. die Romananfänge, von denen in dem Werk Se una notte d’inverno un viaggiatore die Rede ist, existieren in der außersprachlichen Wirklichkeit nicht. Im Gegensatz dazu behandelt Text 1.6 ein real existierendes literarisches Werk, das den LeserInnen der Tageszeitung vorgestellt wird. Mit Text 1.7 assoziieren wir dagegen spontan eine erfundene – und damit literarische – Geschichte. Dies wird vor allem in dem Augenblick offenkundig, als der Jude seine Geschichte als novelletta, also als literarische Gattung, ankündigt. Auch der Text Boccaccios ist im strengen Sinne ‚unwahr‘, erfunden, wie viele andere literarische Texte, die wir üblicherweise lesen. Ihr Kennzeichen ist Fiktion, FiktionalitätFiktionalität.
Fiktion, FiktionalitätFiktionalität Definition (it. fizionalità; Adj. fiktional, it. fizionale) bezeichnet die Darstellungsweise eines Textes, der seinen Inhalt als nicht real existierend präsentiert bzw. seinen Gegenstand erst im Sprechakt (z. B. der Erzählung) selbst schafft. Fiktionalität kennzeichnet den Status einer Aussage.
Fiktivität (it. fìttizietà; Adj. fiktiv, it. fittizio) bezeichnet die Existenzweise von erfundenen, nicht in der Wirklichkeit existierenden Gegenständen. Fiktivität kennzeichnet den Status des Ausgesagten.
Boccaccios Fiktivität und Fiktionalität: nicht immer identisch Text mit dem Titel Decameron ist fiktional, da die von ihm erzählte Welt nicht unabhängig von ihm existiert, er ist aber nicht fiktiv, denn den Text gibt es schließlich in unserer Realität. Die Hauptfiguren in dieser Novelle, der Jude und Saladin, hingegen sind fiktiv. Diese Unterscheidung ist wichtig, da zwar die meisten fiktionalen Texte auch ausschließlich fiktive Figuren darstellen, aber eben doch nicht alle: Historische Romane etwa lassen – teilweise oder durchgehend – realgeschichtliche, also nicht-fiktive Personen auftreten, erzeugen aber die erzählte Welt mehrheitlich selbst, sei es in Gestalt nicht verbürgter Handlungsdetails, sei es durch psychologische Innenansichten einer historischen Person, sie sind also fiktional. Umgekehrt ist nicht jeder Text, in dem fiktive Personen eine Rolle spielen, deswegen gleich fiktional – eine literaturwissenschaftliche Studie, z. B. Text 1.1, etwa versteht sich natürlich als Sachtext, d. h. als nicht-fiktionaler, referenzieller Text (testo referenziale), auch wenn in ihr fiktive Figuren eine wichtige Rolle spielen. Ein mögliches Kriterium für Literarizität eines Textes ist demnach allein seine Fiktionalität, nicht die Fiktivität seiner Bestandteile.
Nun ist es Fiktionalität als nur relative Kategorie nicht immer so einfach, Fiktionalität festzustellen. Meist ist die Entscheidung nicht textintern, sondern allenfalls unter Rückgriff auf textexternes Wissen über die historische Wirklichkeit oder zumindest auf erläuternde Rahmenteile eines Textes, sog. ParatextParatexte (paratesto, m.) wie die klärende Angabe „Roman“ auf dem Titelblatt, zu treffen. Mitunter kann sich der Fiktionalitätsstatus eines Textes sogar ändern: Die Schöpfungsgeschichte des Alten Testaments etwa war über lange Zeit für den abendländischen Kulturkreis zweifellos ein nicht-fiktionaler Sachtext, sogar die ‚Wahrheit‘ schlechthin, heute hingegen wird sie auch als Fiktion gelesen und wohl von der Mehrheit der Leser in westlichen Gesellschaften jedenfalls als nicht im wörtlichen Sinne ‚wahr‘ verstanden. (Zugleich zeigt dieses Beispiel, dass die Entscheidung über Fiktionalität oder Referenzialität, referenziellReferenzialität, so schwierig sie sein mag, mitunter alles andere als ‚egal‘ ist.)
Lassen Sie uns Entpragmatisierung jetzt noch einmal einen Blick auf Text 1.3 werfen, den wir mit dem Kriterium der ‚Abweichung‘ gekennzeichnet hatten. Formal ist der Text von einem alltagssprachlichen Gebrauch extrem weit entfernt. Darüber hinaus drängt sich uns als Leser die Frage auf: „Was wird mit diesem Text eigentlich bezweckt?“ Der Text von Benedetto Croce hingegen entlarvt sich uns schnell als wissenschaftliche Abhandlung. Er möchte mittels literaturwissenschaftlicher Überlegungen den Begriff ‚Literatur‘ definieren. Text 1.3 hat für uns dagegen, von einem gewissen provokativen Effekt einmal abgesehen, erst einmal keinen ersichtlichen Zweck. Er ist ‚entpragmatisiert‘.
Die Funktionale statt essenzialistischer Kriterien Bestimmung von Literatur als Summe derjenigen Texte, die unmittelbaren pragmatischen, also Sach- und Handlungskontexten enthoben sind, stimmt in der Tat gut mit dem gewöhnlichen Verständnis von Literatur überein. Im Gegensatz zu einem Reiseführer über die vor Neapel gelegene Insel Procida würde wohl niemand Elsa Morantes Roman L’isola di Arturo heranziehen, um sich über die Insel zu informieren (wenngleich das durchaus denkbar wäre). Allerdings bedeutet dieser Ansatz, dass wir nicht mehr Merkmale am Text selbst angeben können, die ihn als literarisch kennzeichnen, sondern wir uns vielmehr auf etwas außerhalb seiner, nämlich den Gebrauchskontext berufen, in dem er steht: Wir wechseln von essenzialistischen, also das Wesen eines Textes betreffenden, zu funktionalen Kriterien und erkaufen uns relative Trennschärfe um den Preis, nicht mehr am Text als solchem die Literarizität festzumachen.
Ein Ready-mades besonders eindrückliches Beispiel für die letzte Feststellung sind sog. Ready-madeReady-mades (it. ready-made, m.). Wie der Begriff bereits andeutet, handelt es sich hierbei Abb. 1.4Marcel Duchamp: Fountain (1917) um vorgefertigte bzw. vorgefundene Gegenstände, die – überarbeitet oder nicht, neu kombiniert oder völlig unverändert – aus dem praktischen in einen künstlerischen Kontext ‚verpflanzt‘ werden. Konjunktur hatte dieses Prinzip besonders zur Zeit der künstlerischen Avantgarden in den 1910er bis 1930er Jahren, aber es besteht beispielsweise als Objektkunst bis in die Gegenwart fort. Eines der berühmtesten Ready-mades der Kunstgeschichte, Fountain, zeigt ein Urinal, das, sieht man einmal von der möglicherweise notwendigen Demontage ab, ohne erkennbare materielle Veränderung durch den Künstler Marcel Duchamp zur Skulptur umgewandelt wurde. Es ist klar, dass mit Erreichen einer Kunstauffassung, die diese Art von künstlerischem Schaffen ermöglicht, die Vorstellung von im Kunstwerk inhärenten Wesensmerkmalen überholt wird, und das gilt für alle Kunstformen, auch die Literatur, die natürlich das Ready-made ebenfalls kennt. Die für Duchamps Fountain offensichtlich besonders zentrale Frage ist: Durch welche Faktoren (außer der Position des Urinals und dem Verzicht auf Anschlüsse, die einen ‚pragmatischen‘ Umgang wenig sinnvoll erscheinen lassen) wird eine ‚ästhetische‘ Aufnahme von Artefakten ausgelöst?
Aufgabe 1.2? Unterbrechen Sie für einen Moment die Lektüre und beantworten Sie für sich die zuletzt gestellte Frage in Bezug auf Literatur.
Die Auslösende Faktoren ‚ästhetischer‘ Aufnahme erste und augenscheinlich banalste Antwort lautet, dass Texte als Literatur rezipiert werden, wenn die jeweilige Umgebung sie als solche kennzeichnet; im Falle von Texten macht beispielsweise der Buchdeckel, auf dem „Roman“ steht, den Unterschied, oder auch der mündliche Vortrag bei einer Lesung in einer Buchhandlung, die Aufführung in einem Theater usw. Es gibt also bestimmte mediale und institutionelle Kontexte, Medialer und institutioneller Kontext die gemäß einer (meist unausgesprochenen) kulturellen Vereinbarung EntpragmatisierungEntpragmatisierung und ästhetischen Umgang signalisieren. Ein zweiter wichtiger Faktor ist die Instanz des Urhebers, des Autors, ‚Autor-Funktion‘ (Michel Foucault) für die Kategorisierung eines Textes. Mit Autor, Autorfunktion„Autor“ meinen wir üblicherweise dasjenige Individuum, das einen Text geschrieben hat, aber auf diesen objektiven Zusammenhang beschränkt sich der Begriff nicht, Abb. 1.5Jesse Bransford: Head (Michel Foucault)wie der Philosoph Michel Foucault (1926–1984) in seinem berühmten Aufsatz „Was ist ein Autor?“ von 1969 ausführt. Ihm geht es in kritischer Absicht darum zu zeigen, wie der ‚Autor‘ zur abstrakten Instanz mit grundlegender Bedeutung für die Beurteilung eines Textes wird. So ist es für einen Text nicht ohne Belang, ob er, sagen wir: Petrarca, Calvino oder einem anonymen Autor zugeschrieben wird, selbst wenn sich der Text ‚objektiv‘ dadurch nicht ändert. Denn er ordnet sich damit in ein (typischerweise stimmiges oder in seiner Entwicklung erklärbares) Gesamtwerk ein, das einem vernunftbegabten und spezifisch motivierten Individuum entspringt. Der ‚Autor‘ ist nicht nur diese reale Person, sondern ein Konstrukt der Leserschaft, das auf einen Text bezogen wird, seine Einordnung, Gruppierung und Interpretation ermöglicht und die Komplexität und Widersprüchlichkeit des Textsinns vereinfacht (was Foucault die „Verknappung des Diskurses“, d. h. der Menge des Sagbaren, nennt). Diese ‚Autor-Funktion‘ als wesentlicher Bestandteil literarischer Texte ist ein Phänomen der Neuzeit – im Mittelalter waren literarische Texte ohne Autorzuschreibung gültig (man fragte nicht nach dem Individuum, das einen Text verfasst hatte), im Unterschied zu anderen Textsorten, etwa medizinischen Traktaten, die sich zumindest auf eine (meist antike) Autorität berufen mussten, um als gültig anerkannt zu werden. Für unsere Fragestellung lässt sich diesen Überlegungen entnehmen, dass zum ‚literarischen Werk‘ wird, was von einem ‚Autor‘ kommt – und nicht nur umgekehrt jemand zum Autor wird, weil er ein literarisches Werk geschrieben hat. Ein banaler Text, ein kurzer handschriftlicher Tagebucheintrag etwa, wie Sie und ich ihn verfasst haben könnten, kann literarische Weihen erhalten, wenn man feststellt, dass er von Luigi Pirandello stammt: Er wird dann ediert und in dessen Gesamtausgabe publiziert, eventuell von Literaturwissenschaftlern kommentiert und so fort. Selbst wenn wir nicht biographisch, sondern beispielsweise textimmanent an literarische Texte herangehen, bleibt der Autor – nicht die reale Person, sondern das Konstrukt, die ‚Funktion‘ – unter Umständen für die Frage entscheidend, was überhaupt unser Gegenstand ist.
Aufgabe 1.3? Lesen Sie nun folgenden Text von Umberto Eco und versuchen Sie ein weiteres Kriterium für die Literarizität von Texten anzuführen.
Text 1.8Umberto Eco: Opera aperta (1962) […] un’opera d’arte, cioè, è un oggetto prodotto da un autore che organizza una trama di effetti comunicativi in modo che ogni possibile fruitore possa ricomprendere (attraverso il gioco di risposte alla configurazione di effetti sentita come stimolo dalla sensibilità e dall’intelligenza) l’opera stessa, la forma originaria immaginata dall’autore.Abb. 1.6Umberto Eco (1932–2016) In tal senso l’autore produce una forma in sé conchiusa nel desiderio che tale forma venga compresa e fruita cosi come egli l’ha prodotta; tuttavia nell’atto di reazione alla trama degli stimoli e di comprensione della loro relazione, ogni fruitore porta una concreta situazione esistenziale, una sensibilità particolarmente condizionata, una determinata cultura, gusti, propensioni, pregiudizi personali, in modo che la comprensione della forma originaria avviene secondo una determinata prospettiva individuale. In fondo la forma è esteticamente valida nella misura in cui può essere vista e compresa secondo molteplici prospettive, manifestando una ricchezza di aspetti e di risonanze senza mai cessare di essere se stessa. […] In tale senso, dunque, un’opera d’arte, forma compiuta e chiusa nella sua perfezione di organismo perfettamente calibrato, è altresì aperta, possibilità di essere interpretata in mille modi diversi senza che la sua irriproducibile singolarità ne risulti alterata. (Eco: 1972, 26)
Kehren wir noch einmal zurück zu Text 1.1 und versuchen wir Ecos Überlegungen darauf anzuwenden. In der Tat erscheint das Werk formal unseren Lesegewohnheiten gegenüber zwar als abweichend, ist jedoch in sich geschlossen. Nur der Sinn offenbart sich uns nicht spontan; jeder und jede von uns könnte aus dem Text etwas anderes herauslesen. Wolfgang Iser spricht in diesem Zusammenhang von den ‚Leerstellen‘ Leerstelle/Unbestimmtheit bzw. der ‚Unbestimmtheit‘ eines Textes. Ein weiteres Kriterium für die Literarizität eines Textes wäre also sein Gehalt an Leerstellen (siehe Einheit 10.5.2) bzw. sein Grad an Interpretierbarkeit. Umberto Eco spricht in diesem Zusammenhang von der Offenheit (apertura) Offenheit des Kunstwerkes. Dieses Kriterium gilt laut Iser vor allem für moderne Literatur, doch auch Gedichte der Renaissance lassen sich unterschiedlich lesen. Das Sonett Gaspara Stampas wurde zu ihrer Zeit höchstwahrscheinlich als Imitation Petrarcas angesehen, während wir unsere Lektüre heute eher auf die AutoreferenzialitätAutoreferenzialität weiblichen Schreibens richten (Einheit 12.2). Im Text sind beide Möglichkeiten angelegt.
Unsere ‚Literatur‘: Kategorie mit klarem Zentrum und unscharfen Rändern Beispiele haben gezeigt, dass ‚Literatur‘ eine Kategorie mit recht unscharfen Grenzen ist. Die provisorischen Charakteristika, die wir anhand der Textbeispiele vorgeschlagen haben, liefern keine absoluten Kriterien in dem Sinne, dass die Zugehörigkeit eines Textes zum Bereich des Literarischen überzeitlich und unabhängig von den verschiedenen Gesellschaften, die ihn gelesen haben oder lesen werden, feststünde: Abb. 1.7Carlo Gozzi (1720–1806) Was ‚poetische‘ Sprache ist, hängt von einer schwer zu bestimmenden, zudem historisch, sozial und sogar individuell variierenden ‚Normalsprache‘ ab. Fiktionalität und Referenzialität, referenziellReferenzialität sind, wie wir sahen, keine unveränderlichen Eigenschaften, und selbst wenn sie es wären, schiene es höchst problematisch, Fiktionalität zur Voraussetzung für Literarizität zu machen. Wie gehen wir beispielweise mit der Autobiographie, etwa Carlo Gozzis Memorie inutili (1780–98), oder den zahlreichen Dialogtraktaten der Renaissance, die häufig wissenschaftliche oder gesellschaftliche Sachverhalte bzw. Fragestellungen veranschaulichen, um? Heute sind sie in allen Literaturgeschichten verzeichnet. Dieser Umstand weist einmal mehr darauf hin, dass die Beurteilung von Texten und ihrer Wichtigkeit sehr davon abhängt, was bestimmte Leser mit diesen bezwecken, warum und wie sie sie lesen – ein Kontextfaktor außerhalb des Textes selbst, wie wir im Zusammenhang mit Text-Beispiel 1.3 bereits sahen. So klar die Kategorie ‚Literatur‘ im Alltagsgebrauch auch sein mag und so sehr die erwähnten Charakteristika auch auf viele ‚große‘ Werke (die ‚Klassiker‘) zutreffen mögen, so durchlässig zeigt sie sich an den Rändern (d. h. an untypischen Texten). Dies gilt umso mehr ab der Moderne (ungefähr ab der Mitte des 19. Jh.), wo weniger ein klares Regelsystem im Sinne von Gattungspoetiken (siehe Einheit 2) als der Anspruch permanenter Neuerung zum Kennzeichen von Literatur wird und sich damit notwendigerweise auch die Grenzen des Literarischen immer wieder verschieben.
Aufgabe 1.4? Suchen Sie weitere – imaginäre oder Ihnen bekannte reale – Beispieltexte, die gegen die Kriterien der Poetizität und der Fiktionalität zur Bestimmung von Literatur sprechen.
1.2Literatur medial
Bisher Intensiver vs. extensiver Literaturbegriff haben wir versucht, Literatur anhand bestimmter Eigenschaften von anderen, nicht-literarischen Schriftstücken abzugrenzen. Wir haben damit einen sog. intensiven LiteraturbegriffLiteraturbegriff vertreten. Manche Schwierigkeit lässt sich umgehen, wenn man dagegen einen extensiven, also ausgedehnten Literaturbegriff zugrunde legt, zu unserer Eingangsdefinition zurückkehrt und Literatur gemäß der Ursprungsbedeutung des Wortes als geschriebene Sprache ! Extensiv verstanden: Literatur ist geschriebene Sprache versteht. Diese Definition umfasst ein ungleich größeres Textvolumen und freilich eine Unmenge von Schriftstücken, die gemeinhin kaum ‚Literatur‘ genannt würden (dabei, wie wir sahen, jedoch als Ready-made relativ leicht Literatur werden könnten), lenkt zugleich aber die Aufmerksamkeit auf einen Aspekt, der bisher nicht erwähnt wurde und auch sonst häufig stillschweigend oder gar nicht beachtet wird: die Medialität von Literatur.
Hier ist Medium Datenträger gleich ein klärendes Wort zum Begriff ‚Medium, MedienMedium‘ angebracht. Er wird in zweierlei Bedeutung gebraucht. Wir bezeichnen (1) Datenträger wie Zelluloidfilme, Videobänder oder DVD als „Medium“. Einen Spielfilm kann ich, die entsprechenden technischen Apparaturen vorausgesetzt, mit Hilfe aller genannten Datenträger rezipieren, ohne dass sich der Inhalt (das, was ich sehen und hören kann) deswegen ändert. Allerdings kann der Datenträger indirekt einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf den Inhalt ausüben: so wurden durch Publikation von Literatur in Massenmedien wie den auflagenstarken Tageszeitungen des 19. Jh. neue Leserschichten mit ihren spezifischen Erwartungen erreicht und die schriftstellerische Produktion beschleunigt und auf die Erhöhung der Verkaufszahlen ausgerichtet. Der Roman am Ende des 19. Jh. ist ohne die Massendistribution in Tageszeitungen nicht denkbar. – Wir bezeichnen (2) Zeichensysteme Zeichensysteme als Medien. Das Medium des Films beispielsweise sind bewegte Bilder und Töne, das von Literatur ist die geschriebene Sprache. Im Unterschied zur Bedeutung (1) ist hier der Inhalt nicht ohne Weiteres vom Medium abkoppelbar: Während es möglich ist, einen Roman ohne Informationsverlust als Text auf CD-ROM zu übertragen und statt auf Papier auf dem Bildschirm zu lesen (Datenträgerwechsel), kann man ihn nicht eins zu eins ins Medium (Zeichensystem) des Films überführen (es sei denn, man würde das Quellmedium selbst übernehmen, indem man alle Seiten des Buchs abfilmte). Literaturverfilmung geht zugleich mit Informationsverlust und -zugewinn einher, ist Interpretation, und zwei Verfilmungen ein und desselben literarischen Textes werden stets deutlich voneinander abweichen (siehe Einheit 14).
Aufgabe 1.5? Versuchen Sie vor dem Weiterlesen, einige medienspezifische Grundeigenschaften von Literatur zu nennen. Der Vergleich mit anderen Medien (Zeichensystemen) wird Ihnen bei der Suche helfen, ebenso Ihre evtl. bereits erworbenen Grundkenntnisse der Linguistik.
Auch wenn Medialität jeder Wahrnehmung es uns bei der Lektüre eines fesselnd geschriebenen Romans oder bei der Betrachtung eines detailrealistischen Films so vorkommen mag, als ob wir dem Dargestellten unmittelbar begegnen, mitunter gleichsam ‚eintauchen‘ könnten – worin nach wie vor einer der Hauptreize der Rezeption gerade von Literatur und Film liegt –, so bleibt es ein unhintergehbares Faktum, dass zwischen uns und diesen Inhalten ein Medium steht und stehen muss: ‚Unmittelbar‘ dringt nichts in unsere Psyche ein (lassen wir religiöse oder parapsychologische Erlebnisse einmal beiseite), und das dazwischen liegende Medium ist nie völlig transparent.
Für die Literatur als ‚Wortkunst‘ liegt das mediale Apriori, die vor jeder Poetik liegenden Ausdrucksbedingungen, zunächst einmal in der Bindung an Sprache. Die Eigenschaften dieses Zeichensystems bestimmen die Eigenschaften von Literatur mit. Der Begründer der strukturalistischen Sprachwissenschaft, Ferdinand de Saussure (1857–1913), hat als zentrale Merkmale sprachlicher Zeichen ihre Linearität, Abstraktheit und Arbitrarität des sprachlichen Zeichens (Ferdinand de Saussure) Linearität, ihre Abstraktheit und ihre Arbitrarität herausgestellt. Linear ist Sprache, weil ihre Ausdrucksseite (der Signifikant/SignifikatSignifikant, it. significante, m., also Laute oder Buchstaben) aus aufeinanderfolgenden, nicht gleichzeitig übermittelten Zeichen und Zeichenelementen besteht – ich vernehme einen Satz normalerweise eindimensional Laut für Laut, selbst wenn ich u. U. den durch ihn übermittelten Inhalt (die Bedeutung, Signifikant und Signifikat das Signifikat, it. significato) oder auch die grammatische Struktur des Satzes kognitiv nicht linear, sondern ganzheitlich erfasse. Literatur ist demnach eine Kunstform, die in der Linearität des Nacheinanders eine Bedeutung entwickelt, im Gegensatz etwa zum Film, der zwar auch linear abläuft, aber stets gleichzeitig einen zwei- oder dreidimensionalen Bildraum eröffnet und diesen mit einer großen Bandbreite von Geräuschen, Musik oder Stimmen überlagern kann. Abstrakt ist ein sprachliches Zeichen, weil es nach de Saussure zunächst auf ein Konzept im Kopf des Sprechers oder Hörers und (noch) nicht auf ein konkretes Objekt (Referent) aus der Umwelt verweist. Ein literarischer Text lässt demnach notwendigerweise eine relativ große Unbestimmtheit vor allem in Bezug auf Konkretes – was der Leser bei dem Wort „Haus“ denkt, ist individuell unterschiedlich, während ein Film eben dies sehr viel konkreter und detailgenauer steuert, wenn er „Haus“ ‚sagt‘, d. h. ein solches zeigt. Umgekehrt hat Literatur durch ihre mediale Grundlage eine besondere Stärke eben in der Darstellung von Abstrakta – ein Text kann „Friede“ sagen, ein Film muss, will er sich nicht seinerseits der Sprache bedienen, sondern auf sein Zeichensystem rekurrieren, Bilderfolgen entwickeln, die dem Zuschauer diese Bedeutung suggerieren, mit einem freilich viel höheren Aufwand auf der Ausdrucksseite und einer Fülle nicht relevanter Informationen. Arbiträr (willkürlich) sind sprachliche Zeichen in der Regel, weil zwischen ihrem Signifikanten und ihrem Signifikat keine Motivation, d. h. natürliches Verhältnis (Ursache-Wirkung, Urbild-Abbildung o. ä.), besteht, sondern Ausdruck und Bedeutung nur durch Konvention aneinander gebunden werden – es ist nicht zwingend, ein Gebäude variabler Größe mit Fenstern und Türen mit der Lautfolge <haus> zu bezeichnen, man kann es auch <casa>, <maison> oder beliebig anders nennen, wenn sich eine Sprechergemeinschaft im Gebrauch darauf einigt. Literatur ist unmittelbar abhängig von der Konvention eines Codes – ein Text in einer unbekannten Sprache ist noch nicht einmal hinsichtlich des Wortlauts verständlich, von symbolischen Bedeutungen ganz abgesehen –, während der Film zunächst einmal seinen Ausdruck jenseits eines Codes vom gefilmten Objekt selbst erzeugen lässt, das Zeichen also höher motiviert ist, abbildet – was nicht heißt, dass im Film nicht auch kulturelle Codes Kultureller Code eine zentrale Rolle spielen und ein Film nicht jenseits der unmittelbaren Bildinhalte völlig unverständlich sein kann.
Die Literatur in verschiedenen ‚Aufschreibesystemen‘ (Friedrich Kittler)Funktion, die eine Kunstform für eine bestimmte Gesellschaft zu einem bestimmten Zeitpunkt übernimmt, liegt dabei nicht allein in ihren eigenen medialen Möglichkeiten begründet, sondern ergibt sich auch aus dem Verhältnis zu konkurrierenden Kunstformen mit anderen medialen Grundlagen. Für dieses mediale Umfeld hat der Literatur- und Medienwissenschaftler Friedrich Kittler (1943–2011) den Begriff Aufschreibesystem‚Aufschreibesystem‘ geprägt. Er versteht darunter „das Netzwerk von Techniken und Institutionen […], die einer gegebenen Kultur die Adressierung, Speicherung und Verarbeitung relevanter Daten erlauben“ (Kittler: 2003, 501), also sowohl die zu einem Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Medien (Datenträger und Zeichensysteme) als auch Einrichtungen wie Schulen oder Verlage, die den Umgang mit und den Zugang zu ihnen regeln. Die Rolle des Aufschreibesystems Aufschreibesystem von 1800für ein Medium, MedienMedium und die auf ihm beruhende(n) Kunstform(en) veranschaulicht Kittler eindrücklich in der Gegenüberstellung zweier historischer Momente: 1800 und 1900. Um 1800 hatte die Schrift das Monopol serieller Datenspeicherung. Es war das einzige Medium, das Vorgänge in ihrer Prozesshaftigkeit für die Nachwelt festhalten konnte. Diese Speicherung funktioniert nur über menschliches Bewusstsein: keine Aufzeichnung ohne jemanden, der sie durchführt, niederschreibt. Insbesondere Sprache ist nur durch Schrift speicherbar. Die entscheidende Voraussetzung dafür, dass Schrift als das Universalmedium begriffen wurde, war eine millionenfache Alphabetisierung, bei der erstmals laut gelesen, Schrift an Stimme gekoppelt wurde. Im Gegensatz zu bisherigen Lernmethoden, die auf dem stummen Auswendiglernen von Wortgestalten bzw. (Bibel-)Versen beruhten, Abb. 1.8Dichtung im Aufschreibesystem von 1800 und zur mittelalterlichen Schriftkultur, wo Schreiber oft lediglich Kopisten waren und das von ihnen Kopierte gar nicht lesen konnten, sich also nur mit dem Zeichenträger (Buchstaben) ohne Bedeutung befassten, wurde nun dieser gleich hin zu den Lauten übersprungen, d. h. zur gesprochenen Sprache, die, so die implizite Annahme, das Denken selbst repräsentierte. Schrift wurde dadurch nach Kittler immateriell, da man die Materialität der Sprache (Tinte auf Papier, Sprechen als Körpertechnik) aus dem Blick verlor. Und sie wurde universal, weil sie das einzige serielle Speichermedium war, nunmehr von großen Teilen der Bevölkerung benutzt und zudem als Verkörperung des Denkens selbst aufgefasst wurde. Für die Dichtung als sprachliche Kunstform bedeutete dies: Da Denken und Vorstellungskraft die Grundlage aller menschlichen Produktion und insbesondere der Kunst ist, ging man davon aus, alles sei in Sprache überführbar, also auch Malerei und Bildhauerei, die im Gegensatz zur Dichtung an Materie (Leinwand, Stein usw.) gebunden schienen, d. h. jedes beliebige Artefakt sei letztlich ohne Informationsverlust in Dichtung zu übersetzen. So wie Schrift ‚Universalmedium‘ war, war Dichtung ‚Universalkunst‘.
Die Aufschreibesystem von 1900 technischen Neuentwicklungen des 19. Jh., insbesondere das Grammophon und der Film, verändern diese Situation grundlegend und führen zum AufschreibesystemAufschreibesystem von 1900. Abb. 1.9Literatur im Aufschreibesystem von 1900 Sie ermöglichen nun serielle Datenspeicherung ohne menschliches Bewusstsein und unterhalb der Wahrnehmungsschwelle. Grammophon und Film speichern dabei das Reale selbst (Schallwellen auf Wachswalze, Lichtwellen auf chemisch behandeltem Papier) und nicht mehr symbolische Repräsentation (etwa in Buchstaben, die Laute verschriften) oder Bedeutung. Da gesprochene Sprache in ihrer individuellen Gestalt (Stimme) konservierbar wird und äußere Wirklichkeit durch detailreiche bewegte Bilder gespeichert werden kann, ist klar, dass Schrift und mit ihr Literatur nun nicht mehr universal sind. Zudem führen die neuen Aufzeichnungssysteme vor Augen, dass auch geschriebene Sprache von einem materiellen Zeichenträger abhängig ist – sie verliert ihren Status als quasi immaterielles Medium, MedienMedium. Neue Medien und die entsprechenden Kunstformen ersetzen alte nicht, aber sie weisen ihnen neue Systemplätze zu, wie Kittler betont: Die ehemalige Universalkunst ‚Dichtung‘ weicht einer Schriftkunst ‚Literatur‘, die ihre Aufgaben neu zu bestimmen hat. Ihr bleiben mehrere Möglichkeiten. Sie kann sich (1) auf den Bereich konzentrieren, der von den konkurrierenden Medien nicht oder unzureichend erfasst wird. Dazu gehört, wie wir oben bereits sahen, alles, was nicht konkret (‚real‘) oder bildhaft (‚imaginär‘), sondern abstrakt (‚symbolisch‘) ist; so werden sprachliche Zeichen nicht mehr in den Dienst einer Wirklichkeitsabbildung gestellt, die von anderen Künsten wie der Photographie besser zu leisten ist, sondern absolut gesetzt – eines der poetologischen Hauptmerkmale des bereits erwähnten Futurismus. Sie kann (2) die Wiederentdeckung der materiellen Zeichen feiern, indem sie mit Buchstaben statt (oder zusätzlich zur) Bedeutung spielt; ein Beispiel hierfür sind die Collagen von Marinetti. Oder sie ordnet sich (3) den (zunehmend erfolgreichen) Konkurrenzmedien unter, indem sie Medienwechsel (z. B. Verfilmung) bereits in der Machart des Textes einkalkuliert. Mitunter sind etwa filmische Verfahren auch in Hinblick auf eine selbstbewusste Erneuerung für Literatur adaptiert worden, z. B. in Gestalt einer Nachahmung von Schnitt und Größeneinstellungen in der Erzähltechnik von Romanen (siehe die Einheiten 8, 9 und 13).
Ausgehend Zusammenfassung von repräsentativen Beispielen aus der italienischen Literatur konnten wir im zurückliegenden Kapitel eine Reihe von literarischen Merkmalen beschreiben, die durchaus dem Allgemeinverständnis vom Wesen und Anspruch der Literatur entsprechen und dieses konkretisieren. Zugleich stellten wir fest, dass es keine absoluten Kriterien für Literarizität gibt, sondern dass die Zurechnung eines Textes zur ‚Literatur‘ sehr durch den Kontext und den jeweiligen Umgang einer Gesellschaft oder eines Individuums mit ihm bestimmt wird. Charakterisiert man sehr allgemein Literatur als geschriebene Sprache, so richtet sich der Blick auf ihre medienspezifischen Funktionsbedingungen, die anhand einer historischen Gegenüberstellung 1800 vs. 1900 illustriert wurden.
Aufgabe 1.6? Erstellen Sie ein graphisches Resümee der Ausführungen zum Literaturbegriff. Rubrizieren Sie dabei die verschiedenen Eingrenzungsvorschläge und notieren Sie, farblich abgesetzt, jeweils Einwände und Gegenbeispiele. Eine Möglichkeit hierfür wäre eine Baumstruktur:
Literatur
Giovanni Boccaccio: Decameron. Milano: Mursia 2001.
Italo Calvino: Se una notte d’inverno un viaggiatore. Torino: Einaudi 1979.
Corriere della Sera, 16.04.2024.
Benedetto Croce: La poesia. Bari: Laterza 51953.
Umberto Eco: Opera aperta. Milano: Bompiani 1972.
Michel Foucault: Was ist ein Autor?, in: Ders., Schriften zur Literatur. Frankfurt/Main: Suhrkamp 2003, 234–270.
Wolfgang Iser: Die Appellstruktur der Texte: Unbestimmtheit als Wirkungsbedingung literarischer Prosa. Konstanz: Universitätsverlag 41974.
Friedrich Kittler: Aufschreibesysteme 1800–1900. München: Fink 42003.
Filippo Tommaso Marinetti: Marcia Futurista, 1916, in: Giovanni Lista (Hg.), Marinetti et le futurisme. Lausanne: L’Age d’Homme 1977, 48.
Luigi Pirandello: Sei personaggi in cerca d’autore, in: Ders., Maschere nude. Band III. Milano: Mondadori 91937.
Ferdinand de Saussure: Grundfragen der allgemeinen Sprachwissenschaft. Stuttgart: Reclam 2016.
Gaspara Stampa: Rime. Milano: Fabbri 1995.
Weiterführende Literaturhinweise finden Sie auf www.bachelor-wissen.de.
2Literaturgeschichtliche Ordnungsmodelle
Poetik
2.1.1Die Poetik des Aristoteles
2.1.2Stilarten und Ständeklausel
2.1.3Italienische Renaissancepoetiken
2.1.4Die Questione della lingua
2.2Gattungen
2.3Epochen
2.4Literaturgeschichte
2.5Thema, Stoff, Motiv
2.6Kanon
In Überblick Einheit 2 wird der Begriff ‚Poetik‘ in Abgrenzung zur Literaturgeschichte und Literaturkritik vorgestellt. Wichtige poetologische Schriften werden als Wegmarken des historischen Entwicklungsverlaufs hervorgehoben. Ein spezielles Augenmerk gilt in diesem Zusammenhang den literarischen Gattungen, Epochen, thematischen Elementen und dem Kanon.
Der Der Literaturbegriff im zeitlichen Wandel Begriff ‚Literatur‘, das hat die vorangehende Einheit 1 verdeutlicht, ist inhaltlich nur schwer eingrenzbar und bleibt in seinen jeweiligen Definitionsversuchen abhängig von seiner Position in einem historischen und kulturellen Gefüge. Insofern kann man Texte immer nur für ihren bestimmten geschichtlichen Augenblick und unter dem Gesichtspunkt des jeweiligen Literaturverständnisses auf ihre Literarizität hin prüfen.
2.1Poetik, poetologischPoetik
Unter ! Poetik ist die Lehre von der Dichtkunst Poetik (la poetica) versteht man die Lehre von der Dichtung, und zwar in zweifacher Weise: Zum einen befasst sie sich mit dem Wesen von Dichtung, ihrer Bestimmung, ihrer Einteilung in Gruppen gleichartiger Texte und ihrem ästhetischen Wert. Zum anderen will sie in vielen Fällen auch eine Anleitung zum Dichten geben, sei es, dass sie bereits vorliegende bekannte Werke in ihren Vorzügen und Mängeln kritisch betrachtet (Deskriptivität, deskriptivdeskriptives, d. h. beschreibendes Vorgehen), sei es, dass sie konkrete Hinweise bzw. Vorschriften für das Verfassen von Werken enthält (Normativität, normativnormativer Anspruch). Neben den expliziten Poetiken, die sich als eigenständige Abhandlungen zur Literatur darbieten, existieren zahllose aussagekräftige sog. immanente (auch: implizite) Poetiken (poetica implicita), welche Autorinnen und Autoren in ihren Vorworten oder Vorreden, Nachworten oder Selbstaussagen (z. B. Interviews) formuliert haben und die über ihr persönliches Literaturverständnis Auskunft geben. Im Falle von ‚Metapoesie‘ bzw. ‚Metapoetik‘ handelt es sich schließlich um Literatur, die selbst Auffassungen und Funktionen von Literatur betrachtet.
Literatur und Dichtung: Definition Im Gegensatz zum allgemeinen LiteraturbegriffLiteraturbegriff (siehe Einheit 1) geht der emphatisch, d. h. bedeutungsschwer aufgeladene Dichtungsbegriff von vornherein nur von literatur- und menschheitsgeschichtlich ‚wertvollen‘ Texten aus, wobei eine Nähe zu lyrischen Formen anklingt.
Insgesamt betrachtet, können Poetiken oder poetologische Ausführungen (das Adjektiv ‚poetologisch‘ zielt auf die Poetik, das Adjektiv ‚Poetizität, poetischpoetisch‘ auf das dichterische Werk ab) eine Reihe von Funktionen erfüllen:
die Beschäftigung mit der Frage nach dem Ursprung und dem Wesen der Dichtung und ihre Abgrenzung von den anderen Künsten;
eine Auseinandersetzung mit dem ‚Schönen‘ und ‚Wahren‘ in der Literatur (Ästhetik, Literaturphilosophie);
die Erörterung richtiger Rede (Grammatik) und
ebenso kunst- wie wirkungsvoll ausformulierter Rede (RhetorikRhetorik);
das Studium stilistischer Besonderheiten bzw. stilistischer Angemessenheit (Stilistik);
die Beschreibung literarischer Gattungen;
die Betrachtung der geschichtlichen Entwicklung einer Sprache (diachrone Sprachwissenschaft);
die kritische Sichtung literarischer Beispiele (Literaturkritik), oftmals unter
Einordnung in literaturhistorische Zusammenhänge (LiteraturgeschichteLiteraturgeschichte) und
Ableitung allgemeiner Aussagen zu literarischen Phänomenen (LiteraturwissenschaftLiteraturwissenschaft);
Aussagen zu sozio-kulturellen Implikationen bestimmter Textsorten (Literatursoziologie, Rezeptionsforschung [vgl. Einheiten 10.4 und 10.5]).
Das Selbstverständnis von Poetiken und ihre tatsächliche Bedeutung für die Abfassung literarischer Texte sind ihrerseits wiederum starken epochalen Schwankungen unterworfen. So lassen sich viele der antiken ‚Poetiken‘ als Versuche einer Inventarisierung und Kommentierung der gegebenen literarischen Phänomene deuten, die als Dichtungslehren bereits grundlegenden Charakter für alle nachfolgenden Abhandlungen hatten. Aus heutiger Sicht aber erscheinen sie womöglich als unvollständig und episodisch, da sie allzu sehr dem persönlichen Blick des jeweiligen Verfassers verpflichtet sind.
Ohne einen vollständigen Abriss der poetologischen Entwicklung geben zu wollen, seien im Folgenden unter den zahllosen theoretischen Auseinandersetzungen mit der Literatur einige wenige hervorgehoben, die entweder auf Grund ihrer bedeutsamen Rezeptionsgeschichte oder aber wegen ihrer Syntheseleistung einen besonderen Rang eingenommen haben.
2.1.1Die Poetik, poetologischPoetik des Aristoteles
1
Text 2.1Aristoteles: PoetikVon der Dichtkunst selbst und von ihren Gattungen, GattungssystemGattungen, welche Wirkung eine jede hat und wie man die Handlungen zusammenfügen muss, wenn die Dichtung gut sein soll, ferner aus wie vielen und was für Teilen eine Dichtung besteht, und ebenso auch von den anderen Dingen, die zu dem selben Thema gehören, wollen
5
wir hier handeln […] (Aristoteles: 1994, 5)
Abb. 2.1Aristoteles (384–322 v. Chr.) Die nur zum Teil erhaltene Poetik des Aristoteles, die ungefähr um das Jahr 335 v. Chr. entstanden ist, zählt zu den bedeutsamsten kunsttheoretischen Texten der abendländischen Kultur. Sie steht an der Seite einer RhetorikRhetorik, verlässt aber deren auf die Redekunst zugeschnittene Betrachtung, um sich – nicht zuletzt anhand der Diskussion wichtiger Referenztexte – allgemeinen Fragen der wichtigsten zeitgenössischen literarischen Gattungen zuzuwenden. Dazu zählen in erster Linie die Epik, die tragische Dichtung und die Komödie (jener der Komödie gewidmete Teil ist leider nicht überliefert, ein Umstand, der Umberto Eco zu seinem Roman Il nome della rosa [1980] inspirierte). In Abwendung von Platon, der in dichtungskritischen Passagen seiner Schriften (vor allem Politeia, X 595a-602b) die Dichtung bezichtigt, der Wahrheit der ursprünglichen ‚Ideen‘ in ihrem verzerrten Abbild nicht zu entsprechen, und sie einer rigiden Staatsmoral unterwerfen möchte, führt Aristoteles die dichterische Schaffenskraft des Menschen auf ein geradezu anthropologisches Bedürfnis zurück, nämlich den Drang zur Nachahmung (Mimesis, ital. Mimesismimesis, f.). Mimesis-Begriff Demgemäß stelle die Dichtung nichts anderes dar als die Nachahmung gesellschaftlichen Handelns, d. h. eine Abbildung der vom Menschen erlebbaren Wirklichkeit. Dass hiermit aber keineswegs ein ungebrochener Realismus gemeint ist, verdeutlichen die weiteren Ausführungen: nicht die Wahrheit im Sinne von faktengetreuer Wiedergabe, sondern die Wahrscheinlichkeit im Sinne einer tief gründenden Einsicht in die menschliche Natur sei das Verdienst der Dichtung, die damit philosophische Qualitäten aufweise und die Aussagekraft der oftmals unwahrscheinlich wirkenden historischen Ereignisse (und damit der Geschichtsschreibung) hinter sich lasse.
Von Hierarchie der Gattungen grundlegender Bedeutung für das Literaturverständnis nahezu jeglicher Epoche ist die von Aristoteles thematisierte Verknüpfung von Gattung, kulturellem und sozialem Prestige. So ordnet er der TragödieTragödie und dem EposEpos die Nachahmung edler Menschen zu, die es wiederum nachzuahmen gilt, während die schlechten Menschen in ihren Lastern von der Komödie aufgegriffen werden, die sie der Lächerlichkeit preisgibt und somit gewissermaßen abschreckend wirkt. Im Übrigen werden Gattungshierarchiedie Gattungen nach dem Kriterium der Rede unterteilt: Spricht im Drama der Schauspieler, so ist davon die berichtende Rede eines Erzählers zu unterscheiden – ein Gedanke, der in der weiteren LiteraturgeschichteLiteraturgeschichte immer wieder aufgegriffen und modifiziert werden sollte.
Zusatzmaterial zur Ars poetica des Horaz finden Sie auf www.bachelor-wissen.de.Die Aristotelische Poetik, poetologischPoetik geriet zunächst für das gesamte abendländische Mittelalter in Vergessenheit, da die Überlieferung abriss, und wurde erst ab dem ausgehenden 15. Jh. wieder entdeckt, um dann für lange Zeit einen besonders intensiven Einfluss auf das Literaturverständnis auszuüben.
Aufgabe 2.1? Welche Auffassung von Literatur steht hinter dem Bemühen, Poetiken zu verfassen?
2.1.2StilartenStilarten und StändeklauselStändeklausel
Abb. 2.2Quintilian (35–ca. 96 n. Chr.) Die bei Aristoteles (und Horaz) geforderte ‚Angemessenheit‘ in der Behandlung eines vom Dichter gewählten Stoffes mündet in ein im Laufe der Zeiten variabel gehandhabtes System, welches jeder Gattung bestimmte Themen, Zielsetzungen, Figuren und eine eigene Stilart zuschreibt. Eine wichtige Mittlerfunktion bei der Überlieferung und der Anpassung der antiken Dichtungslehre spielten unter anderem die römischen Rhetoriker Cicero (106–43 v. Chr.) und Quintilian (35–ca. 96 n. Chr.), letzterer insbesondere dank seines Lehrwerks Institutio oratoria. Im Mittelalter erlangte beispielsweise das sog. ‚Rad des Vergil‘ großen Einfluss, in dem die wichtigsten Werke dieses antiken Autors zu modellbildenden Vorgaben für die zeitgenössische Literatur ausgedeutet wurden.
Abb. 2.3 Das sog. Rad des Vergil, das jeder Stilart bestimmte inhaltliche Elemente zuordnet
Die Grundlage bildete Stilarten die in den antiken Rhetoriken ausgearbeitete Lehre von den drei StilartenStilarten (genera dicendi), welche für öffentliche Reden je nach Anlass spezifische Leitlinien formulierten. Dabei handelte es sich zunächst einmal um Vorgaben, die eine Orientierung dafür boten, welches Thema auf welche Art und Weise vor welchem Publikum bzw. zu welchem Anlass angemessen behandelt werden sollte. Ähnliche Vorschriften wurden im Weiteren auch für den Bereich der Dichtung in entsprechenden Poetiken erstellt. Ein vereinfachender Überblick kann verdeutlichen, welche Erfordernisse mit den einzelnen Gattungen, GattungssystemGattungen verbunden wurden:
stilistische Merkmale
Figurenpersonal
Zielsetzung
Vorbildliche Werke Vergils
erhabener Stil (genus grande/sublime)
sehr anspruchsvoll in Konstruktion und Redeschmuck (Verwendung entsprechender rhetorischer Mittel) zur Behandlung erhabener Themen
Helden von Vornehmer Herkunft
Erregung des Gemüts
Aeneis (Heldenepos)
mittlerer Stil (genus mediocre)
eine kunstvolle, jedoch gut verständliche Sprachverwendung
Bauern
Unterhaltung und Erfreuen
Georgica (Lehrgedicht)
niederer Stil (genus humile)
einfach und schmucklos, an der Alltagssprache orientiert
Einfaches Volk
Belehrung, Beweise
Bucolica (Hirtendichtung)
Abb. 2.4 Die drei Stilarten nach dem sog. ‚Rad des Vergil‘ des Johannes de Garlandia (ca. 1195–1272)
Mit Ständeklausel der Forderung, die Literatur müsse auf angemessene Art und Weise auf ihr Sujet abgestimmt sein, ging zudem eine Zuordnung von Stilart, Gattung und sozialem Stand der behandelten Hauptfiguren einher. In diesem Sinne wurde die volkssprachliche Lyrik noch in der Renaissance von vornherein nur dem niederen Stil zugerechnet. Für die angesehene TragödieTragödie forderte bereits Aristoteles, nur Personen von besonderem sozialem Rang dürften mit einem tragischen Geschick konfrontiert werden, da bei ihnen die Wendung von Glück in Unglück eine besonders beeindruckende ‚Fallhöhe‘ auszeichne. Wenn also ihr Streben in einer ‚Katastrophe‘ (als dem tragischen Ausgang der Tragödie) ende, so erschüttere dies die Zuschauerschaft sehr viel mehr, als das Unglück einer Figur aus einer niederen sozialen Schicht, die dem Elend von vornherein näher stehe. Eine solche emotionale Erschütterung sowie die dadurch bewirkte innere Reinigung (Katharsis; ital. catarsi, f.) galten ihm als wichtige Ziele der Tragödie.
Aufgabe 2.2? Welches Menschenbild lässt sich an diesen poetologischen Bestimmungen ablesen?