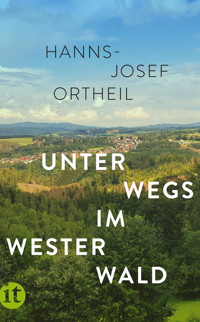9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Eine literarische Italienreise mit Hanns-Josef Ortheil.
Hanns-Josef Ortheil hat in seinen Romanen und Essays immer wieder von Orten, Landschaften und Menschen Italiens erzählt. Er mischt sich in typische Szenen des Alltags ein, frühstückt „italienisch“, vertieft sich in Architektur, Kunst oder Musik eines Landes, das seit den frühen Siebziger Jahren seine „zweite Heimat“ ist. In dieser Anthologie mit Passagen aus seinen Werken nimmt der Leser an den Streifzügen des passionierten Italienliebhabers teil, begleitet ihn durch Venedig, Rom, Neapel oder Sizilien, wandert mit ihm an der adriatischen Meeresküste entlang und entdeckt die hohen Freuden der italienischen Küche.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 383
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Zum Buch
Hanns-Josef Ortheil hat in seinen Romanen und Essays immer wieder von Orten, Landschaften und Menschen Italiens erzählt. Er mischt sich in typische Szenen des Alltags ein, frühstückt »italienisch«, vertieft sich in Architektur, Kunst oder Musik eines Landes, das seit den frühen Siebziger Jahren seine »zweite Heimat« ist. In dieser Anthologie mit Passagen aus seinen Werken nimmt der Leser an den Streifzügen des passionierten Italienliebhabers teil, begleitet ihn durch Rom, Venedig und Sizilien, wandert mit ihm an der adriatischen Meeresküste entlang und entdeckt die hohen Freuden der italienischen Genusskulturen.
Zum Autor
HANNS-JOSEF ORTHEIL wurde 1951 in Köln geboren. Er ist Schriftsteller, Pianist und Professor für Kreatives Schreiben und Kulturjournalismus an der Universität Hildesheim. Seit vielen Jahren gehört er zu den beliebtesten und meistgelesenen deutschen Autoren der Gegenwart. Sein Werk wurde mit vielen Preisen ausgezeichnet, darunter dem Thomas-Mann-Preis, dem Nicolas-Born-Preis, dem Stefan-Andres-Preis und dem Hannelore-Greve-Literaturpreis. Seine Romane wurden in über zwanzig Sprachen übersetzt.
HANNS-JOSEF ORTHEIL
Italienische Momente
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Originalausgabe August 2020
Copyright © 2020 by btb Verlag
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Covergestaltung: semper smile, München
unter Verwendung eines Motivs von © Lotta Ortheil
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
cb · Herstellung: sc
ISBN 978-3-641-25686-9V001www.btb-verlag.de
www.facebook.com/btbverlag
Inhaltsverzeichnis
Italienische Momente
Römisches Leben
Erste Ankunft in Rom
Goethes Ankunft in Rom
In einer römischen Pension
Römischer Hunger
Die zweite Ankunft in Rom – Villa Massimo
Stipendiatenleben
Mysterienfeiern
Pranzo totale
Die dritte Ankunft in Rom – Villa Massimo 2
Die vierte Ankunft in Rom – Villa Massimo 3
Abschied von Rom
Venezianisches Leben
Ankunft in Venedig
Die Wege des frühen Morgens
Mit Ernest Hemingway in Venedig unterwegs 1
Mit Ernest Hemingway in Venedig unterwegs 2
Im Licht der Lagune
Venezianische Cicchetti
Venedig mit Kindern
Die weißen Inseln der Zeit
Sizilianisches Leben
Die Ankunft in Sizilien
Ein Gang durch Mandlica
Das Leben in Mandlica
Die Geschichten der Einheimischen
Die Durchdringung der Geschichten
Die Insel der Dolci
Das Leben am Meer
Die Fahrt ans Meer
Am Strand 1
Am Strand 2
Acquaviva Picena – in den Bergen über dem Meer
Epilog 1: Italien zu Haus
Epilog 2: Meine Italien-Bücher
Quellenverzeichnis
Italienische Momente
Vor genau fünfzig Jahren bin ich als junger Mann zum ersten Mal nach Italien gereist. Seither habe ich das Land im Süden jedes Jahr zumindest für einige Wochen besucht. Meistens bin ich aber länger geblieben, denn ich wollte nicht als flüchtiger Tourist auftreten und leben. Natürlich war ich anfänglich genau das und bin es in den Augen der Einheimischen vielleicht auch heute noch. Ich selbst habe mir aber Mühe gegeben, das touristische Dasein zu überwinden und (soweit irgend möglich) immer mehr auszulöschen.
Das gelang vor allem durch die Sprache. Italienisch mit den Bewohnern zu sprechen, ihre Tagesabläufe zu teilen, mit und unter ihnen zu leben – das hat mir große Freude gemacht. So habe ich in diesem Land oft eine Nähe und Herzlichkeit kennengelernt, die mich vergessen ließ, dass ich eigentlich woanders zu Hause war.
War ich das? Ja und nein. Mit den Jahrzehnten ist Italien für mich zu dem geworden, was ich heute »die zweite Heimat« nenne. Mit ihr verbinden mich durchaus Heimatgefühle, ähnlich denen zu Orten meiner deutschen Herkunft. Diese Gefühle sind aber abgeleiteter Natur, denn so ganz verschwindet während meiner Aufenthalte nie das Empfinden, in einer Fremde zu leben.
Gerade diese Spannung macht die Italienaufenthalte interessant: Das Gefühl, dazu- und doch nicht dazuzugehören, viele Empfindungen mit den Einheimischen zu teilen – und doch zu spüren, dass man nur eine Art integrierter Beobachter ist.
Was aber hat mich so stark gerade an diesem Land fasziniert? Der Zusammenklang von Kultur und Natur, die Schönheit der alten Innenstädte, die noch überwältigendere Schönheit der weiten Landschaften, Malerei, Musik und Filme, die hellwachen und anregenden Unterhaltungen mit italienischen Freundinnen und Freunden, ihre enorme Lockerheit und Eleganz.
Ein guter Bekannter, der Jahrzehnte in Rom verbracht hatte und doch irgendwann wieder für immer nach Deutschland zurückkehrte, stellte im Blick auf solche Freundschaften eine Differenz fest, die auch mir immer stark aufgefallen ist: »Etwas müssen die Deutschen noch üben: das Küssen, das Umarmen und das Lächeln!«
Ach ja, genau das habe ich auch erst üben und lernen müssen, seit meinen ersten Wochen in Rom. In der Ewigen Stadt habe ich am meisten Lebenszeit verbracht, dann folgt Venedig, dann die adriatische Küste und schließlich Sizilien. Ligurien, die Toscana und Umbrien, aber auch Apulien habe ich ebenfalls gut kennengelernt, mich aber nie länger dort aufgehalten. Ich bin meinen zuerst aufgesuchten Regionen vielmehr bis heute treu geblieben. Ich liebe sie und viele ihrer Bewohner sehr. Auf eine einfachere Formel kann ich meine jahrzehntelange Anhänglichkeit nicht bringen.
Diese Liebe fand ihre Erweiterung in zahllosen Lektüreerlebnissen, über die ich ebenfalls ausführlich schreiben könnte. Das würde dann ein eigenes Buch ergeben. Genau erinnere ich mich etwa noch daran, dass ich während meiner ersten römischen Monate Jacob Burckhardts Die Kultur der Renaissance in Italien las. Schon dieses Buch flößte mir einen großen Respekt vor den italienischen Lebensformen ein, und ich fragte mich, ob ich ihren Kulturen auch gewachsen sein würde.
Mit Jacob Burckhardts Cicerone in der Hand legte ich dann meine frühsten Wege durch Rom zurück. Der Respekt wurde größer und größer – und schlug schließlich um in Dankbarkeit: eine Welt zu erleben, die aus einem jungen Mann einen anderen Menschen machte.
Genau das verdanke ich nämlich Italien: Dieses Land hat aus mir einen anderen Menschen gemacht. Unglaublich. Aber wahr.
Hanns-Josef OrtheilKöln, Wissen/Sieg, Rom, Venedig – im Frühjahr 2020
Römisches Leben
Erste Ankunft in Rom
Anfang der siebziger Jahre bin ich nach meinem Abitur zum ersten Mal für längere Zeit nach Italien gereist. Ich war achtzehn Jahre alt und träumte davon, nach bestandenem Konzertexamen als Konzertpianist leben zu können. In Rom wollte ich mich zunächst um ein Stipendium am berühmten Conservatorio bewerben.
Seit dem fünften Lebensjahr hatte ich Klavierunterricht erhalten und mich zuletzt in meiner Kölner und Westerwälder Heimat durch intensives Üben auf die römische Aufnahmeprüfung vorbereitet. Damals sprach ich kein Wort Italienisch und fühlte mich bei meiner nächtlichen Ankunft auf der Stazione Termini zunächst unsicher und ängstlich. Dann aber durchstreifte ich Rom und erlebte eine der schönsten Nächte meines Lebens. Keinen Moment fühlte ich mich als Fremder, der eine starke Distanz zur Umgebung hätte empfinden können. Vielmehr erlebte ich Rom vom Anfang an als einen Stadtkörper, der mir entgegenkam und sich bereits während meiner ersten Schritte öffnete.
Mein nächtlicher römischer Spaziergang führte mich zum Petersplatz und am frühen Morgen auf die Höhe des Gianicolo. Von dort erhielt ich einen ersten Eindruck von der gesamten Anlage des alten Zentrums, dessen Straßen und Bauten sich lange Zeit kaum verändert hatten.
Ein Bruder meiner Mutter, der als Pfarrer in Essen lebte, hatte mir eine erste Adresse mit auf den Weg gegeben. Es war die der Kirche Santa Maria del Anima, die seit Langem die Hauskirche der deutschen Gemeinde in Rom war. Völlig unerwartet wurde ich dort spontan und herzlich aufgenommen und erhielt gleich eine erste Anstellung: Ich sollte im Frühgottesdienst die Orgel spielen.
So kam ich nicht nur in einem oberflächlichen Sinn glücklich in Rom an. Ich wurde vielmehr schon am ersten Tag meines Aufenthaltes »eingemeindet« und fühlte mich wie jemand, der sich genau dort befand, wohin er sich seit Jahren gesehnt hatte und wohin er nun auch gehörte.
Jetzt, ja. Ich sehe mich jetzt, wie ich zwei Tage nach dem endlich bestandenen Abitur auf der Stazione Termini in Rom ankomme. Ich habe nichts als meinen alten Seesack mit wenigen Utensilien dabei, und als erste Anlaufstation besitze ich nichts als die Adresse einer Kirche, die der deutschen Rom-Gemeinde gehört. Die Adresse habe ich von meinem Onkel erhalten, der mit dem Pfarrbüro der Gemeinde telefoniert und mich für den Morgen des kommenden Tages angemeldet hat.
Jetzt aber ist Nacht, es ist meine erste römische Nacht, und ich werde das wenige Geld, das ich bei mir habe, nicht für eine Übernachtung ausgeben, nein, ich werde meine erste römische Nacht im Freien verbringen. Und so gebe ich meinen alten Seesack an der Gepäckaufbewahrung ab und gehe ohne jedes Gepäck und nur mit einem kleinen Geldbetrag in der Tasche einfach los.
Ich stehe jetzt draußen im Freien, es ist kurz nach zweiundzwanzig Uhr, vor der Stazione Termini drängen sich die Ankommenden in die Busse und verschwinden ins Zentrum. Ich atme durch, ich bleibe stehen und schaue. Dort geht es zur Piazza della Repubblica, ja genau, und dort drüben ist das Thermenmuseum. Vor dem Bahnhof ballt sich eine wohltuende Wärme, die nach der langen Zugfahrt beruhigend wirkt. Ich gehe ein paar Schritte, spüre aber, dass mich etwas davon abhält, immer weiterzugehen. Ich habe es nicht eilig, ich habe Zeit, mich hier in der Nähe des Bahnhofs auf eine Bank zu setzen und nichts anderes zu tun, als zu schauen. Es sind etwa zweihundert Meter bis zur Piazza della Repubblica, einem kreisrunden Platz mit einer großen Brunnenanlage. Von dort geht der Blick einen breiten Corso hinab in die vom gelben Straßenlicht durchfluteten Häuserschluchten. Der unermüdlich fließende Verkehr. Die Kaffeearomen in der Nähe der Brunnen. Die hohen Pinien mit ihren hellbraunen, gefleckt im Neonlicht schimmernden Stämmen.
Ich setze mich auf eine Bank, es ist eine breite, kühle Marmorbank ohne Rückenlehne, es ist eine Bank für mindestens sechs Personen, die ringsum auf ihren Rändern sitzen könnten.
Ich sitze und schaue weiter, ich bin ganz ruhig, es ist seltsam, aber ich habe nicht das Gefühl, an einem fremden Ort angekommen zu sein. Woher kommt das? Warum fühle ich mich nicht fremd? Was ist mit dieser Stadt?
Ich sitze da, als könnte ich mich nicht von der Bank lösen, bevor ich diese Fragen nicht beantwortet habe. Irgendetwas ist seit meiner Ankunft geschehen, aber ich verstehe nicht, was es ist. Ich spüre nur, dass ich anders als bei meinen sonstigen Fluchten und Reisen weder eine gewisse Anspannung noch irgendeine Unruhe empfinde, im Gegenteil, ich fühle mich leicht, unbeschwert, ja kurz davor, etwas zu singen. Ich will singen? Wieso will ich singen? Was, verdammt noch mal, ist denn bloß mit mir los?
Endlich stehe ich auf, überquere den Platz und gerate unter die hohen Arkaden eines Cafés. Die Menschen sitzen draußen im Freien, niemand nimmt von mir Notiz, ich kann an all diesen kleinen Tischen entlanggehen, ohne beachtet zu werden. Und wie ist es drinnen? Ich gehe in das Café und setze mich an die lange Theke der Bar, ich will etwas auf mein Wohl trinken, ja, ich will diesen einzigartigen Moment feiern, meine Freude, meine Erleichterung.
Als ich den Caféraum verlasse und wieder draußen unter den Arkaden stehe, habe ich die Ankunft hinter mir. Wie leicht und schön es war, in Rom anzukommen! Und wie leicht mir hier alles fällt! Ich spüre mich kaum noch, ich habe fast keine Erinnerung mehr daran, wie umständlich und schwer alles einmal war! Ist das Freude? Reine Freude? Ist das, was ich gerade empfinde, nicht die reinste, unbeschwerteste Freude?
Als sich die Fragen und Gedanken so zuspitzen, spüre ich eine plötzliche Hitze im Kopf. Es ist wie ein glimmendes Kribbeln, wie ein sich entzündendes kleines Feuer, das Flammen nach allen Seiten sprüht. Was ist mit mir? Ich verlasse den Arkadenbereich rasch und eile zurück zu der Marmorbank, auf der ich zuvor gesessen habe. Ich zwinge mich, jetzt an nichts Schlimmes zu denken, aber es geht schon, die Hitze lässt bereits nach. Ich brauche mich nicht zu beunruhigen, nein, ich brauche es nicht. Und warum nicht? Weil ich fort bin, ja, ich bin fort, ich lebe nicht mehr in dem Land, in dem ich so viel Angst ausgestanden habe, ich bin fort.
Als sich diese drei Worte immer wieder in meinem Kopf wiederholen, verstehe ich plötzlich, was seit meiner Ankunft in Rom geschehen ist. Ich fühle mich frei, ja, das ist geschehen, die Ankunft in Rom ist verbunden mit dem Gefühl einer einzigen, großen Befreiung. Niemand umkreist mich, nichts rückt mir auf den Leib, man lässt mich in Ruhe, zum ersten Mal in meinem Leben lässt man mich ganz und gar in Ruhe. Ich bin fort, murmle ich und sage dann den ersten lauten Satz in der Ewigen Stadt: Johannes, du bist jetzt fort! Und weiter: Ich bin draußen, ich habe es endlich geschafft.
Etwas später habe ich mir das Gesicht mit dem Wasser eines großen Brunnens gewaschen und gehe wirklich den breiten Corso hinab in die Stadt. Von einem der römischen Hügel gehe ich hinab in die römische Ebene. Dort sind die Kaiserforen, und dort hinten, das ist das Kolosseum. Ich gehe eine breite, nur noch wenig befahrene Straße an den Kaiserforen entlang auf das Kolosseum zu. Ich bleibe nicht vor ihm stehen, sondern umrunde es langsam. Von den sandigen Höhen, die es umgeben, weht ein weicher Kieferngeruch. Überall verstreut auf dem Boden liegen die Nadeln, braun und von der Sonne verbrannt. Der römische Teppich, der Teppich aus Pinien- und Kiefernnadeln.
Ich will jetzt nirgends lange verweilen, sondern eine nächtliche Spur durch die Ewige Stadt ziehen. Deshalb bewege ich mich einfach weiter und gehe die breite Straße zurück. In den dunklen, kaum angestrahlten Ruinen- und Tempelzonen brennen kleine Feuer. Ich sehe Menschen hin und her huschen, aber ich kümmere mich nicht weiter darum. Mein Ziel ist der Corso, die breite Gerade, die das römische Herz der alten Wohngegenden wie ein scharfer, massiver Hieb durchschneidet. Ich gehe auf einen fernen Obelisken zu, ich habe ihn fest im Blick.
Als ich ihn erreicht habe, biege ich linker Hand Richtung Tiber ab. Dort muss der Tiber sein, und dort ist wahrhaftig der Tiber. Ich habe den Plan der römischen Innenstadt genau im Kopf, ich sehe ihn vor mir, Vater wäre stolz, wie genau ich den römischen Stadtplan im Kopf habe. Und wo ist Norden? Ich weiß genau, wo Norden ist, etwas nördlich des großen Obelisken muss sich die Milvische Brücke befinden, an der Konstantin gesiegt hat. Ich werde mir irgendwann einen ganzen Tag und eine Nacht Zeit für diese Brücke nehmen. Jetzt, wo ich auf den dunklen Tiber in der Tiefe blicke, ahne ich, wie es an der Milvischen Brücke aussieht. An den tief liegenden, breiten Ufern werden Feuer brennen, und die Bogen der alten Brücke werden im Wasser matt schimmern.
Ich gehe aber nicht nördlich, sondern mit der Strömung des Flusses. Die hoch liegenden Uferstraßen werden von mächtigen Platanen gerahmt. Allmählich lässt der Verkehr nach, ich passiere mehrere Brücken, und dann, unerwartet, nach einer kleinen, unmerklichen Krümmung des Flusses, ist es so weit: Ich sehe die Peterskirche, ich sehe sie jenseits des Flusses, ich sehe die ausatmende, mächtige, ruhende Kuppel und das schwache, letzte Licht in ihrer schmalen Laterne hoch oben. Das Bild, das ich sehe, erscheint unglaublich entrückt, denn das, was ich nun sehe, ist keine Kirche mehr, sondern wirkt wie ein unbetretbares Jenseits. Wer hat das gebaut? Hat das überhaupt jemand gebaut? All das, was ich sehe, wirkt so makellos schön und so stimmig, als handelte es sich um eine Verkörperung der Schönheit selbst, um eine Verkörperung ihrer Idee, wie das Maß aller Dinge. Ich kann diesen Bau nicht in seinen Einzelheiten betrachten, sondern sehe ununterbrochen das Ganze, und dieses Ganze erscheint wie ein Modell.
Ich gehe über die Engelsbrücke hinüber zur Engelsburg, passiere sie aber, ohne sie weiter zu beachten. Dann biege ich auf die menschenleere Straße ein, die direkt auf die Peterskirche zuführt. Ich schaue auf die Uhr, es ist kurz nach zwei, mitten in der Nacht. Gleich werde ich den Petersplatz erreichen. Das große Oval liegt im Dunkel, nur die beiden Brunnen rauschen noch leise. Ich gehe auf den Obelisken zu und setze mich auf die Stufen, die zu seiner Basis führen. Ich habe die Peterskirche jetzt im Blick, das Hauptportal, die Loggia, die beiden Uhren, die Apostel Petrus und Paulus zu beiden Seiten und die ausschwingenden Kolonnaden. Hier werde ich eine Weile sitzen, hier werde ich das erste Licht abwarten.
Seltsam, dass ich nicht müde bin. Ich habe eine lange Zugfahrt hinter mir, komme mir aber vor, als wäre ich vollkommen frisch und bereits seit vielen Tagen hier. Lange habe ich nichts gegessen, aber das macht nichts. Ich habe zwei Gläser Wein und hier und da Wasser aus einem Brunnen oder einem der Wasserspender an den Straßen getrunken. Ich habe das starke Summen der Stadt noch in den Ohren, jetzt aber verebbt es langsam. Das vereinzelte Quietschen von Busbremsen. Der Windhauch, der lange auf dem Platz kreist und dann durch die Kolonnaden abzieht. Die klar leuchtenden Sterne, hinter die Kuppel gespannt, wie Leuchtsignale auf schwarzem Tuch. Ich lehne mich zurück gegen die Basis des Obelisken, ich strecke die Beine aus, was höre ich denn, ah, das ist es also, was ich höre, ich höre den alten Gesang: Deus, in adjutorium meum intende/ Domine, ad adjuvandum me festina … – zwei-, dreimal höre ich dieses Summen, wie einen Refrain meines ersten römischen Spaziergangs. Herr, ich danke Dir, dass Du mich hierhergeführt hast, Herr, ich danke Dir! Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, auf grünen Auen lässt er mich lagern; an Wasser mit Ruheplätzen führt er mich …
Ich sitze wahrhaftig bis zum Morgengrauen. Da kenne ich die breite Fassade der Peterskirche bis ins letzte Detail. Ich habe gesehen, wie sie weich wurde von der Wärme der Nacht, wie sie nachgiebig schwankte und in der morgendlichen Frühe wieder zu erstarren begann. Ich stehe auf und laufe auf dem weiten Platz ein paar Runden, sehr langsam, immer an den Kolonnaden entlang. Dann setze ich mich ab und folge weiter dem Fluss. Zu meiner Rechten führt eine Straße steil in die Höhe, das ist gut, ja, es könnte schön und genau das Richtige sein, jetzt diesen Hügel hinaufzugehen, um von dort oben auf die morgendliche Stadt zu schauen. Eine Kirche, eine Pinienallee, zwei Hunde, die mir voranlaufen.
Oben, auf der Höhe des Hügels, liegt mir die Stadt im dünnen Morgenlicht zu Füßen. Die Häuser und Bauten wie geduckt, und darüber die Kuppeln der vielen Kirchen. Die Kirchen werden mir ein gutes Zuhause sein, ja, das ahne ich schon. Immer, wenn ich für einen Augenblick ein gutes Zuhause brauche, werde ich in eine der vielen Kirchen gehen. Sitzen, warten, ein Gebet sprechen, vielleicht aber auch schauen, ob es eine Orgel gibt, auf der ich spielen kann.
Wie leicht wird es sein, in dieser Stadt zu leben, ganz leicht. Eine Kirche, ein Café, eine Unterhaltung, noch eine Unterhaltung, diese Stadt ist wie für mich geschaffen, einerseits lässt sie mich vollständig in Ruhe, und andererseits bietet sie mir alles, was ich brauche. Das, was ich brauche, ist einfach vorhanden, an jeder Ecke, es steht da zur freien Verfügung.
So müssten alle Städte gebaut sein, nicht zu hoch, mit ihren Häusern in eine Flusskrümmung geschmiegt, alles dicht, sehr dicht beieinander, viele kleinere Plätze, Pinienalleen, ein Kranz von Hügeln und überall unerwartete Orte der Stille. Und viele Kirchen, an jedem Platz eine Kirche. Im Grunde ist das Zentrum Roms leicht zu überblicken, es ist nicht allzu groß, es ist eine weite, verstreute Sonnenlandschaft mit einigen Thronsitzen und Aussichtsterrassen.
Ich setze mich auf eine Balustrade und lasse die Beine baumeln. Ich versuche, einige der vielen Bauten zu erkennen. Kurz schließe ich die Augen und lasse den römischen Stadtplan vor meinem inneren Auge entstehen, um in Gedanken ein Stück durch Rom zu wandern. Hier unterhalb, das muss das Viertel Trastevere sein, und dort oben, zur Rechten, das ist der Aventin mit seinen Klöstern. Was die Patres wohl sagen würden, wenn sie mich hier sähen! Einer von ihnen hat einmal vermutet, dass aus mir noch ein Priester oder sogar ein Mönch werden könnte. Jetzt kann aus mir aber kein Priester mehr werden, diese Versuchung habe ich hinter mir.
Als wenige Meter von mir entfernt eine kleine Bar geöffnet wird, gehe ich sofort hin. Der Mann hinter der silbernen, gerade sauber gewischten Theke begrüßt mich leise, und ich murmle die Klanglinie nach, die ich gerade gehört habe, ohne ein Wort zu verstehen. Er fragt mich etwas, wahrscheinlich nennt er den Namen eines Getränks, ich wiederhole, was er gesagt hat, und sofort beginnt er, sich um mein Getränk zu kümmern. Es kommt wenig später in einer großen weißen Tasse und duftet nach einem starken Kaffee. Seine Oberfläche aber ist mit dichtem Milchschaum bedeckt. Etwas Kakao? Ja, das habe ich jetzt sogar verstanden, etwas Kakao!
Es ist ganz einfach, mit diesem Mann zu sprechen, er baut sich nicht vor mir auf und macht aus mir keinen sprachlosen, fremdsprachigen Clown, nein, er bietet mir laufend Bruchstücke seiner eigenen Sprache an. Ich muss nur genau hinhören und sie aufschnappen und sie dann wieder zurückgeben.
Ich habe verstanden, ich habe bereits ein wenig verstanden, wie das Italienische geht. Das Italienische geht vollkommen anders als das Deutsche. Es ist ein Geben und Anbieten von Sätzen, die das Gegenüber dann wieder zurückgibt. Was der eine sagt, greift der andere auf, dreht es um eine Nuance und sagt dann den Satz leicht verändert noch einmal. Und so geht es weiter und weiter, ohne Pause. Es ist mit einem guten Duett zu vergleichen, mit Gesang und Gegengesang. Das Deutsche aber ist anders. Im Deutschen sagt einer einen Satz, um den Satz irgendwo in die Landschaft zu stellen und dort stehen zu lassen. Danach ist es still. Derjenige, der antwortet, sagt einen anderen Satz und stellt ihn in etwas größerer Entfernung ebenfalls in die Landschaft. So ist zwischen den Sätzen viel Raum und viel Schweigen.
Ich tauche die Lippen in den weichen, porösen Milchschaum und nippe an dem Getränk. Durch die dichte Milchdecke sauge ich an einem sehr starken Kaffee, dessen Wirkungen ich sofort spüre. Nach dem zweiten Schluck ist jede Müdigkeit verflogen, und ein wohltuendes Leben durchströmt den ganzen Körper. Acqua?, fragt der Mann hinter der Theke, und ich sage: Acqua! Latein ist die höflichste Sprache überhaupt, Latein ist uneitel, sanft, geduldig und hilfreich, so wie jetzt, wo ich es einfach verwenden kann, um zu sagen, dass ich Durst habe.
Ich trinke die Tasse Kaffee leer und anschließend noch das Glas Wasser, ich zahle, der Kellner schaut nicht lange auf und verabschiedet mich wieder mit einem Gruß. Wir sprechen so leise miteinander, als befänden wir uns in einer Kirche oder als dürften wir niemanden stören oder als wären wir alte Freunde. Im leisen, vorsichtigen Sprechen des Kellners ist von alldem etwas, und darüber bin ich denn doch so erstaunt und verwundert, dass ich beim Abgang hinab in die Ebene vor mich hin summe. Nein, ein Sänger werde ich gewiss nicht mehr werden, aber ich werde in dieser Stadt ein guter Pianist werden, ja, auch das weiß ich jetzt bereits genau. Und wieso weiß ich das? Und was soll das heißen, dass ich in dieser Stadt ein guter Pianist werde?
Ich bin gerade unten in der Ebene auf einem Platz angekommen, wo viele Marktstände aufgebaut sind und längst Gemüse und Obst, Käse, Wurst und Brot verkauft werden. Moment, einen Moment! Was habe ich gerade gedacht? Ich werde in dieser Stadt ein guter Pianist werden! Ja und? Und was heißt das? Das heißt, mein Gott, das heißt, dass ich nicht für zwei Wochen in die Ewige Stadt gereist bin, nein, auch nicht für drei. Ich bin hierhergereist, um ein guter Pianist zu werden, deshalb bin ich hierhergereist. Das hier ist also keine Ferienreise, sondern eine Reise dorthin, wo aus mir ein guter Pianist werden wird.
Ich werde also hier in Rom mein Studium beginnen, natürlich, das ist jetzt bereits klar. Ich werde diese Stadt nicht wieder verlassen, nein, ich werde sie auf keinen Fall wieder verlassen, sondern mich hier um einen Studienplatz bewerben. Dass ich diese Idee nicht längst hatte! Aber ich konnte diese Idee ja noch gar nicht haben, weil ich diese Stadt ja noch nicht so kannte, wie ich sie jetzt bereits kennengelernt habe. Nach meiner ersten römischen Nacht ist jedoch alles anders. Ich gehe hier nicht mehr weg, denn ich bin genau an dem Ort und in der Stadt angekommen, wo ich nun hingehöre. Ich gehöre nach Rom, für ein Jahr, für zwei Jahre, vielleicht sogar für immer.
Ich lache, ich kenne mich nicht mehr wieder. In mir ist eine Ausgelassenheit, wie ich sie noch nie erlebt habe. Was habe ich mir für unnötige Sorgen gemacht, wie falsch habe ich jahrelang darüber gegrübelt, ob es mit mir im Ausland gut ausgehen würde. Was für ein Unsinn ist das alles gewesen, was für ein merkwürdig verschrobenes, verqueres Denken! Rom ist doch gar kein Ausland, ach was, Rom ist das eigentliche Inland, ja, Rom ist das Inland.
In der Mitte des Marktes trinke ich an der Theke einer Bar erneut einen Kaffee und esse dazu eine Art von Croissant, für die ich keinen Namen habe. Im Französischen sagt man Croissant, doch dies hier ist kein Croissant, sondern die Variation eines Croissants. Sie ist noch warm und schmeckt nach einem Hauch duftender, guter Butter, die sich jedoch ganz in den Teig verzogen hat. Der Milchschaumkaffee und die Variation eines Croissants, das werde ich jetzt jeden Morgen essen, das reicht, damit werde ich ein paar Stunden auskommen.
Es wird heller und heller. Das Sonnenlicht glimmt zunächst oben an den Giebeln der Häuser und fällt dann hinab in die Schluchten. Auf dem Marktplatz wälzt es sich bereits zwischen den Ständen. Die Menschen bewegen sich nicht besonders schnell, sie sprechen unaufhörlich miteinander, aber nie allzu lange, sondern meist nur ein paar Minuten, danach setzen sie ihren Weg fort. Was gäbe ich darum, mich einmal so unterhalten zu können! Im Grunde ist auch diese Art von Unterhaltung wie für mich geschaffen! Kein Ausfragen und Anstarren, keine schweren Einzelsätze, in die Landschaft platziert! Stattdessen ein Auftakt, eine Wiederholung, eine Variation, ein Abgesang! So etwas könnte ich sogar lernen, ja, bestimmt, nach einer Weile werde ich so etwas ebenfalls können. Vielleicht ist das Italienische die einzige Fremdsprache, die ich am Ende einmal wirklich beherrschen werde. Vielleicht.
Ich überquere den Tiber und sehe die Kuppel der Peterskirche jetzt aus der Entfernung. Seltsam, sie schrumpft nicht, im Gegenteil, sie bleibt immer dieselbe noble, ideale Erscheinung, ob man sie nun aus der Nähe oder der Ferne betrachtet. Sicher liegt der Konstruktion dieses Baus ein Geheimnis zugrunde, anders kann ich mir seine Wirkungen auf den Betrachter nicht erklären. Ich werde Zeit haben, das herauszubekommen, vielleicht werde ich sogar Zeit haben, neben meinem Klavierstudium noch Kunstgeschichte zu studieren.
In Rom Kunstgeschichte zu studieren – auch auf diese sehr naheliegende Idee bin ich in Deutschland nicht einmal gekommen. Jetzt aber habe ich einen Plan, ein Projekt, eine Zukunft. Was ich nun noch brauche, ist ein preiswertes, gutes Quartier. Ein einfaches Zimmer mit einer schmalen, flachen Liege, einem Tisch, einem Schrank. Mal sehen, immerhin habe ich eine Adresse, die Adresse der deutschen Gemeinde in Rom. Ihre Kirche liegt ganz in der Nähe der Piazza Navona.
Wenig später erreiche ich die Piazza, und als ich sie betrete, werde ich von dem Eindruck erneut überwältigt. Ich nähere mich durch eine schmale Gasse und stehe dann plötzlich mitten im Licht einer weiten, ovalen Öffnung. Ein Haus fügt sich nahtlos ans andere, so dass der Platz wie die Bühne eines Theaters erscheint und die Häuser ringsum wie Kulissen. Drei Brunnen messen die Länge des Platzes aus. Ein wenig erinnert das alles an den ovalen Platz vor unserem Kölner Wohnhaus, nur dass dort die Häuser von sehr unterschiedlicher Größe waren und daher keinen homogenen Eindruck erweckten. Ich gehe bis zur Mitte und setze mich an den Rand des größten Brunnens. Direkt gegenüber befindet sich eine Kirche. Der Platz ist fast vollständig leer, selbst die umliegenden Cafés sind noch nicht geöffnet. Das Sonnenlicht füllt ihn in seiner vollen Länge, der Platz badet bereits in diesem Licht.
Ich sitze eine Weile auf dem Brunnenrand und frage mich, wann ich jemals so glücklich gewesen bin wie gerade jetzt. Und wodurch entsteht dieses Glück? Durch das Licht, durch die großzügige Wohnlichkeit all dieser Räume und dadurch, dass ich weder an die Vergangenheit noch an die Zukunft denke. Ich lebe jetzt, in diesem Augenblick, ich bin hier, nun muss ich nur noch die ersten Kontakte knüpfen.
Die Kirche der deutschen Rom-Gemeinde liegt nur wenige Schritte entfernt. Ich mache mich auf den Weg dorthin und biege in eine kleine Gasse ein, ja, es sind wirklich nur wenige Schritte. Da ist die Kirche, Santa Maria del Anima, ich habe sie gleich entdeckt. Ich gehe hinein, es ist kurz nach acht, anscheinend hat bereits ein Frühgottesdienst stattgefunden, der Weihrauchduft ist noch sehr stark.
Ich setze mich in eine Bank und schaue mir alles an. Da bleibt mein Blick an der kleinen Chororgel neben dem Altar hängen. Es ist eine Orgel, wie man sie zur Begleitung des Gesangs der Gemeinde benutzt, es ist eine Gottesdienstorgel, in der Klosterkirche habe ich oft auf einer solchen Orgel gespielt. Ich kann die starke Anziehung, die von ihr ausgeht, nicht unterdrücken. Ich gehe hin und nehme an ihr Platz, ich beginne, auf ihr zu spielen, ich sitze an meinem ersten römischen Morgen in der Kirche Santa Maria del Anima und spiele die Orgel.
Nach wenigen Minuten erscheint ein Priester. Er unterbricht mich nicht, nein, er macht sogar ein Zeichen, dass ich zu Ende spielen soll. Ich spiele einen Choral von Johann Sebastian Bach, ich spiele den alten Choral Jesu bleibet meine Freude, es ist ein Stück, das ich immer wieder von großen Pianisten gehört habe, so etwa von Dinu Lipatti, der es am ergreifendsten in seinem letzten Konzert kurz vor seinem Tod gespielt hat.
Als ich den Choral beendet habe, stehe ich auf, gehe auf den Geistlichen zu und spreche ihn auf Deutsch an. Ich erkläre ihm, wer ich bin und was mich in diese Kirche geführt hat. Der Geistliche spricht ebenfalls Deutsch, er gibt mir die Hand und fordert mich auf, ihn in die Räume des Konvents zu begleiten, die an die Kirche angeschlossen sind. Sie spielen sehr gut, sagt der Geistliche und geht etwas voran. Dann aber bleibt er mitten im Gehen stehen und dreht sich noch einmal nach mir um: Hätten Sie Zeit und Lust, in unseren Frühgottesdiensten werktags diese Orgel zu spielen?
Ich schaue ihn an, ich glaube, nicht richtig zu hören. Dann aber antworte ich: Ja, ich habe Zeit und Lust, die habe ich natürlich auch. Wenn Sie wollen, kann ich schon morgen früh anfangen.
Goethes Ankunft in Rom
Während meines ersten Rom-Aufenthaltes beschäftigte mich vor allem Goethes »Italienische Reise«, denn ich wollte genauer erfahren, wie Goethe sich Rom angeeignet hatte und wie er im Detail dabei vorgegangen war.
Es war nicht schwer, ihm auf seinen römischen Spuren zu folgen, zumal sich die Stadt in ihrem Zentrum noch in denselben architektonischen Formationen präsentierte wie zu Goethes Zeiten im späten achtzehnten Jahrhundert. Am 29. Oktober 1786 war er mit dem Reisewagen von Norden kommend auf der Piazza del Popolo angekommen. In der nahe gelegenen Locanda dell’orso hatte er die erste Nacht verbracht, bevor er am nächsten Morgen zu seinem Freund, dem Maler Tischbein, in die Via del Corso gewechselt war und in dessen Mietwohnung ein Zimmer bezogen hatte.
So manchen Abend stellte ich mir auf der Piazza del Popolo Goethes Ankunft in Rom ganz konkret vor. Allmählich bemerkte ich, dass diese Imaginationen denen eines Voyeurs glichen, der die Ankunft beobachtete. Durch solches Phantasieren entstand die zweite Hauptfigur meines später geschriebenen Romans Faustinas Küsse, der von Goethes Rom-Aufenthalt aus dem Blickwinkel des römischen Vagabunden Giovanni Beri erzählt. Mit den Tagen wird aus dem Voyeur Beri ein Spion, der Goethes Leben in Rom auf seine ganz eigene Weise erkundet …
Am frühen Abend des 29. Oktober 1786 sah der junge Giovanni Beri, der eben auf einem herbeigerollten Stein Platz genommen hatte, um in Ruhe einen Teller Makkaroni zu verzehren, einen Fremden dem aus nördlicher Richtung auf der Piazza del Popolo eingetroffenen Reisewagen entsteigen. Beri hatte gerade die Finger seiner Rechten in die noch heißen Nudeln getaucht, um sie bündelweise, wie weiße Würmer, in den Mund zu schieben, als der Fremde seinen Reisehut lüftete und ihn immer wieder hoch in der Luft schwenkte, sich dabei im Kreise drehend, als wollte er sich der ganzen Stadt Rom als Liebhaber und Freund präsentieren.
Der junge Beri hatte schon viele Reisende aus dem Norden auf diesem ehrwürdigen Platz ankommen sehen, doch noch selten hatte sich einer so merkwürdig benommen wie dieser stattlich gewachsene Mann in weitem Überrock, dem sich jetzt eine Gruppe von Wachbeamten näherte, um seinen Namen in die dafür vorgesehenen Listen einzutragen. Das Betragen des Fremden ähnelte einem Auftritt im Theater, es hatte etwas von Leidenschaft und großer Aktion, und doch fehlten ihm auf dem weiten Platz, der durch die Parade der Kutschen beinahe vollgestellt war, die passenden Zuschauer.
»Mach weiter so, mach nur weiter!« dachte Beri, insgeheim belustigt, während er mit Daumen und Zeigefinger nach den entwischenden ölgetränkten Nudeln griff und sie langsam durch den über den Teller verstreuten Käse streifte. Jetzt riss sich der Fremde den Überrock vom Leib, warf den Hut auf den kleinen Koffer, breitete die Arme aus und dehnte den ganzen Körper wie eine gespannte Feder. Beri grinste, vielleicht hatte man es mit einem Schauspieler zu tun! Doch das Grinsen verschwand augenblicklich, als er bemerkte, dass ihn das merkwürdige Gebaren zur Unachtsamkeit verführt hatte. Für einen Moment hatte sich der Teller offensichtlich in Schräglage befunden, ein kleinerer Haufen der köstlichen Makkaroni lag schon auf dem Boden.
»Daran bist du schuld!« entfuhr es Beri, der sich jedoch gleich darüber wunderte, wie brüderlich er den Fremden insgeheim anredete. Irgendetwas Anziehendes hatte dieser Tänzer, irgendetwas, das einen noch schlummernden Teil seiner Seele berührte! Beri hielt den Teller für einen Augenblick mit der Rechten und fuhr sich mit der Linken durchs Gesicht. Träumte er? Hatte ihm das Glas Weißwein zugesetzt, das er an diesem warmen Nachmittag getrunken hatte?
Der Fremde ließ die Wachbeamten einfach stehen. Er durchmaß den weiten Platz mit großen Schritten, stemmte dann und wann die Hände in die Hüften, ging in die Hocke, drehte sich plötzlich nach allen Seiten und warf immer wieder die Arme in die Höhe, als wollte er die ganz fernen Abendwolken herbeilocken, zu seinem Auftritt tanzend zu wirbeln. »Warte nur«, dachte Beri, »das geht nicht lange gut«, doch die beiden Wachbeamten, die den Mann endlich erreicht hatten, wurden dadurch überrascht, dass der Fremde sich nun rasch in Bewegung setzte, zunächst quer über den Platz, dann, langsamer werdend, im Kreis um den hohen Obelisken, der etwa in der Mitte des Platzes stand.
Immer dann, wenn die hinter dem Fremden herhastenden Beamten ihr Opfer gestellt zu haben schienen, brach der Herumeilende wieder nach einer anderen Seite aus, so unerwartet, so gewitzt, als wollte er mit den beiden atemlos werdenden Verfolgern seinen Spaß treiben. Beri lächelte, dann aber begann er immer lauter zu lachen; er hielt den warmen Teller krampfhaft in der Rechten, um nichts von der wertvollen Speise zu verschütten, doch das Lachen rüttelte ihn so durch, dass die weißen Nudelkäsewürmer auf dem Teller zu tanzen begannen. Immer wilder hüpften sie umeinander, sprangen über den Rand, warfen sich übermütig auf das Pflaster, so dass Beri, lauthals lachend, den Tränen nahe, sie in einem Gefühl plötzlichen Überschwangs in einem großen Bogen durch die Luft fliegen ließ.
Was tat er? Warum war er so außer sich? Der Fremde schien das üble Spiel, das er mit den beiden Wachbeamten trieb, gar nicht zu bemerken, jetzt hatten sie ihn eingeholt, an der kleinen Wasserstelle neben dem Obelisken, einer von ihnen hatte ihn fest zu packen bekommen, oben, an der Schulter, so dass er sich heftig herumdrehte.
Was für eine Nase! Beri grinste, ruhiger werdend. Was für ein unruhiger Mund, die Lippen zuckten unaufhörlich, als hätten sie sich an den heißen Würmern verbrannt! Nun hatten sie ihn also gestellt, nun würde er niemandem mehr entkommen!
Beri saß da mit offenem Mund, der leere, ölverschmierte Teller glitt ihm aus der Hand und zersprang auf dem Pflaster. Der Fremde umarmte die beiden Beamten. Er drückte sie an sich, als sei er guten Freunden begegnet, er hakte sich bei ihnen ein und ging mit ihnen langsam, schlendernd, als habe er sie nie düpieren wollen, zu seinen Koffern zurück. Jetzt hatte er beide Arme um ihre Schultern gelegt, sie lachten sogar, sie ließen es sich gefallen, offenbar machte er einige Scherze, offenbar unterhielt er sie gut.
Beri hustete. Der Teller war zersprungen, über die Nudeln machten sich die Katzen her. »Du bist mir was schuldig«, dachte er und wischte sich mit der Linken über den Mund. Dann stand er langsam auf, streckte sich, scharrte die Scherben des Tellers mit der Fußspitze zusammen und ging quer über den Platz, dem Fremden seine Dienste anzubieten.
Der aber gestikulierte noch vor den Wachbeamten, als Beri sich der Gruppe mit einem der hölzernen Karren näherte, die auf dem weiten Platz zu jedermanns Gebrauch abgestellt waren. Jetzt hörte er den Fremden sprechen, er sprach ein fehlerhaftes, aber frisch daherfließendes Italienisch, das sich aus lauter aufgeschnappten Wendungen zusammenzusetzen schien. Auch auf die Beamten schien er einigen Eindruck zu machen, denn immerhin hatten sie sich auf eine kurze Verhandlung darüber eingelassen, ob er den Reisewagen wieder besteigen müsse oder den Weg zum Packhof auf eigenen Wunsch zu Fuß zurücklegen dürfe.
Als der Mann den jungen Beri mit seinem Karren gewahr wurde, geriet die Szene gerade zu einer kleinen Debatte. Die Wachbeamten bestanden darauf, dass er mitsamt seinem Gepäck wieder einsteigen müsse, während er Beri als einen guten Geist vorstellte, der das Gepäck auf dem kleinen Karren rasch zum Packhof befördern werde.
Die Widerreden schienen sich immer mehr zu beschleunigen, als der Neuankömmling plötzlich ruhig wurde, sich sammelte, den Blick starr in die Richtung der langen Meilen des Corso richtete und mit wiederum verblüffender Hingabe davon sprach, wie schön der Abend sei. Die Wachbeamten schienen sich auch sofort zu besinnen, sie schauten seinen Blicken hinterher, der mit einem Male in beredten Worten den leuchtenden Abend schilderte, die sonntäglichen Paradefahrten der Kutschen hin zur Piazza Venezia, das Leben auf den Balkonen, das Rufen, Winken und Plärren aus den Fenstern, alles aber so freundlich und warm, als begrüßte er Szenen seiner Heimat.
Die Wachbeamten fragten denn auch sofort nach, ob der Fremde Rom schon früher einmal besucht habe, worauf er erwiderte, mit seiner Seele habe er die Stadt bereits Hunderte von Malen in Besitz genommen, während er nun bemüht sei, auch seinem Körper die Gegenwart dieses Paradieses zu gönnen.
Die unerwartete Erwähnung des Paradieses (»il paradiso«, sagte er, mit einem solchen Nachdruck auf dem langen »i«, als wollte er immerfort darin verweilen) in Verbindung mit der Stadt Rom ließ die Wachbeamten jedoch anscheinend umdenken. Durch ein knappes Zeichen verständigten sie sich darauf, dass der Fremde den eingetroffenen Postkutschen auf dem Weg zum Packhof zu Fuß folgen dürfe. Einer von ihnen setzte sich denn auch bald an die Spitze des Zuges, und so ging es den Corso hinab, die Kutschen voran, der große Mann hinterdrein und ganz am Schluss der junge Beri mit seinem Karren, auf dem man das Gepäck des Fremden untergebracht hatte.
Jetzt hatte Beri wieder Zeit, ihn zu beobachten. Hatte er ihn vor wenigen Minuten noch für einen Schauspieler gehalten, so war er sich längst nicht mehr sicher. Denn nun, auf dem Weg zum Packhof, wirkte er inmitten der großen Menschenmenge, die den Corso entlang flanierte, plötzlich wie einer der Vielen, nicht fremd, nicht herausgehoben, sondern… wie, »ja, wie ein Sohn, der nun heimkommt«, dachte Beri, als er bemerkte, dass der Neuankömmling den Menschen auf den Balkonen zuwinkte. »Er tut so, als hätten sie gerade auf ihn gewartet«, dachte Beri weiter und lächelte vor sich hin, als sich der Fremde unerwartet zu ihm umdrehte und wartete, um neben ihm hergehen zu können.
»Du bist von hier?« fragte er, und Beri beeilte sich zu bestätigen, dass er ein Römer sei.
»Wie alt bist du?«
»Zweiundzwanzig«, antwortete Beri.
»Leben deine Eltern noch?«
»Nein, Signore«, antwortete Beri, »meine gute Mutter ist vor einem Jahr, mein Vater vor acht Jahren verstorben.«
»Und du, wovon lebst du?«
»Ich arbeite mal hier, mal dort, wie es sich so ergibt.«
»Hast du kein Handwerk gelernt?«
»Nein, Signore. Mein Vater war Fährmann auf dem Tiber, und ich erhielt später keine Lizenz, da ich zu jung war, als er starb.«
»Hast du noch Geschwister?«
»Einen jüngeren Bruder, Signore, der sich nach dem Tod unserer guten Mutter davongemacht hat. Ich hatte ihr versprochen, für ihn zu sorgen, doch er …«
Beri kam nicht weiter, denn der fremde Mann war inmitten des Getümmels plötzlich stehen geblieben. »Schau!« rief er und deutete auf die nahe Fassade einer Kirche.
»Was ist?« fragte Beri.
»Das ist außerordentlich«, sagte der Fremde.
»Pah«, entfuhr es Beri, »von solchen Kirchen haben wir Tausende.« Beri tat der leichtfertig hingesagte Satz sofort leid, als er bemerkte, dass ihn der andere als hochmütig zu verstehen schien. Nun wollte er sich nicht weiter unterhalten, sondern ging schnelleren Schrittes wieder voraus, still, in sich gekehrt, als habe Beris Bemerkung ihn in seinem Überschwang gebremst. Beri bemühte sich, mit seinem Karren Schritt zu halten.
»Dort«, rief er dem Mann hinterher, »dort … schauen Sie, Signore, San Carlo al Corso!«
Anstatt sich umzudrehen und seinen Hinweis zu beachten, schaute er sich jedoch kein einziges Mal mehr um. Beri hatte es jetzt schwer, ihm zu folgen, so eilig blieb er hinter den Kutschen. Erst als man auf dem Packhof ankam, würdigte der Fremde ihn wieder eines Blickes.
»Wenn das hier vorbei ist, wird er mich zur Locanda begleiten«, sagte der Fremde.
»Zum Spanischen Platz, wo die Fremden ihr Quartier nehmen?« fragte Beri.
»Ich gebe ihm schon Bescheid«, wich der Fremde aus und bedeutete Beri, wohin er das Gepäck zu bringen habe.
Im Packhof musste man einige Zeit warten, endlich war auch der Fremde an der Reihe. Die beiden kleinen Koffer wurden geöffnet, allerhand Bücher kamen zum Vorschein, sogar eine Sammlung von Steinen, dazu Papiere und Hefte, Kleidung obenauf, auch der Mantelsack und ein kleiner Dachsranzen wurden geleert. Die Bücher wurden zur Kontrolle über Nacht einbehalten, der Fremde erhielt eine Marke und konnte den Packhof mit seinen übrigen Sachen wieder verlassen.
Sofort war Beri mit seinem Karren zur Stelle.
»Zur Locanda dell’orso!« entschied der Fremde.
»Die Locanda, Signore, liegt nicht am Spanischen Platz, sie liegt abseits, am Tiber«, sagte Beri.
»Zur Locanda dell’orso!« wiederholte der Fremde, lauter als zuvor, und Beri nickte.
Jetzt ging er wieder hinter ihm her. Mit einem Mal hatte der Mann aus dem Norden etwas Stolzes, Unnahbares, als wollte er sich kein zweites Mal mit Beri gemein machen. »So sind sie, die hohen Herren!« dachte Beri erbost, fragte sich dann aber sofort, warum er ihn nun für einen hohen Herrn hielt. Seine beinahe abenteuerliche Kleidung, die lose Weste mit den verschmutzten Ärmeln, die halblange, schäbige Hose und die leinenen Strümpfe machten ihn jedenfalls nicht zum hohen Herrn, höchstens sein jetzt fester, abweisender Blick.
Vor der Locanda setzte Beri den Karren mit einem leichten Stöhnen ab. Der Mann wollte den Gasthof schon betreten, als er zur Linken den Tiber gewahr wurde und sich umdrehte. »Mein Gott!« entfuhr es ihm, und Beri folgte seinem Blick, der sich nun auf die nahe Engelsburg und die große Kuppel von Sankt Peter richtete, die hinter der Tiberschleife im weichen Abendlicht auftauchten.
»Sankt Peter«, sagte Beri, »die Stätte des Heiligen Vaters!«
Doch der Fremde schien ihn nicht mehr zu hören. Er starrte hinüber auf das über den Wassern aufschimmernde Bild, ohne sich noch zu regen. Die Lippen waren straff zusammengespannt, der Kopf lag beinahe im Nacken, und die Augenbrauen schienen ein wenig zu zucken, als müssten sie eine aufdringliche Erscheinung verscheuchen und abwehren.
Beri wartete, minutenlang. Er trat auf der Stelle und traute sich nicht, noch etwas zu sagen. Was war mit dem Mann? Fühlte er sich nicht wohl? Beri betrachtete ihn verstohlen von der Seite, um Anzeichen von Übelkeit zu entdecken. Die Nase erschien ihm noch gewaltiger als zuvor. Die Stirn war breit und von roten Flecken überzogen.
Beri räusperte sich.
»Kann Er warten?« fragte der Fremde.
»Solange der Signore befiehlt«, antwortete Beri.
»Ich werde Ihn mit einer Botschaft beauftragen, in einer halben Stunde«, sagte der Fremde.
»Ich werde zur Stelle sein«, sagte Beri, trug das Gepäck in die Locanda und schlenderte wieder nach draußen, um sich ans Ufer des Tiber zu setzen.
Dort drüben, stromaufwärts, ganz nahe am Porto di Ripetta, hatte sein Vater als Fährmann gearbeitet. Dort hatten sie gewohnt und ein sparsames Leben geführt. Der Vater hatte gut zu tun gehabt, und er, Giovanni, hatte sich auf die Fremden verstanden. Schon als Kind hatte er dem Vater helfen dürfen, sogar des Nachts, wenn die Überfahrt schwierig gewesen war, da die meisten Fahrgäste dann reichlich getrunken und sich manchen Spaß erlaubt hatten. Er, Giovanni, hatte ihre Sprachen gesprochen, etwas Englisch, etwas Französisch und sogar das knarrende Deutsch!
»Ob er ein Deutscher ist?« fragte sich Beri und schaute zur Locanda hinauf, in der der Fremde Quartier bezogen hatte. ›Vielleicht ist er aber auch ein Engländer, ein Herr vom englischen Land, wie die vielen, die oft schon frühabends schläfrig waren vom heimischen Bier und nicht mehr zurückfanden und sich von Vater hin und her fahren ließen, weil sie vergessen hatten, auf welchem Ufer sich ihr Hotel befand …«
Beri lachte kurz auf, dann saß er still. Es war ein herrlicher Abend, mildwarm, in den Weinbergen am anderen Ufer schien die Erde zu summen. Beri schaute hinüber nach Sankt Peter. Nur zu gern hätte er gewusst, was den merkwürdigen Fremden so beschäftigte. »Ich werde es schon erfahren«, flüsterte er vor sich hin und schnitzte mit dem Messer an einem Stück Holz. »Zeit habe ich genug.«