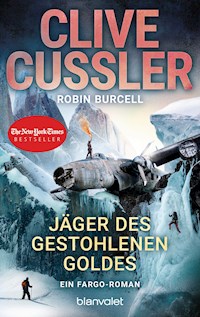
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Fargo-Abenteuer
- Sprache: Deutsch
Sie suchen den größten Schatz des 20. Jahrhunderts – und die Spur führt nach Deutschland!
Im Juli 1918 sollte ein riesiges Lösegeld für die russische Zarenfamilie gezahlt werden. Dieser Schatz erreichte aber nie sein Ziel und ist bis heute verschollen. Doch nun haben die Schatzjäger Sam und Remi Fargo eine Spur. Schnell wird ihnen klar, dass sie nicht die einzigen sind, die diesen Schatz suchen. Skrupellos und mit vernichtender Brutalität steht ihnen ein altes Übel gegenüber, von dem die Menschheit dachte, es sei längst besiegt. Plötzlich geht es um mehr als nur ein unermessliches Vermögen. Es geht um das Schicksal der Welt.
Archäologie, Action und Humor für Indiana-Jones-Fans! Verpassen Sie kein Abenteuer des Schatzjäger-Ehepaars Sam und Remi Fargo. Alle Romane sind einzeln lesbar.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 578
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Autoren
Seit er 1973 seinen ersten Helden Dirk Pitt erfand, ist jeder Roman von Clive Cussler ein New-York-Times-Bestseller. Auch auf der deutschen SPIEGEL-Bestsellerliste ist jeder seiner Romane vertreten. 1979 gründete er die reale NUMA, um das maritime Erbe durch die Entdeckung, Erforschung und Konservierung von Schiffswracks zu bewahren. Er lebt in der Wüste von Arizona und in den Bergen Colorados.
Robin Burcell befand sich beinahe drei Jahrzehnte im Polizeidienst von Kalifornien – zunächst als Police Officer, später im Rang eines Detective. Sie hat mit Geiselnehmern verhandelt und wurde vom FBI in Forensik ausgebildet. Sie lebt heute in Nordkalifornien.
Die Fargo-Romanebei Blanvalet
Das Gold von Sparta
Das Erbe der Azteken
Das Geheimnis von Shangri La
Das fünfte Grab des Königs
Das Vermächtnis der Maya
Der Schwur der Wikinger
Die verlorene Stadt
Der Schatz des Piraten
Jäger des gestohlenen Goldes
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag
Clive Cussler & Robin Burcell
JÄGER DES GESTOHLENEN GOLDES
Ein Fargo-Roman
Deutsch von Michael Kubiak
Die englische Originalausgabe erschien 2017 unter dem Titel »The Romanov Ransom« bei G. P. Putnam’s Sons, New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
1. Auflage
Copyright © 2017 by Sandecker, RLLLP
By arrangement with Peter Lampack Agency, Inc., 551 Fifth Avenue, Suite 1613, New York, NY 10176-0187 USA
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2019 by Blanvalet Verlag, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Jörn Rauser
Umschlaggestaltung: © Johannes Wiebel | punchdesign, unter Verwendung von Motiven von Shutterstock.com (Tropicalvision; Salem Alforaih; Facto Photo; ANURAKE SINGTO-ON; OHamburgefonsz; JohannesS; Joss Chan; Volodymyr Goinyk; D’July; Joseph Sohm) und Phildaint/dreamstime.com
HK · Herstellung: sam
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN: 978-3-641-22678-7V002
www.blanvalet.de
HANDELNDE PERSONEN
KRIM, 1918
Zarenmutter Maria Fjodorowna – Russland.
Pjotr – ein Diener.
BUENOS AIRES, 1947
Klaus Simon – zwölfjähriger Neffe von Ludwig Strassmair.
Dietrich Simon – älterer Bruder von Klaus, im Zweiten Weltkrieg gefallen.
Ludwig Strassmair – während des Zweiten Weltkriegs Kommandant eines Kriegsgefangenenlagers, Onkel von Klaus.
Greta – Begleiterin Strassmairs.
Herr Heinrich – SS-Offizier.
Joe Schmidt – Flugzeugpassagier.
Leonard Lambrecht – Flugzeugpilot.
Eckard Häusler – Kryptograph.
GEGENWART
Fargo-Team
Sam Fargo
Remi (Longstreet) Fargo
Selma Wondrash – Rechercheurin und Organisationsgenie des Fargo-Teams.
Professor Lazlo Kemp – hilft Selma Wondrash bei ihren Recherchen, Engländer.
Pete Jeffcoat – Selmas Assistent, mit Wendy Corden liiert.
Wendy Corden – Selmas Assistentin, mit Pete Jeffcoat liiert.
EHEMALIGE DARPA-MITARBEITER
Ruben »Rube« Hayward – Sachbearbeiter in der Operationsabteilung der CIA.
Nicholas Archer – Inhaber der Sicherheitsfirma Archer Worldwide Security.
FREUNDE DER FARGOS
Albert Hoffler – Selmas Cousin.
Karl Hoffler – Alberts ältester Sohn.
Bernd Hoffler – Alberts jüngster Sohn.
MAROKKO
Rolf Wernher – deutscher Geschäftsmann.
Gerd Stellhorn – Wernhers Chauffeur, Handlanger und Faktotum.
Tatjana Petrow – russische Geschäftsfrau.
Viktor Surkow – Tatjanas Leibwächter.
Zakaria Koury – Bernds und Karls Fremdenführer.
Lina – Zakarias Cousine.
Kadin – Linas Hausdiener.
Durin Kahrs – Bekannter von Bernd und Karl.
KALININGRAD
Sergei Vasyev – Diplom-Archäologe.
Andrei Karpos – Historiker und Kurator des Bernsteinmuseums.
Miron Puschkarjow – Hausmeister im Königsberger Schloss.
Leopold Gaudecker – Chef der Wolfsgarde, Schutztruppe des Unternehmens Werwolf (engl. »Operation Werewolf«).
POLEN
Reinhard Kowalski – Bergmann und Kenner des unterirdischen Stollen- und Tunnelsystems des Projekts Riese.
Gustaw Czarnecki – Bergmann und Experte für den Gold-Zug von Wałbrzych, einen angeblich von den Nazis durchgeführten geheimen Goldtransport.
Tomasz Gorski – Leutnant, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Agentur für Innere Sicherheit).
Nika Karaulina – russische Agentin.
Felix Morjakow – russischer Agent.
DEUTSCHLAND
Helga – Chefin eines Partyservice.
Botschafter Halstern – amerikanischer Botschafter in Deutschland.
Mrs. Halstern – Ehefrau des amerikanischen Botschafters.
Wilhelm Schroeder – Möbelrestaurateur und Rechtsanwalt.
Laurenz Hippler – Verwalter der Burg Anholt.
ARGENTINIEN
Nando Roberto Sandoval – Waldführer.
Dietrich Fischer – Nachkomme von Ludwig Strassmair und dessen Neffe Klaus.
Julio – Hubschrauberpilot.
PROLOG
I
HALBINSEL KRIMJULI 1918
Während zwei Männer den letzten von drei großen Holzschrankkoffern auf die Ladefläche eines Heuwagens wuchteten, hatte die alte Frau Tränen in den Augen. Der erste Koffer war bis zum Rand mit Perlenketten, Diamanten und Edelsteinen gefüllt. Goldbarren und Goldmünzen befanden sich im zweiten Koffer. Der dritte enthielt den Schmuck, mit dem die kaiserliche Familie im Laufe der vergangenen dreihundert Jahre beschenkt worden war, darunter waren mit Brillanten besetzte Diademe, Halsketten und Ringe. All das ignorierte sie jedoch, ihre Aufmerksamkeit galt ausschließlich dem viel kleineren Schmuckkasten, den ihre Zofe zum Wagen brachte.
»Warte!«, befahl sie.
Die Zofe wandte sich zu ihr um. »Ist etwas nicht in Ordnung?«
Wie konnte sie ihre Gefühle in einem Augenblick wie diesem nur zum Ausdruck bringen? Die Juwelen und das Gold bedeuteten ihr gar nichts. Aber dieser letzte Kasten … Sie verfolgte, wie der Mann, Pjotr, ihn der Zofe abnahm. »Nur einen einzigen Blick noch.«
Pjotr deutete auf den anderen Mann, der ihr vollkommen fremd war und gerade auf den Kutschbock des Wagens kletterte. Dann ergriff er die Zügel der beiden Pferde, die schmatzend auf den Gebissen ihres Zaumzeugs kauten. »Wir sind schon spät dran.«
Sie wandte sich zu Pjotr um. »Bitte …«
»Beeilen Sie sich.« Er stellte den kleinen Kasten auf die Ladepritsche des Wagens und trat zurück, um der Frau Platz zu machen.
Zarenmutter Maria Fjodorowna öffnete den Schnappverschluss, klappte den Deckel auf und nahm die Schicht Schafwollfilz heraus. Darunter kamen vier mit Diamanten besetzte Eier zum Vorschein, die sie – nachdem die Bolschewiken in Russland die Macht an sich gerissen hatten – heimlich in ihr Versteck hatte mitnehmen können. Es verschlug ihr den Atem, als sie das Königlich Dänische Ei herausnahm und wie in einem Nest in den Händen hielt. Es hatte weder mit der Schönheit des Mondlichts zu tun, das von den in Gold gefassten Edelsteinen reflektiert wurde, die die weiß-blaue Emaillehülle schmückten, noch mit der peinlich genauen Kunstfertigkeit des Goldschmieds, Peter Carl Fabergé, der sie geschaffen hatte, und doch war jedes Ei ein Meisterwerk an Schönheit und ein Quell des Entzückens für all jene, die es aus der Nähe betrachten durften.
»Genug«, sagte der Kutscher streng.
»Gib ihr noch einen Augenblick«, bat die Zofe den Mann.
»Es sind doch nur ein paar Edelsteine.«
»Für Sie vielleicht«, sagte Maria und ließ jede Facette auf sich wirken. »Für mich bergen sie unendlich teure Erinnerungen …«
Vor allem dieses Ei enthielt als Überraschung winzige Porträts ihrer Eltern. Ihr verstorbener Mann hatte es ihr zum Geschenk gemacht – und all diese Stücke erzählten Geschichten von glücklicheren Zeiten mit ihm, mit ihren Kindern und später auch mit ihren Enkelkindern, die noch so jung waren.
»Sie werden Ihre Familie wiedersehen«, prophezeite die Zofe. »Ich weiß es ganz sicher.«
Die alte Frau nickte, schluckte den Kloß in ihrem Hals hinunter und legte das Ei zurück in sein Schafwollnest zu den drei anderen Schmuckeiern. »Ich kann mich bei Ihnen nur bedanken …«
Pjotr, der im Begriff war, den Deckel zuzuklappen, hielt plötzlich inne und sah sie an. »Weiß von diesen Leuten jemand, wie viele Eier in diesem Kasten sind?«
Maria Fjodorowna schüttelte den Kopf. »Nein. Nur dass ich sie mitnehmen wollte.«
Er betrachtete den kleinen Kasten, dann nahm er das Ei heraus, das sie gerade betrachtet hatte, schüttelte die Wollfilzflocken auf und verschob die anderen Eier mit ihren Wollnestern, sodass es aussah, als hätte der Inhalt des Kastens von Anfang an nur aus drei Schmuckeiern bestanden.
Sie nahm das Ei, das er ihr reichte, und hatte Mühe, die Tränen zurückzuhalten. »Ich kann das … nicht wiedergutmachen. Vielen Dank.«
»Verraten Sie es nicht. Niemand darf es jemals erfahren.«
»Das werde ich nicht tun«, antwortete sie, während er die Fracht mit dem Heu auf dem Wagen zudeckte und dann nach vorn ging, um auf den Kutschbock zu klettern. »Ich verspreche es.«
Er nickte, während der Kutscher an den Zügeln ruckte und die Pferde mit einem Schatz von nahezu unermesslichem Wert im Wagen lostrabten. Dem Wagen nachblickend, bis er nicht mehr zu sehen war, drückte Maria Fjodorowna das Ei an ihre Brust, während ihr Herz zwischen Resten von Hoffnung und entsetzlicher Angst verzweifelte.
* * *
»Das hättest du nicht tun sollen«, sagte der Kutscher zu Pjotr, während der Wagen mit quietschenden Rädern über die festgestampfte Lehmstraße schaukelte.
»Warum nicht?«
»Weil es dem Volk gehört.«
»Das Volk wird aber nicht das Geringste vermissen. Nicht bei der Menge, die sie uns übergeben hat.«
»Das zu entscheiden steht dir nicht zu.«
Pjotr bemerkte den unversöhnlichen Ausdruck in der Miene des Mannes. Er versuchte nicht einmal so zu tun, als wüsste er, um was genau es bei der Revolution ging, außer dass die Bolschewiken glaubten, der Kaiser und seine Familie hätten in Luxus und Überfluss gelebt, während die Massen hungerten und einer unsicheren Zukunft entgegensahen. Der Volkszorn war nicht zu besänftigen und dauerte unvermindert an, sogar nachdem Nikolaus II. auf den Thron verzichtet hatte und die kaiserliche Familie gefangen genommen worden war.
Einiges davon verstand er, vieles jedoch nicht. »Welchen Unterschied macht es, wenn wir ihr in dieser Zeit der Angst und Ungewissheit gestatten, an ihren glücklichen Erinnerungen festzuhalten?«
»Welchen Unterschied es macht? Du klingst, als stündest du auf ihrer Seite.«
»Sie ist doch nur eine alte Frau.«
»Du wärst gut beraten, wenn du derartige Gedanken lieber für dich behieltest, damit du nicht genauso endest wie ihre Familie.«
Nachdem er mehrere Jahre lang für die Romanows gearbeitet hatte, war das Letzte, was Pjotr sich wünschte oder brauchen konnte, dass ihn irgendjemand für einen Sympathisanten hielt. In diesen Zeiten konnten solche Vermutungen leicht zum Tode führen. »Ich habe … einfach nicht nachgedacht. Selbstverständlich hast du recht.«
Der Mann murmelte halblaut etwas, das nicht zu verstehen war, dann trieb er die Pferde zu einer schnelleren Gangart an. Während der nächsten Tage hütete sich Pjotr, die Romanows noch einmal zu erwähnen, und hoffte, dass die Episode mit der Zarenmutter schnell vergessen war. Als sie schließlich in Jekaterinburg eintrafen, brach bereits die Nacht herein. Anstatt aber direkt zum Haus des Gouverneurs zu fahren, wo die Romanows gefangen gehalten wurden, bogen sie an einer Seitenstraße nach links ab.
»Wohin fahren wir?«, wollte Pjotr wissen.
»Wir treffen jemanden, um das alles abzuladen.« Der Kutscher deutete mit dem Daumen hinter sich.
In Pjotr kam Panik auf. »Wenn wir die Ladung nicht rechtzeitig abliefern, werden sie die kaiserliche Familie töten!«
»Was kümmert es dich? Deren Schicksal ist nicht deine Angelegenheit.«
»Aber die Ranzion … das Lösegeld … die Zarenmutter hat es uns doch anvertraut. Damit sie die Überfahrt ihrer Familie bezahlen kann.«
»Lösegeld?«, wiederholte der Kutscher lachend. »Du glaubst doch nicht im Ernst, dass sie jemals die Absicht hatten, die Bande laufen zu lassen, oder?«
»Wir haben es aber versprochen.«
»Du Narr. Was meinst du denn, was geschehen würde? Dass die Bolschewiken den Inhalt des Wagens als Bezahlung annehmen und sie dann freilassen? Schon bald blüht Maria Fjodorowna« – er wandte sich ab und spuckte aus, um seine Abscheu bei der Nennung des Namens der Zarenmutter auszudrücken – »das gleiche Schicksal wie ihrem Sohn und seiner ganzen verkommenen Brut.«
Erst in diesem Augenblick wurde Pjotr klar, dass sie zu spät kämen. Die gesamte Romanow-Familie war längst getötet worden. Die Gesichter der Kinder erschienen vor seinem geistigen Auge – als er sie das letzte Mal gesehen hatte, kurz vor Ausbruch der Straßenkämpfe, da waren sie so glücklich gewesen …
»Wohin fahren wir denn?«
»An einen Ort, wo wir dies als Beweis abliefern.« Er nickte in Richtung der Wagenladung hinter ihnen. »Wenn sie sehen, was die alte Frau Russland gestohlen hat, um damit die Freiheit ihres Sohnes zu erkaufen, werden sie und jeder Romanow gejagt, ebenso wie jeder, der sie in irgendeiner Weise unterstützt.«
Doch verglichen mit den Leben aller Mitglieder der kaiserlichen Familie hatte vor allem das Maria Fjodorownas einen gewissen Wert besessen. Im Gegensatz zu ihrem Sohn und dessen Ehefrau hatte sie Russland stets vorbildlich gedient. Dieser Krieg war durch ihren Sohn ausgelöst worden. Denn er hatte als Lenker seines Staates versagt.
Aber wenn sie, wie der Kutscher angedeutet hatte, jeden verfolgen würden, der die kaiserliche Familie in irgendeiner Form unterstützt hatte, dann stünde Pjotr auf dieser Liste ganz weit oben, vor allem wenn sie erführen, dass er Maria eines der wertvollen Eier überlassen hatte. Dieser Gedanke machte ihm Angst, zumal er in diesem Augenblick begriff, zu welchem Ziel sie gerade unterwegs waren. Ausgerechnet zu der Scheune, in der einige Royalisten erschossen worden waren. »Wirst du ihnen erzählen, was ich getan habe?«
»Natürlich. Über dein weiteres Schicksal wird das Volk entscheiden.«
Sie würden ihn töten.
Pjotrs Hände zitterten, und er schob sie unter seine Oberschenkel, wagte einen verstohlenen Blick auf den Mann neben sich und registrierte die Pistole in der Tasche an seinem Gürtel.
Die Wagenräder sackten in eine Fahrtrille, ließen das Fahrzeug heftig schwanken und warfen ihn gegen den Kutscher. Er schnappte sich die Pistole, rutschte von seinem Begleiter weg und richtete die Waffe auf ihn.
Der Kutscher drehte sich halb um und versuchte, die Waffe wieder an sich zu bringen. »Was zum Teufel …«
Pjotr drückte ab.
Der Schuss traf den Mann mitten in die Brust. Er kippte zur Seite und ließ dabei die Zügel los. Pjotr schob ihn von der Sitzbank, und er stürzte auf die Lehmpiste hinunter. Pjotr ergriff die Zügel und brachte das Gespann zum Stehen. Dann wendete er den Wagen und hielt für einen Moment neben dem gefallenen Mann an.
Dieser blickte zu Pjotr empor, während sein Gesicht grau wurde. »Warum?«
»Um mein Leben zu retten. Und das Leben Maria Fjodorownas.«
»Sie werden dich neben ihr begraben. Sobald sie den Schatz bei dir oder bei irgendjemand anderem finden.«
»Das werden sie niemals.« Er zog die Zügel an, dann schlug er den Weg zum Schloss ein. Er kannte ein geheimes Paneel in der Wandtäfelung des Bernsteinzimmers. Die Bolschewiken müssten das gesamte Gebäude auseinandernehmen, um es zu finden. Irgendwie würde er der Zarenmutter eine Warnung zukommen lassen, dass sie schnellstens verschwinden müsse, weil man die Absicht hätte, sie zu töten.
Und vielleicht könnten sie eines Tages zurückkehren, um den Schatz zu holen.
II
BUENOS AIRESDEZEMBER 1947
»Es muss doch irgendetwas geben, das man tun kann. Schließlich ist es ja nicht viel, worum wir bitten. Ich zahle alles zurück. Jeden Cent.«
Die Verzweiflung, die er in der Stimme seines Vaters hörte, schnitt dem zwölfjährigen Klaus Simon tief ins Herz, und so schlich er sich näher an die Küchentür heran, um von der Unterhaltung im Empfangszimmer mehr verstehen zu können.
»Bitte, Ludwig«, sprach sein Vater weiter. »Wenn du irgendeine Möglichkeit fändest, uns noch dieses eine Mal zu helfen.«
»Da gibt es tatsächlich etwas …« Mehrere Sekunden lang hörte Klaus in der einsetzenden Stille als einzigen Laut das Ticken der Küchenuhr an der Wand hinter ihm. Schließlich konnte er wieder die Stimme seines Onkels hören. »Während meines kurzen Abstechers nach Santiago brauche ich Hilfe. Wenn du mit meinen Bedingungen einverstanden bist, werde ich dich angemessen dafür belohnen.«
»Ich tue alles. Alles, was du willst.«
»Nicht du. Dein Junge.«
Überrascht drückte Klaus ein Ohr gegen die Tür. »Ich verstehe nicht ganz«, sagte sein Vater. »Was müsste Klaus denn tun?«
»Nicht viel. Im Grunde wäre er nur ein Begleiter, gar nicht mehr. Diese Ausflüge können gelegentlich äußerst mühsam sein. Und da ist alles willkommen, was die Strapazen ein wenig erleichtert.«
»Wie lange wäre er von zu Hause weg?«
»Ein paar Tage höchstens. Was aber wichtiger ist, wir sind bereit, gut zu zahlen.«
Für längere Zeit herrschte Schweigen, dann antwortete sein Vater. »Ich weiß nicht. Vielleicht finden wir einen anderen Weg, um …«
Klaus stieß die Tür auf und platzte in den Raum. »Ich kann es tun. Kein Problem. Ich schaffe das.«
Sein Vater musterte ihn stirnrunzelnd. »Ich habe dir befohlen, in der Küche zu warten.«
»Es tut mir leid«, sagte Klaus und wagte einen verstohlenen Blick zu seinem Onkel. Seine Erinnerungen an den Mann, den er aus der Zeit kannte, als sie in Deutschland bei ihm gewohnt hatten, waren sehr vage. Er konnte sich nur entsinnen, dass sein Onkel Ludwig Strassmair mit Klaus’ Mutter eine hitzige Diskussion geführt hatte, als er ihr die Nachricht überbrachte, dass Klaus’ älterer Bruder, Dietrich, im Krieg gefallen war. Dietrich hatte offenbar nicht, wie jedermann annahm, für Deutschland gekämpft, sondern war im Widerstand gegen die Nazis tätig gewesen. Seine Mutter hatte sich nie von Dietrichs Tod – oder von dem Skandal – erholt, und nachdem sie ihr gesamtes Hab und Gut verkauft hatten, um die Passage nach Argentinien bezahlen zu können, hatte sie jeden Kontakt zu ihrem Bruder abgebrochen. »Lass mich mitfahren. Bitte, Vater.«
Ludwig Strassmair sah lächelnd zu Klaus hinüber. »Siehst du? Sogar der Junge ist bereit, mich zu begleiten.«
Sein Vater war jedoch nicht gewillt, so schnell zuzustimmen. »Ich möchte die Angelegenheit erst einmal mit ihm durchsprechen. Ich rufe dich an, wenn ich mich entschieden habe.«
»Danke.«
Sein Vater wartete, bis Onkel Ludwig das Haus verlassen hatte und weggefahren war, dann blickte er besorgt durch den Korridor zum Schlafzimmer, in dem seine Frau lag und schlief. Mit einem erschöpften Seufzer sah er Klaus an. »Du hast gehört, was er gesagt hat. Es wäre nur für ein paar Tage. Nach Chile und zurück.«
»Ich hab’s gehört.« Klaus beobachtete seinen Vater und versuchte zu ergründen, was er ihm nicht mitteilen wollte. »Er wünscht sich nur ein wenig Gesellschaft. Das klingt doch nicht zu schwierig.«
»Da ist etwas, was du wissen solltest …«
»Was, Papa?«, fragte er, als sein Vater nicht fortfahren wollte.
Noch einmal ein Seufzer. Dieser war noch bedrückter als der vorangegangene. »Dein Onkel … ist ein Nazi. Und all seine Freunde sind es ebenfalls.«
Jegliche Hoffnung auf die Reise verflüchtigte sich angesichts der Erkenntnis, dass seine Mutter ihm niemals die Erlaubnis geben würde, seinen Onkel zu begleiten. Es war bedeutungslos, dass sich Dietrich seinerzeit aus freien Stücken entschieden hatte, für den Widerstand zu kämpfen, sie machte allein die Nazis für seinen Tod verantwortlich.
Sein Vater blickte noch einmal in den Flur, dann kehrte sein Blick zu Klaus zurück. »Dennoch … der Krieg ist vorbei. Man braucht es ihr nicht zu sagen. Oder deiner Schwester, die alles ausplaudert.«
»Aber …«
»Es würde deiner armen Mutter das Herz brechen.« Er legte beide Hände auf Klaus’ Schultern, blickte ihm in die Augen, während sich sein Gesicht zur Andeutung eines Lächelns verzog. »Gäbe es irgendeine andere Möglichkeit, würden wir sie sicherlich finden. Nicht wahr? Aber es gibt keine … verstehst du?«
Klaus verstand alles nur zu gut. Er und sein Vater könnten darüber hinwegsehen, aus welcher Quelle die Mittel kamen, die sie brauchten, um die Medizin zu bezahlen, die seine Mutter dringend brauchte. Was machte es schon aus, wenn noch ein paar Nazis mehr ins Land geschmuggelt wurden? Zumal – wie sein Vater sagte – der Krieg doch vorbei war. Diese Männer waren Deutsche wie er.
Außerdem wäre es ja nur für ein paar Tage.
Aber irgendwie musste das Gespräch bis zum Krankenbett seiner Mutter gedrungen sein, denn als er sie besuchte, versuchte sie, ihn von seinem Entschluss abzubringen. »Ich werde sowieso sterben«, sagte sie. »Und welchen Nutzen wird das Geld dann haben?«
»Das werde ich nicht zulassen«, versprach Klaus und versuchte zu verdrängen, wie schwach sie mittlerweile geworden war. Mittlerweile verließ sie kaum noch ihr Bett.
»Dietrich hatte keine andere Wahl, als gegen Hitler zu kämpfen. Wir haben Deutschland nicht rechtzeitig genug verlassen. Aber ich habe dir beigebracht, immer zu tun, was richtig ist. In diesem Punkt hast du eine Wahl.«
»Und diese Wahl ist richtig. Für dich.«
Darauf sagte sie nichts, sondern schloss stumm die Augen und dämmerte in den Schlaf hinüber.
Als er an diesem Abend zu ihr kam, um ihr gute Nacht zu sagen, glaubte er, dass sie schon schlief. Aber als er sich zur Tür wandte, um hinauszugehen, schlug sie die Augen auf. »Klaus …«
Er kam zurück ins Zimmer und setzte sich zu ihr auf die Bettkante.
Sie streckte einen Arm aus, fasste nach seiner Hand, ihr Griff kraftlos, schwach, ihre Haut kühl. »Versprich mir nur eins …«
»Was soll ich dir versprechen?«, fragte er und musste sich tief zu ihr hinabbeugen, um sie zu verstehen.
»Folge dem Ruf deines Herzens …« Sie hob einen Arm und berührte seine Brust, dann ließ sie die Hand sinken und schloss die Augen. »Dietrich …« Vielleicht hatte sie Halluzinationen und sah statt ihm selbst seinen toten Bruder. Da er glaubte, dass sie wieder eingeschlafen war, wollte er aufstehen. Doch sie öffnete noch einmal die Augen, und ihr sanftes Lächeln drang tief in sein Herz. »Tu das, Klaus … du wirst reich belohnt werden … versprichst du es mir?«
»Ich verspreche es«, sagte er und fragte sich unwillkürlich, ob sie überhaupt noch länger als zwei Tage am Leben bliebe. Was wäre, wenn sie starb, ehe er von der Reise zurückkehrte?
Nein. Er weigerte sich, so etwas zu denken. Er musste tun, wozu er sich entschlossen hatte. Wenn er die Medizin nicht beschaffte, würde sie sterben.
Mit schwerem Herzen lehnte er sich zu ihr hinab, küsste sie auf die Stirn und sah, dass sie wieder eingeschlafen war. »Ich liebe dich«, flüsterte er, dann verließ er sie und begab sich mit seinem Onkel Ludwig Strassmair auf die Reise nach Buenos Aires.
* * *
»Herr Strassmair. Wie schön. Sie haben hergefunden. Nur herein. Kommen Sie.«
Klaus, der den Koffer seines Onkels in der Hand hatte, wollte ihm gerade ins Büro folgen, als er glaubte, hinter sich ein Geräusch zu hören. Er blieb stehen und blickte in den dunklen Flur. Offenbar ein Luftzug, entschied er, dann folgte er seinem Onkel in das Büro, wo Herr Heinrich, ein grauhaariger Mann in einem in militärischem Stil geschnittenen Jackett hinter einem ramponierten Holzschreibtisch saß. Eine Hand hatte er auf einen braunen Aktenordner gelegt. Eine Frau mit blonden Haaren und etwa im gleichen Alter wie Klaus’ Onkel, Mitte vierzig, stand hinter ihm. Sie musterte Klaus neugierig. »Ist das der junge Mann?«
»Klaus«, sagte Ludwig Strassmair. »Der Sohn meiner Schwester. Von gutem deutschem Schlag und reinem Blut.« Er nahm Klaus den Koffer ab, dann schob er den Jungen zur Tür. »Warte draußen. Wir brauchen nur ein paar Minuten.«
Klaus ging auf den Flur hinaus und erinnerte sich an die Warnung seines Vaters, sich um seine eigenen Angelegenheiten zu kümmern. Aber Ludwig hatte die Tür offen gelassen, und er konnte nicht umhin, mit anzuhören, was im Büro gesprochen wurde.
»Ist Ihnen jemand gefolgt?«, fragte Herr Heinrich.
»Nein«, erwiderte Strassmair. »Ich bin sehr vorsichtig und wachsam gewesen.«
Klaus schaute in den dunklen Flur und war plötzlich wegen des Geräusches beunruhigt, das er während ihres Eintretens gehört zu haben glaubte. Was wäre, wenn sie tatsächlich verfolgt wurden? Er bewegte sich ein Stück weiter zur offenen Tür und überlegte, ob er irgendetwas sagen sollte.
»Na, was ist?«, sagte Ludwig Strassmair. »Machen wir Fortschritte?«
»Das machen wir. Aber zuerst möchte ich mir ansehen, was Sie mitgebracht haben, ehe alles verkauft wird. Öffnen Sie den Koffer.«
Einen Moment später hörte Klaus, wie Herr Heinrich einen leisen Pfiff ausstieß, während die Frau beinahe andächtig sagte: »Fantastisch! Wie prachtvoll sie sind, weiß ich nur aus Erzählungen.«
Unfähig, der Verlockung zu widerstehen, lugte Klaus durch den Türspalt. Herr Heinrich hielt ein mit Edelsteinen besetztes eiförmiges Objekt in der Hand. Das grünliche Glitzern erinnerte Klaus an einen kleinen Jadeanhänger an der Halskette, die seine Mutter früher häufig getragen hatte. Fein ziselierte goldene Ranken schmiegten sich um das Ei, und Diamanten funkelten wie helle Blumenblüten an den Ranken. »Welches haben Sie mitgebracht?«, fragte Heinrich und drehte das edle Stück hin und her, wobei das Licht von den Diamanten vielfach reflektiert wurde.
»Dies«, sagte sein Onkel, »ist das Nephrit-Ei oder auch das Alexander-III.-Medaillon-Ei.«
»Wie viele Eier haben Sie?«
»Nur drei. Außerdem aber mehrere andere Kästen und Koffer, die Maria Fjodorowna aus Russland herausschmuggeln konnte, als sie auf die Krim floh. Einer dieser Schrankkoffer enthält die Kronjuwelen der Zarenmutter, die anderen sind mit einigen hundert losen Diamanten, wertvollen Edelsteinen und Gold gefüllt. Natürlich hat sie für die Freilassung ihres Sohnes und ihrer Familie einen stolzen Preis bezahlt.«
»Und trotzdem haben die Bolschewiken sie getötet, wie sie es von Anfang an geplant hatten«, sagte Herr Heinrich. »Da ist es eine ganz interessante Ironie, dass wir den Schatz der Romanows, der ihnen das Leben retten sollte, benutzen, um gegen Russland zu kämpfen.« Er drehte das Ei zwischen den Fingern hin und her und betrachtete versonnen das Glitzern der Deckenbeleuchtung, die sich in den Facetten der Diamanten brach. »Sehr schade, dass Ihre Leute nicht auch noch das Bernsteinzimmer in ihren Besitz bringen konnten. Dessen Anblick werde ich niemals vergessen.«
»Es wäre einigermaßen schwierig, überzeugend als politischer Flüchtling oder Asylsuchender aufzutreten, während man gleichzeitig versucht, ein Objekt von dieser Größe über die Grenze zu schmuggeln. Es war schon schwierig genug, diese Eier aus Deutschland herauszubringen, ohne aufzufallen und eine Spur zu hinterlassen.«
»Und der Pilot? Wie ich hörte, arbeitete er mit den Alliierten zusammen.«
»Leutnant Lambrecht?«
»Ja. Was ist, wenn er redet? Er könnte sie direkt zu uns führen.«
»Zu seinem Unglück ist er tot. Meine Männer haben sein Flugzeug sabotiert. Das Letzte, was man von ihm hörte, war, dass er irgendwo in Marokko abgestürzt sein soll.«
»Und was ist, wenn jemand das Flugzeug findet? Unsere Pläne …«
»… sind chiffriert. Und sollte es dazu kommen, dass jemand sie findet – vorausgesetzt, dass ein solcher Fall überhaupt jemals eintritt –, sind wir in Santiago und bringen alles in Gang. Dann wird es zu spät sein.«
Klaus hatte weder eine Ahnung, wovon sie redeten, noch wollte er das Geringste darüber wissen. Als er Anstalten machte, sich von der Tür zurückzuziehen, schaute der Mann, den er nur als »Herr Heinrich« kannte, hoch und entdeckte ihn auf seinem Horchposten hinter dem Türspalt. »Was soll das? Du da! Komm her!«
Er erstarrte.
Ludwig Strassmair fuhr herum, sah ihn, dann nickte er ihm zu. »Klaus!«
Klaus gehorchte und trat ein, wobei er sich fragte, was sein Onkel tun würde – aber da fiel sein Blick auf das Ei, das, aus der Nähe betrachtet, noch viel schöner aussah. »Ich wollte nicht spionieren, ich …«
Die Frau lachte. »Möchtest du es einmal in die Hand nehmen?«
Klaus schüttelte den Kopf, weil er Angst hatte, es fallen zu lassen.
Herr Heinrich reichte das Ei an Ludwig Strassmair weiter, der es behutsam in ein quadratisches graues Wolltuch einwickelte.
»Wunderschön, nicht wahr?«, sagte die Frau.
Klaus nickte und konnte den Blick nicht abwenden, während Onkel Ludwig das Ei wieder in seinen Kasten zurücklegte. Darin gewahrte er zwei weitere eiförmige Objekte, die ebenfalls in Wolltücher eingewickelt waren.
»Fabergé«, sagte die Frau, doch der Name hatte keine Bedeutung für Klaus. »Weißt du, für wen sie bestimmt sind? Oder für was? Oder weshalb ihr sie nach Chile bringen werdet?«
Er schüttelte den Kopf. Er wusste nur, dass er sich warm anziehen sollte, weil sie über die Anden fliegen würden. Und dass die Geldsumme, die man ihm dafür zahlte, seine Mutter am Leben erhalten würde. »Nein, Fräulein.«
»Um das Vierte Reich …«
»Greta!« Herr Heinrich erhob sich aus einem Schreibtischsessel.
Sichtlich ungehalten über die Störungen oder vielleicht auch über Gretas Enthüllung, klappte Ludwig Strassmair den Kasten zu. »Wir sollten jetzt gehen. Es ist schon spät, und unsere Maschine wartet. Haben Sie die Papiere?«
»Natürlich«, sagte Herr Heinrich und zog sie aus dem Ordner. Strassmair überflog die Blätter, als Heinrichs Telefon klingelte. Er meldete sich, lauschte und sagte dann: »Ja, er ist gerade hier.« Heinrich reichte Onkel Ludwig den Telefonhörer über den Schreibtisch. »Für Sie.«
Ludwig legte die Papiere auf den Koffer. Während er nach dem Telefonhörer griff und ihn ans Ohr hielt, wischte er mit seinem Mantel das oberste Dokument herunter, das auf den Boden flatterte.
Es landete vor Klaus’ Füßen – und er bückte sich, um es aufzuheben. Dabei las er die deutschen Worte Unternehmen Werwolf am oberen Rand. Ehe er die ersten Zeilen überfliegen konnte, um zu erfahren, was sich hinter dem Begriff »Operation Werewolf«, wie die englische Übersetzung der deutschen Begriffe lautete, verbarg, nahm ihm Greta das Dokument aus der Hand und legte es mit dem Gesicht nach unten auf den Stapel zurück.
»Einen Moment«, sagte Ludwig Strassmair ins Telefon. Er deckte die Sprechmuschel mit der Hand zu. »Greta, wir treffen uns am Wagen. Nimm den Jungen mit und schließ die Tür hinter dir.«
Die Frau legte eine Hand auf Klaus’ Schulter und steuerte ihn auf den Flur hinaus. »Komm mit mir, Klaus.«
Dann folgte er Greta nach draußen, wo Ludwig Strassmairs schnittige Mercedes-Limousine bereitstand, deren schwarzer Hochglanzlack das helle Mondlicht reflektierte. Während Greta ihn zum Wagen geleitete, drehte Klaus Simon sich um und blickte zum Büro. Dabei dachte er an die Papiere, die dieser Herr Heinrich seinem Onkel übergeben hatte. Sein Vater mochte bereit sein, über Onkel Ludwigs Vergangenheit hinwegzuschauen, aber Klaus würde niemals untätig zusehen, wenn sich die Nazipartei erneut formierte, um das Vierte Reich auszurufen. Er wusste, dass seine Mutter entsetzt wäre.
Sie würde sich von ihm wünschen, er möge seinem Onkel erklären, dass er ihn unmöglich begleiten könne. Vor allem angesichts dessen, was er in diesem Dokument hatte lesen können.
»… machen Sie die Amerikaner für einen Bombenangriff auf Russland verantwortlich …«
Sein Vater würde sicherlich verstehen, weshalb er nicht mitfliegen konnte.
Jemand stieß einen lauten Ruf aus, als die Bürotür aufflog. Ludwig Strassmair kam herausgerannt, den Koffer in der einen Hand, eine Pistole in der anderen. »Steig in den Wagen!«
Ein Schuss erklang, und Ludwig wandte sich halb um, während er rannte, und feuerte auf die Haustür.
Crack! Crack!
Klaus erstarrte. Ludwig Strassmair rannte zur Fahrerseite, feuerte zwei weitere Schüsse ab, dann warf er den Koffer in den Wagen. »Beeil dich!«
Greta schubste Klaus zum Wagen. »Steig ein!«
Er warf sich auf die Rückbank des Mercedes. Greta ließ sich in den Beifahrersitz fallen, während Onkel Ludwig den Wagen startete und einen Fluch ausstieß, als der Motor erst einige Sekunden lang stotterte, dann jedoch ansprang.
Der Wagen startete mit quietschenden Reifen durch und beschrieb eine scharfe Kurve, sodass Klaus gegen die Tür geschleudert wurde.
Mit wild klopfendem Herzen wagte er schließlich einen Blick nach draußen und sah hinter ihnen nichts als eine dichte Staubwolke. »Was ist passiert?«, fragte er. »Warum schießen sie auf dich?«
Mehrere Sekunden verstrichen, ehe sein Onkel antwortete. »Räuber. Sie sind hinter dem Schatz her. Sie sind von hinten ins Haus gekommmen, während ich mich gerade verabschiedet habe.«
Greta sah ihn fragend an. »Herr Heinrich?«
»Tot. Sie haben ihn ermordet.«
»Was ist mit den Papieren?«, fragte sie.
»Im Koffer.«
»Gut«, sagte sie. »Wenn sie die gefunden hätten …«
»Das reicht!« Onkel Ludwig fixierte Klaus im Rückspiegel, dann konzentrierte er sich wieder auf die Straße.
»Bring mich nach Hause«, verlangte Klaus mit überkippender Stimme. »Ich will das nicht tun.«
»Nein«, schnappte Onkel Ludwig und steigerte das Tempo. »Zu spät.«
»Ich … ich versteh das nicht. Warum und für was brauchst du mich?«
Greta beantwortete die Frage. »Weil sich niemand für einen Mann und eine Frau mit ihrem Sohn interessiert.«
Er konnte sich nur einen einzigen Fall denken, in dem diese Erklärung einen Sinn ergab. Sie mussten wissen, dass sie beobachtet wurden, und benutzten ihn als Staffage, um einen harmlosen Eindruck zu erwecken.
Klaus fragte sich, was Dietrich getan hätte, hätte er sich in dieser Situation befunden. Hatte er deshalb sterben müssen? Ganz sicher ging das Ganze Klaus nicht das Geringste an. Außerdem war er erst zwölf Jahre alt.
Folge dem Ruf deines Herzens …
Tief in seinem Innern wusste er, dass seine Mutter eher den Tod gewählt hätte, als zuzulassen, dass die Nazis wieder an die Macht kämen. Und wenn seine Anwesenheit es seinem Onkel erleichterte, dieses Ziel zu erreichen?
Er kannte die Antwort.
Während er den Blick starr auf den Nacken seines Onkels gerichtet hielt, schob er die Hand langsam in Richtung Tür. Sobald der Wagen wegen einer Straßenbiegung die rasende Fahrt verlangsamte, stieß er die Tür auf, sprang hinaus, stürzte und rollte über die Fahrbahn. Er verbiss sich einen Schmerzlaut, kämpfte sich auf die Füße und rannte los. Reifen quietschten, als sein Onkel auf die Bremse trat und den Wagen abrupt zum Stehen brachte.
»Klaus!«
Er drehte sich nicht um, sondern rannte weiter, so schnell er konnte. Vor dem Gebäude an der Ecke brannte eine Straßenlaterne, auf die er zusteuerte. Er sah eine offene Tür. Musik drang heraus – die Melodie klang wie ein italienisches Volkslied – zusammen mit lautem Stimmengewirr und Gelächter. »Hilfe!«, schrie er. »Bitte! Helft mir!«
Er erreichte die Tür, während sein Onkel im selben Augenblick nach seiner Schulter fasste. »Klaus!«
»Helft mir!«, rief der Junge und versuchte, sich loszureißen.
Ein Mann öffnete die Tür. Er hatte eine Weinflasche in der Hand und schaute zu ihnen heraus.
»Mio figlio«, sagte sein Onkel.
Der Mann nickte.
»Nein!«, rief Klaus, als sein Onkel ihn hinter sich herzerrte. »Nicht mio figlio! Ich bin nicht sein Sohn! Ganz bestimmt nicht!«
»Sei still!« Ludwig Strassmair schlug ihm mit dem Handrücken ins Gesicht. »Tu das noch ein Mal, und ich töte dich! Hast du verstanden?«
Schmerzen mischten sich mit einer namenlosen Angst, als er die Wut in den Augen seines Onkels lodern sah. Klaus blickte zur Bar. Der Mann, der herausgekommen war, setzte die Weinflasche an die Lippen und trank einen tiefen Schluck, dann entfernte er sich und tauchte in den nächtlichen Schatten unter. Die Straße war wieder leer und dunkel, und Klaus war vollkommen allein. Er sah seinen Onkel an und nickte stumm.
»Gut«, sagte Ludwig Strassmair und grub seine Finger in Klaus’ Arm, während er ihn festhielt. »Und jetzt geh langsam und ruhig zum Wagen zurück. Sag kein Wort.«
Klaus Simon, dessen Herz raste, nickte ein weiteres Mal. Irgendwie würde er einen Ausweg aus diesem Dilemma finden. Für Dietrich. Für seine Mutter.
»Steig ein«, befahl sein Onkel, als sie den Wagen erreichten.
Die Frau hatte den Beifahrersitz nicht verlassen und wandte sich zu ihm um, während er auf die Rückbank kletterte. »Du solltest nicht weglaufen, Klaus. Es ist doch nur für ein paar Tage. Und dann darfst du nicht vergessen, dass wir wissen, wo du wohnst.«
Als sie auf dem Flugplatz eintrafen, stand die Maschine, eine viermotorige Avro Lancastrian, mit der sie fliegen sollten, schon bereit. Mit wachsender Unruhe verfolgte Klaus, wie sie die Kästen aus dem Kofferraum des Mercedes ins Frachtabteil des Flugzeugs umluden und einstiegen. Dabei legte Ludwig Strassmair den Koffer keine Sekunde lang aus der Hand. Während des Krieges war das Flugzeug als Bomber eingesetzt worden. Später wurde es nach Argentinien verkauft und dort für den zivilen Reiseverkehr umgerüstet. Obgleich die Maschine über neun hintereinander angeordnete Sitzplätze verfügte, befanden sich nur fünf Passagiere in der Kabine. Sein Onkel drückte Klaus auf einen der freien Plätze und nahm anschließend den Sitz vor ihm ein. Den Koffer mit den Eiern und den Papieren über das Unternehmen Werwolf stellte er neben seinen Sitz in den Seitengang.
Ein ganz gewöhnlicher, unauffälliger Reisekoffer …
Was sich darin befand, war jedoch alles andere als gewöhnlich, dachte Klaus, als draußen vor der Maschine laute Rufe erklangen.
An der Tür entstand plötzlich eine Bewegung, und als Klaus sich umdrehte, sah er, wie ein Mann in einem braunen Mantel die Passagierkabine betrat.
»Tut mir leid«, entschuldigte sich der Mann außer Atem. »Ich wollte Sie nicht aufhalten. Joe Schmidt«, stellte er sich vor. Er sprach perfekt Deutsch, hatte jedoch einen Akzent, den Klaus nicht einordnen konnte. Ein Schweißfilm glänzte auf Schmidts Stirn, und er wischte ihn mit dem Handrücken ab. Heftig atmend blieb er für einen Moment an der Kabinentür stehen, sah sich um, wobei sein Blick kurz auf Klaus und schließlich auf seinem Onkel verharrte, ehe er sich auf dem Sitzplatz hinter Klaus niederließ.
Sobald die Tür geschlossen wurde, sprangen die Motoren an, und das Flugzeug setzte sich schaukelnd in Bewegung, bog auf die Startbahn ein und beschleunigte. Als die Maschine abhob, krampfte Klaus die Hände um die Kante seines Sitzes. Er schloss die Augen und bemühte sich, gleichmäßig zu atmen. Er hatte Angst. Teilweise deshalb, weil er nie zuvor in einem Flugzeug gesessen hatte. Er blickte nach unten auf den Koffer und dachte an das, was Greta über das Vierte Reich gesagt hatte, und auch an die Papiere und die Schmuckkästen im Koffer seines Onkels und an die Männer, die auf sie geschossen hatten, als sie geflüchtet waren. Und dann dachte er da noch an Gretas Bemerkung, dass sie Klaus als Begleitung brauchten. Damit sie nicht auffielen.
Aber wer sollte sich für sie interessieren und sie beobachten?
Irgendetwas brachte ihn dazu, sich zu dem Mann umzudrehen, der als Letzter an Bord gekommen war. Joe Schmidt. Ihre Blicke trafen sich. Der Mann nickte ihm unmerklich zu, und Kurt schaute weg. Irgendwann, eingelullt von dem eintönigen Dröhnen der Motoren, fiel er in einen unruhigen Schlaf.
Was ihn geweckt hatte, konnte er nicht sagen. Jedenfalls schlug Klaus die Augen auf und hatte anfangs Mühe, sich in der fremden Umgebung zurechtzufinden. Er sah sich um, dann blickte er hinter sich, als ein heftiger Stoß seinen Sitz erzittern ließ. Er sah, dass Joe Schmidt sich den Koffer seines Onkels geangelt hatte. Als der Mann bemerkte, dass er ertappt worden war, legte er einen Finger auf die Lippen.
Sie wurden tatsächlich beobachtet. Sein Herzschlag beschleunigte sich ein wenig, als die Hoffnung in ihm aufkeimte, dass jemand versuchte, die Nazis aufzuhalten. Er riskierte die Andeutung eines Kopfnickens, um dem Mann zu signalisieren, dass er ihn nicht verraten würde, und schaute zu seinem Onkel und bemerkte, dass dessen Kopf zur Seite gesunken war. Offenbar war er ebenfalls eingeschlafen. Zumindest glaubte er das, bis Ludwig Strassmairs Hand nach unten zum Kabinenboden rutschte, wo der Koffer gestanden hatte, und seine Finger ins Leere griffen. Strassmair sprang aus seinem Sitz hoch und schaute sich hektisch um. Als er sah, dass Schmidt sich mit seinem Koffer beschäftigte, stürzte er sich augenblicklich auf ihn.
Schmidt riss den Koffer hoch und stieß ihn nach vorn. Sein Onkel blockte ihn mit dem linken Unterarm ab und schmetterte die rechte Faust gegen Schmidts Kinn. Schmidt packte Strassmair bei den Schultern und zog ihn nach unten, während er ihm gleichzeitig das Knie ins Gesicht rammte.
Ludwig taumelte zurück, dann griff er in seinen Mantel und zog seine Pistole. Klaus drehte sich zu den anderen Passagieren um in der Hoffnung, dass sie aufsprangen und eingriffen. Aber sie duckten sich auf ihren Sitzen. Nur Greta kam von ihrem Platz hoch und fasste Klaus am Arm. Er fuhr herum, während Schmidt sich Ludwig Strassmair entgegenwarf und ihn mit seinem gesamten Körpergewicht rammte. Die beiden Männer stolperten über den Koffer und stürzten im Seitengang auf den Kabinenboden. Als Ludwigs Arm gegen eine Sessellehne prallte, verlor er die Pistole. Sie landete in Klaus’ Nähe. Greta stieß ihn beiseite. Sie hob die Pistole auf, während Ludwig Strassmair den Mann überwältigte und sein Gesicht mit den Fäusten bearbeitete, bis er das Bewusstsein verlor. »Töte ihn!«, rief Greta.
Sein Onkel bückte sich und griff nach seinem rechten Fuß. Als er wieder hochkam, hatte er ein Messer in der Hand, das er offensichtlich in seinem Stiefelschaft versteckt hatte. Er stieß es dem Bewusstlosen blitzschnell dicht unterhalb des Brustbeins in den Leib.
Klaus starrte, vor Schock gelähmt, auf den schnell wachsenden roten Blutfleck auf Schmidts weißem Oberhemd. Sein Magen revoltierte, Übelkeit wallte in ihm auf und ließ ihn würgen. Er machte mehrere abgehackte Atemzüge, um den drohenden Brechreiz zu unterdrücken. »Warum …?«
Greta musste trotz des lauten Dröhnens der Maschinen seine Frage verstanden haben. »Er ist ein Spion, den man auf uns angesetzt hat, um uns aufzuhalten.«
Eine Luftturbulenz schüttelte das Flugzeug durch und schleuderte Klaus und Greta zwischen die Sitze. Ihr rutschte die Pistole aus der Hand, als sie versuchte, den Sturz abzufangen. Klaus schnappte sich die Waffe. Seine Hand zitterte, als er sie auf Greta richtete.
Sie wollte sich hochkämpfen und streckte die Hand nach der Pistole aus, aber er stieß die Frau in den Sessel zurück. Sie griff nach Klaus, wollte ihn festhalten. »Junge, was hast du vor? Das darfst du nicht tun.«
Ludwig Strassmairs Augen zuckten nach oben, als er erkannte, dass Klaus seine Waffe hatte.
»Klaus! Gib mir die Pistole …« Strassmair machte einen Schritt vorwärts. »Es ist vorbei. Es gibt keinen Grund, den Kampf fortzusetzen.«
Tränen ließen vor Klaus’ Augen alles verschwimmen. »Ich schieße!«
»Das wird überhaupt nichts bewirken«, sagte sein Onkel. Er schaute zu Greta und nickte kurz.
Sie stand auf und machte einen Schritt in Klaus’ Richtung. Er richtete die Pistole auf sie, und sie hielt inne.
Sein Onkel trat neben sie und sah seinen Neffen beschwörend an. »Wenn dieses Flugzeug landet, werden die Papiere auf jeden Fall weitergeschickt. Wenn du mir hilfst, sie zum Adressaten zu bringen, erhältst du eine Belohnung. Du und dein Vater, ihr werdet alles Geld bekommen, das ihr braucht. Denk an deine Mutter.«
Klaus blinzelte die Tränen weg, sah den toten Mann und fragte sich, ob dies alles ein ausreichender Grund war, um zu sterben … War es möglich, dass auch sein Bruder auf diese Weise den Tod gefunden hatte?
»Klaus …« Sein Onkel streckte die Hand aus. »Deine Mutter will ganz bestimmt nicht, dass dir irgendetwas zustößt. Gib mir die Pistole.«
Folge dem Ruf deines Herzens … Tu das … Du wirst dafür belohnt … Versprich es mir …
Er hörte die Stimme seiner Mutter deutlich in seinem Kopf. Mit wild klopfendem Herzen wich er vor Greta und seinem Onkel zurück. Dann richtete er die Pistole auf die beiden Passagiere auf den vorderen Sitzen, die ihn aufhalten wollten. »Gehen Sie mir aus dem Weg!«, rief er mit überkippender Stimme, drängte sich an ihnen vorbei und ging Schritt für Schritt rückwärts, bis er gegen die Leiter stieß, die ins Cockpit hinaufführte.
»Klaus!«, brüllte Ludwig Strassmair. »Komm sofort hierher!«
Klaus hielt die Pistole auf sie gerichtet. »Bleibt zurück«, sagte er, tastete nach der Leiter und stieg sie, nur eine Hand zu Hilfe nehmend, hinauf, während er Greta und seinen Onkel ständig im Auge behielt. Er schob den Kopf in die Führerkanzel, erblickte den Piloten auf seinem Sitz, wo er konzentriert die Kontrollen bediente und weder nach links noch nach rechts sah. Entweder hatte er gar nicht mitbekommen, was sich im hinteren Teil des Flugzeugs abgespielt hatte, oder er hatte zu viel damit zu tun, die Maschine zu lenken, um darauf zu reagieren.
Klaus machte einen tiefen Atemzug und blickte auf seinen Onkel hinunter.
»Nein!«, brüllte Strassmair und stürzte durch den Seitengang vorwärts. »Halten Sie ihn auf!«
Jemand fasste nach Klaus’ Bein, als er sich auf der Leiter umdrehte. Zu spät. Er erschoss den Piloten. Der Mann sackte nach vorn, und das Flugzeug geriet ins Taumeln. Klaus stürzte ins Cockpit. Der schwarze Himmel war plötzlich grellweiß, als sie den mit Schnee bedeckten Bergen entgegentrudelten und das Dröhnen der Motoren die Schreie der Passagiere verschluckte.
In diesen letzten Sekunden dachte Klaus nicht an den Tod, sondern an seine Mutter.
Und daran, sie schon bald wiederzusehen.
1
LAGUNA MOUNTAINSSAN DIEGO COUNTY, KALIFORNIEN
»Nach links!«
»Verstanden. Gehe nach links. Fünf … vier …«
Der Helikopter schwebte dicht vor der senkrechten Felswand. Der Korb, der unter der Maschine an einem Kabel hing, schwang langsam hin und her, während die Retter in das tragbare Funkgerät sprachen. »Auf keinen Fall näher herankommen. Du bist nur noch eins-null von der Wand entfernt.«
»Verstanden.«
Sam Fargo beobachtete, wie zwei Mitglieder der Freiwilligen Bergrettung – ein Mann und eine Frau, beide in Khakiuniformen und mit gelben Schutzhelmen auf den Köpfen – den Helikopter-Korb näher an seine Frau Remi herandirigierten. Sie lag auf einem Felsvorsprung, und ihr linkes Bein war mit einer behelfsmäßigen Schiene stabilisiert worden. Der von den Rotorflügeln erzeugte Luftwirbel peitschte ihr das kastanienbraune Haar ins Gesicht, und ihre Augen tränten von dem Staub, der die Luft unter dem Hubschrauber sättigte. Der Mann blickte zu dem Hubschrauber hinauf, der im Schwebeflug wartete. »Wir sind dran!«, meldete er per Funk.
Aufmerksam verfolgte Sam jede ihrer Aktionen und unterdrückte nur mit Mühe den Drang, einzuschreiten und das Kommando zu übernehmen. Und auch wenn er genau wusste, dass seine Frau in guten Händen war, fiel es ihm schwer, nur zuzuschauen und nichts zu tun. Innerhalb weniger Minuten hatten die beiden Retter sie in den Korb gebettet. Dann zogen sie sich ein wenig zurück, während der Korb aus der Steilwand hochgezogen wurde. Kaum war Remi wohlbehalten unterwegs und in Sicherheit, als sich Sams Mobiltelefon meldete. Am liebsten hätte er den Anruf ignoriert, aber als er sah, dass Selma Wondrash, die Chefin des Rechercheteams, das zu ihnen gehörte, ihn zu sprechen wünschte, meldete er sich. »Selma.«
»Wie geht es Mrs. Fargo?«
»Ganz bestimmt sehr viel besser als allen anderen hier. Zumindest wird sie von hier ausgeflogen. Wir anderen müssen klettern und uns abseilen.«
»Bei der nächsten Gelegenheit können Sie sich doch mal zur Abwechslung freiwillig als Opfer melden«, sagte Selma und kam sofort zum Grund ihres Anrufs. »Sie erinnern sich sicher noch an die Neffen meines Cousins, denen Sie und Mrs. Fargo damals bei ihrer Dokumentation über die Rattenlinien geholfen haben, oder nicht?«
Weil er und Remi durch die Fargo Foundation, die gemeinnützige Stiftung, die sie gegründet hatten, so viele Bildungsprogramme und archäologische Projekte förderten, verlor er manchmal den Überblick darüber, wen sie jeweils zurzeit unterstützten. In diesem Fall hingegen konnte er sich, da er sich selbst für die Geschichte des Zweiten Weltkriegs brennend interessierte, deutlich an die beiden jungen Männer und ihr Projekt, eine ausführliche Dokumentation über die Rattenlinie – ein System von Fluchtrouten, die von Nazis und Faschisten benutzt wurden, die nach dem Krieg aus Europa geflohen waren –, erinnern. Trotzdem dauerte es einen Augenblick, bis ihm ihre Namen wieder einfielen. »Karl und Bernd Hoffler. Ich entsinne mich. Was ist mit ihnen?«
»Ihr Onkel versucht seit ein paar Tagen vergeblich, sie zu erreichen. Er macht sich große Sorgen. Vor allem nachdem er in seiner Voicemail eine seltsame Nachricht von ihnen hatte.«
»Haben Sie irgendeine Ahnung, worum es ging?«
»Die Rede war offensichtlich von einem verschollenen Flugzeug in Marokko und davon, dass irgendwelche Leute hinter ihnen her seien. Von den Behörden kann er keine Hilfe erwarten, weil die Jungen ihr Projekt nicht beim Konsulat angemeldet haben, und zurzeit scheint niemand zu wissen, wo sie sich aufhalten. Ich sagte ihm, Sie könnten vielleicht einige Ihrer Verbindungen spielen lassen und jemanden auf die Geschichte ansetzen. Ich weiß zwar, dass Remi und Sie heute Abend einen wichtigen Termin haben, aber …«
»Es geht schließlich um Ihre Familie«, unterbrach Sam sie, hob seinen Rucksack auf und schwang ihn sich auf die Schultern. »Lassen Sie unser Flugzeug startklar machen. Sobald Remi und ich nach Hause kommen, packen wir unsere Siebensachen und machen uns auf den Weg zum Flughafen.«
* * *
Sam und Remi Fargo gaben sich nicht wie zahlreiche Multimillionäre damit zufrieden, sich auf den Früchten profitabler geschäftlicher Entscheidungen auszuruhen, die ihnen mehr Geld eingebracht hatten, als sie in mehreren Leben hätten ausgeben können. Sam hatte an der Caltech ein Ingenieursdiplom erworben und anschließend sieben Jahre bei der DARPA, der Defense Advanced Research Projects Agency, gearbeitet. Diese hatte er jedoch verlassen, um seine eigene Firma zu gründen, mit der er durch eine Reihe von Erfindungen, die von Militär und Geheimdienst benutzt wurden, ein Vermögen verdient hatte. Remi, Anthropologin und Historikerin, die sich vor allem mit den Handelsrouten der Antike beschäftigte, hatte ihr Studium am Boston College absolviert. Ihre wissenschaftliche Ausbildung erwies sich als nützlich für ihr ganz besonderes gemeinsames Hobby – die Suche nach verschollenen Schätzen in allen Winkeln der Welt. Eine zusätzliche Hilfe war ihr nahezu fotografisches Gedächtnis sowie die Tatsache, dass sie mehrere Sprachen fließend beherrschte und außerdem eine hervorragende Scharfschützin war und sich im Umgang mit allen möglichen Schusswaffen bestens auskannte. Nach zahlreichen heiklen Situationen, die sie im Laufe der Jahre hatten meistern können, gab es für Sam niemanden außer Remi, den er sich als Partner hätte vorstellen können.
Was ihren noch für diesen Tag geplanten sofortigen Abflug betraf, gab es jedoch ein kleines Problem. Zufälligerweise war dies auch der Jahrestag ihrer ersten Begegnung im Lighthouse Cafe, einem Jazzbistro in Hermosa Beach. Dieses Datum war für sie noch wichtiger als ihr Hochzeitstag, also feierten sie es jedes Jahr, indem sie sich zu einem Rendezvous an demselben Tisch einfanden, an dem sie auch schon am ersten Abend gesessen und sich die ganze Nacht angeregt unterhalten und dabei vollkommen Zeit und Stunde vergessen hatten.
Remi wartete am Wagen auf Sam, als er schließlich dort erschien, nachdem er mit den freiwilligen Helfern den Aufstieg über die Felswand geschafft hatte.
»Du hast ganz schön lange gebraucht«, sagte sie und sah demonstrativ auf die Uhr. »Wenn wir nicht bald aufbrechen, geraten wir in den Berufsverkehr und stecken fest.«
Sam warf sein Klettergeschirr in den Kofferraum des Range Rovers. »Besteht die Chance, dass du dich mit einer Planänderung anfreunden könntest …?« Er ließ die Frage in der Luft hängen, als er ihren enttäuschten Gesichtsausdruck sah.
»Wir haben bisher kein einziges Mal den Gedächtnisabend unseres Kennenlernens im Lighthouse versäumt.«
»Vielleicht können wir für dieses Problem eine Lösung finden und das Ganze ein wenig aufpeppen. Ich dachte an eine ganze Kennenlern-Gedächtniswoche, allerdings irgendwo anders. Zum Beispiel in Marokko?« Ehe sie Gelegenheit hatte, darauf zu reagieren, fügte er hinzu: »Es ist möglich, dass Selmas Familie in großen Schwierigkeiten ist.«
»In diesem Fall freue ich mich auf ein Gedenk-Rendezvous in Marokko.«
2
Es war später Vormittag, und die Sonne, die fast im Zenith stand, brachte die mit Schnee bedeckten Gipfel des Atlasgebirges in der Ferne zum Funkeln, als die Maschine der Fargo Foundation mit Sam und Remi an Bord in Marrakesch landete. Sie mieteten einen schwarzen allradgetriebenen Toyota Prado, dann fuhren sie los, um mit Selmas Cousin Albert Hoffler zusammenzutreffen, der – als sie die Zufahrt hinaufrollten – bereits vor dem Hotel auf sie wartete.
»Er sieht genauso aus wie Selma«, stellte Remi fest, während Sam dem Hoteldiener den Zündschlüssel übergab, damit er den Wagen parken konnte. »Zumindest gilt das für die Augenpartie.«
Genau genommen war er etwa im gleichen Alter wie Selma – in den Fünfzigern – und hatte braunes Haar. Hinzu kam bei ihm ein sorgfältig getrimmter Kinn- und Schnurrbart mit grauen Strähnen. Sein Lächeln erschien ein wenig gezwungen, was unter den gegebenen Umständen durchaus verständlich war. »Mr. und Mrs. Fargo, ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen dafür danken soll, dass Sie den weiten Weg hierher geflogen sind.«
»Bitte. Nennen Sie uns Sam und Remi. Förmlichkeiten dieser Art sollten wir Selma überlassen«, sagte Sam lächelnd und schüttelte ihm die Hand.
»Stil und geschliffene Umgangsformen sind tatsächlich Selmas Domäne. So war und ist es schon ihr ganzes Leben lang.« Albert Hofflers Lächeln verflog schnell, und er gab einen traurigen Seufzer von sich. »Aber … wir können uns während des Mittagessens unterhalten. Ich habe einen Tisch reserviert.«
Er geleitete sie über eine Art weitläufige Freiluftlobby mit einem Springbrunnen und einem spiegelglatten Teich in der Mitte. Das Restaurant befand sich am hinteren Ende des Vorhofs. Die Tische waren um den Teich herum arrangiert. Nachdem sie Platz genommen hatten, fragte Albert: »Wie viel hat Selma Ihnen erzählt?«
»Sie sprach von einer Voicemail«, erwiderte Sam, »die Sie erhielten, während die beiden jungen Männer hier an ihrer Dokumentation arbeiteten. Dass die Kooperation der Behörden gleich null war und dass Sie von dieser Seite kaum nennenswerte Hilfe erwarten können.«
»Man kann nicht unbedingt behaupten, dass sie nicht helfen wollen, eher ist es so, dass sie nichts haben, was sie als Anhaltspunkt für gezielte Maßnahmen nutzen könnten. Tatsächlich ist es sogar so, dass die beiden nicht als offiziell vermisst gelten, da sie erst in ein oder zwei Tagen zurückerwartet werden. Aber nach dieser Voicemail …«
»Was können Sie uns über die Aktivitäten Ihrer Neffen erzählen?«, fragte Sam.
»Sie kamen nach Abschluss ihrer Arbeit in Spanien hierher. Sie hatten dort die Fluchtrouten dokumentiert, die von hochrangigen Nazioffizieren benutzt worden waren, als sie sich nach Südamerika absetzten. Ich glaube, dies war das Projekt, das von Ihnen finanziert wurde. Sie suchten in Casablanca nach entsprechenden Schiffsfrachtdokumenten aus dieser Zeit, verloren ihr ursprüngliches Ziel jedoch für einige Zeit aus den Augen, als sie auf die Legende von einem Piloten stießen, der den Nazis treu gewesen war und kurz nach dem Krieg dort gerettet worden sein soll. Offenbar sprang er aus seiner Maschine ab, kurz bevor sie abstürzte, und wanderte tagelang durch die Wüste. Als er schließlich gefunden wurde, erzählte er irgendetwas Unverständliches von einer Landkarte.«
Sam bemerkte, wie Remi aufmerksam den Kopf hob. Geheimnisvolle Landkarten übten einen unwiderstehlichen Reiz auf sie aus. »Was war auf dieser Landkarte zu sehen?«, fragte sie.
»Das ist genau der Punkt. Niemand weiß, ob das Ganze überhaupt so stattgefunden hat. Die Jungen glaubten, dass es eine Karte gewesen sein könnte, die den Verlauf der Rattenlinie zeigte. Natürlich interessierten sie sich für die Karte und hätten sie gerne in ihre Dokumentation aufgenommen. Sie verließen Casablanca und reisten zuerst nach Marrakesch und von dort zu einigen Dörfern am Fuß des Atlasgebirges, um den Ursprung der Legende zu ergründen und sich zu erkundigen, wer sie kannte und vielleicht sogar über den angeblichen Flugzeugabsturz Bescheid wusste. Das Letzte, was ich hörte, war, dass sie einen vielversprechenden Hinweis hinsichtlich des Absturzortes erhalten hatten, dem sie unbedingt nachgehen wollten. Ich habe ihre Mobiltelefone angerufen, landete aber jedes Mal sofort in der Voicemail, und zurückgerufen haben sie bisher nicht. Die Hotelleitung war sehr kooperativ und gestattete mir den Zutritt zu ihrem Zimmer, damit ich dort nach irgendeinem Hinweis suchen konnte. Ihre Koffer, weitere Fotokameras und sonstige Ausrüstung befinden sich zwar dort, aber ihre Rucksäcke und ihr Kletterzeug sind verschwunden. Sie sind hervorragende Bergsteiger.« Er hielt inne, um sich bei dem Kellner zu bedanken, der ihre Gläser mit Mineralwasser füllte, das mit Minzeblättern aromatisiert war. Als er sich entfernt hatte, sagte Albert Hoffler: »Ihre Zimmer sind bis zum Wochenende gebucht, und der Hotelmanager meint, dass er sich größere Sorgen machen würde, wenn sie bis dahin nicht zurückgekehrt seien. Sie hatten ihm offenbar erklärt, sie seien längere Zeit unterwegs.«
»Wann war das?«, fragte Sam Fargo.
»Er schätzt, vor fünf Tagen. Ich weiß, was Sie jetzt denken. Sie sagten, sie seien für längere Zeit nicht zu erreichen. Aber wenn Sie diese Nachricht gehört hätten …«
»Existiert sie noch?«
»Ich kann sie Ihnen vorspielen. Ich glaube, sie hatten ein schwaches Netz. Einiges ist überhaupt nicht zu verstehen. Außerdem ist die Sprache Deutsch.«
»Remi spricht Deutsch.«
Er holte sein Mobiltelefon hervor, rief die Mailbox mit den gespeicherten Sprachnachrichten auf, tippte auf das play-Symbol und legte das Telefon auf den Tisch.
Sie beugten sich vor, um besser hören zu können. Remi bat ihren Gastgeber, die Nachricht ein zweites Mal abzuspielen, damit sie den Text für Sam aufschreiben könne. »Wir haben es gefunden! Das Flugzeug! Am Kamel … nicht sicher. … wird geschossen … Vielleicht jemand … da draußen … Tage.«
»Hören Sie, wie aufgeregt seine Stimme klingt?«, fragte Albert Hoffler.
»Oder so, als hätte er Angst und sei in Panik.«
»Panik. Das war es, was ich meinte. Und weshalb ich hierhergekommen bin. Bei dem schlechten Empfang und dem bruchstückhaften Text … wer weiß, was wirklich da draußen geschah.«
Sam nickte. »Wann kam die Nachricht bei Ihnen an?«
»Laut der Datumsangabe über den Eingang der Nachricht war es zwei Tage, nachdem sie das Hotel für ihren Ausflug in die Berge verlassen hatten.« Er nahm das Telefon von der Tischplatte hoch und machte einen tiefen Atemzug. »Diese Nachricht ist das Letzte, was ich von ihnen hörte.« Er ließ den Blick einige Sekunden lang geistesabwesend über den Vorhof mit seinen Sitzgruppen und Restauranttischen schweifen. Plötzlich zuckte er zusammen und richtete sich kerzengerade auf. »Das dort ist der Mann, mit dem sie zusammen waren! Ich bin mir ganz sicher!«
»Wie bitte?«
Er deutete auf eine Gruppe Topfpalmen in der Freiluftlobby. Sie verdeckte zum Teil die Hotelrezeption. »Dieser Mann dort im blauen Oberhemd, der sich gerade mit der Angestellten am Empfang unterhält.« Hoffler öffnete das Bildarchiv seines Mobiltelefons und zeigte Sam und Remi ein Foto von drei jungen Männern, die auf einer rustikalen Holzbank saßen. Jeder hatte einen Bierkrug in der Hand und prostete damit dem Fotografen zu. »Das sind meine Neffen«, sagte Albert und deutete auf die beiden Männer auf der rechten Hälfte der Bank. Sam betrachtete das Foto genauer. Einer der jungen Männer trug eine rote Windjacke, und beide hatten von der Sonne gebleichtes braunes Haar und braune Augen. »Dieser Mann auf der linken Seite«, sagte Albert. »Ihn haben sie angeheuert, um sie zu den Berberdörfern zu führen.«
Sam verglich das Foto mit dem dunkelhaarigen Mann an der Rezeption. »Kein Zweifel, er ist es. Eindeutig. Fragen wir ihn doch mal, was er weiß.«
Sie erhoben sich von ihren Stühlen und steuerten auf den Empfangstisch zu. Als der Mann sich umdrehte und sah, dass sie in seine Richtung kamen und es offensichtlich auf ihn abgesehen hatten, startete er durch und sprintete zum Ausgang.
3
Sam nahm die Verfolgung auf. Remi blieb dicht hinter ihm und ignorierte die seltsamen Blicke der anderen Gäste. Sam wandte sich nach rechts und überquerte die gepflasterte Auffahrt. Der Mann bog um die Ecke, dann rannte er eine Seitenstraße hinunter. Sein Ziel war ein roter Renault. Noch im Laufen holte er den Zündschlüssel aus der Tasche. Er richtete ihn auf den Wagen, und ein gedämpfter Piepton erklang, als die Türen entriegelt wurden. Er hatte die Fahrertür noch nicht vollständig geöffnet, als Sam ihn einholte, die Hand in sein Hemd krallte, ihn herumriss und mit dem Rücken gegen den Wagen rammte.
»Non! Non! Je vous en prie!«, sagte der Mann. »Je ne sais rien!« Wie die meisten Einheimischen beherrschte er offenbar neben der marokkanischen auch die französische Sprache.
Sams Hand schoss hoch zum Hals des Mannes und packte ihn. »Sprechen Sie Englisch?«
Der Mann nickte heftig. »Ein wenig.«
»Ihr Name?«
»Z-Zakaria Koury.«
»Zakaria. Wir sind auf der Suche nach Karl und Bernd Hoffler.«
»Ich … ich kenne sie nur vom Telefon. Getroffen haben wir uns nicht.«
»Seltsam. Wir haben ein Foto gesehen, das etwas vollkommen anderes erzählt.«
»Es muss ein sehr altes Bild sein. Ich schwöre, ich weiß überhaupt nichts.«
Remi ging zu dem Renault, dessen roter Lack schon leicht verblichen war. Sie blickte durch ein Seitenfenster hinein, während Sam sein Verhör fortsetzte. »Sie behaupten, dass sie nur mit ihnen telefoniert haben, aber Sie haben sich während der Fahrt niemals mit einem von ihnen getroffen, oder?«
»Ich glaube, sie entschieden sich für einen anderen Führer. Sie haben mir nicht verraten, für wen. Vielleicht wollten sie meinen Stolz nicht verletzen. Ich weiß es nicht.«
Sam betrachtete das verschlungene Kabelgewirr auf dem Rücksitz des Renaults und fixierte Zakaria drohend. »Kennen Sie sich in audiovisueller Technik aus? Besitzen Sie solche Geräte?«, fragte er.
»Nur die Kamera und mein Mobiltelefon.«
»Warum liegt dann ein Bündel AV-Kabel auf dem Rücksitz Ihres Wagens?«
Ein dünner Schweißfilm glänzte plötzlich auf Zakarias Stirn, und er schüttelte den Kopf. »Ich … ich weiß es nicht.«
Sam schob sich ganz dicht an den Mann heran und verstärkte den Druck seiner Hand um dessen Hals. »Vielleicht muss man Ihrem Gedächtnis ein wenig auf die Sprünge helfen. Wo sind die beiden?«
In den Augen des Mannes, der sich Zakaria nannte, flackerte die nackte Angst. »Ich weiß es wirklich nicht! Ich schwöre!«
»Wir mögen es gar nicht, wenn man uns Lügen auftischt«, sagte Sam. »Erst recht nicht, wenn jemand von unserer Familie in Gefahr ist.« Er blickte zu Remi hinüber. »Bitte das Ganze auf Französisch, falls er mich nicht verstanden haben sollte.«
Der Blick des jungen Mannes wanderte zu Remi, während sie übersetzte. Als sie fertig war, fügte Sam hinzu: »Außerdem arbeiten sie zurzeit an einem Film, den wir finanzieren. Falls ihnen irgendetwas zustoßen sollte …«
»Einen Moment, bitte. Sind Sie die Fargos?«
Sam lockerte den Griff um Zakarias Hals. »Sie wissen, wer wir sind?«
Der dunkelhaarige Mann nickte, dann wanderte sein Blick zu Albert Hoffler. »Wer ist das?«
»Der Onkel der beiden.«
Der junge Mann schloss die Augen und entspannte sich, wobei seine Knie ein wenig nachgaben, als ob er plötzlich zutiefst erleichtert wäre. »Bitte. Sie müssen mich verstehen. Ich wollte sie nur beschützen.«
»Vor wem?«, fragte Sam, ließ den Mann schließlich los und trat zurück.
Zakaria Koury massierte sich den Hals und schluckte mehrmals krampfhaft. »Das weiß ich nicht. Sie haben mich angerufen und berichtet, dass sie verfolgt würden. Jemand habe auf sie geschossen, aber sie hätten flüchten können. Sie glaubten, es hinge mit ihrer Suche nach dem Flugzeug zusammen.«
»Wie lange ist das her?«
»Etwa vier Tage.«
»Sind sie nicht zurückgekommen?«





























