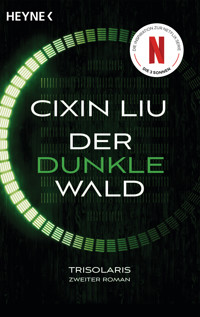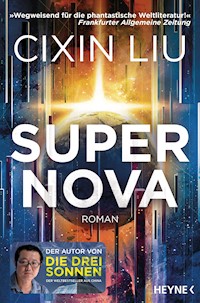11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Trisolaris-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Der Roman zum Netflix-Blockbuster »Three-Body Problem«
Ein halbes Jahrhundert nach der Entscheidungsschlacht hält der Waffenstillstand mit den Trisolariern immer noch stand. Die Hochtechnologie der Außerirdischen hat der Erde zu neuem Wohlstand verholfen, auch die Trisolarier haben dazugelernt, und eine friedliche Koexistenz scheint möglich. Der Frieden hat die Menschheit allerdings unvorsichtig werden lassen. Als mit Cheng Xin eine Raumfahrtingenieurin des 21. Jahrhunderts aus dem Kälteschlaf erwacht, bringt sie das Wissen um ein längst vergangenes Geheimprogramm in die neue Zeit. Wird die junge Frau den Frieden mit Trisolaris ins Wanken bringen – oder wird die Menschheit die letzte Chance ergreifen, sich weiterzuentwickeln?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1066
Veröffentlichungsjahr: 2019
Sammlungen
Ähnliche
Das Buch
Ein halbes Jahrhundert nach der Entscheidungsschlacht hält der Waffenstillstand mit den Trisolariern immer noch stand. Die Hochtechnologie der Außerirdischen hat der Erde zu neuem Wohlstand verholfen, auch die Trisolarier haben dazugelernt, und eine friedliche Koexistenz scheint möglich. Der Frieden hat die Menschheit allerdings unvorsichtig werden lassen. Als mit Cheng Xin eine Raumfahrtingenieurin des 21. Jahrhunderts aus dem Kälteschlaf erwacht, bringt sie das Wissen um ein längst vergangenes Geheimprogramm in die neue Zeit. Wird die junge Frau den Frieden mit Trisolaris ins Wanken bringen – oder wird die Menschheit die letzte Chance ergreifen, sich weiterzuentwickeln?
»Vertrauen Sie mir, ich weiß, was ich tue, und lesen Sie Cixin Liu!« Denis Scheck, Druckfrisch
»Cixin Liu ist der chinesische Arthur C. Clarke.« The New Yorker
Der Autor
Cixin Liu ist einer der erfolgreichsten chinesischen Science-Fiction-Autoren. Er hat lange Zeit als Ingenieur in einem Kraftwerk gearbeitet, bevor er sich ganz seiner Schriftstellerkarriere widmen konnte. Seine Romane und Erzählungen wurden bereits viele Male mit dem Galaxy Award prämiert. Cixin Lius Roman Die drei Sonnen wurde 2015 als erster chinesischer Roman überhaupt mit dem Hugo Award ausgezeichnet und wird international als ein Meilenstein der Science-Fiction gefeiert.
Mehr über Cixin Liu und sein Werk auf:
Cixin Liu
JENSEITS DER ZEIT
Roman
Aus dem Chinesischen von
Karin Betz
Deutsche Erstausgabe
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Inhalt
Personenverzeichnis
Übersicht der Zeitalter
Prolog
ERSTER TEIL
ZWEITER TEIL
DRITTER TEIL
VIERTER TEIL
FÜNFTER TEIL
SECHSTER TEIL
Erläuterungen zu Schreibweise und Aussprache
Anmerkungen
Personenverzeichnis
Chinesische Namen bestehen aus einem meist einsilbigen Familiennamen und einem Vornamen. Der Familienname wird immer zuerst genannt, dann der Vorname.
Organisationen
ETO
Erde-Trisolaris-Organisation
ESF
Erdsicherheitskräfte
(Earth Security Force)
PDC
Planetenverteidigungsrat
(Planetary Defence Council)
PIA
Planetarer Geheimdienst
(Planetary Intelligence Agency)
Personen
Yang Dong
Astrophysikerin und Tochter von Ye Wenjie, der Entdeckerin der Trisolarier
Cheng Xin
Raumfahrtingenieurin und Schwerthalterkandidatin
Yun Tianming
Ehemaliger Studienkollege von Cheng Xin, todkrank
Thomas Wade
Direktor der PIA
Tomoko
Android, diplomatische Vertretung der Trisolarier auf der Erde
AiAA
Astrophysikerin und Gefährtin von Cheng Xin
Luo Ji
Ehemaliger Wandschauer, jetzt Schwerthalter
Guan Yifan
Astrophysiker auf der Gravitation
Übersicht der Zeitalter
Zeitalter der Krise
201X – 2208
Zeitalter der Abschreckung
2208 – 2270
Post-Abschreckungszeitalter
2270 – 2272
Zeitalter der Übertragung
2272 – 2332
Zeitalter der Bunker
2333 – 2400
Zeitalter der Milchstraße
2273 – unbekannt
Schwarze Domäne der Galaxie DX3906
2687 – 18.906.416
Zeitachse des Universums 647
Beginnt 18.906.416
Prolog
Auszug aus dem Vorwort zu Eine Vergangenheit außerhalb der Zeit
Eigentlich sollte es Geschichte heißen, doch da die Verfasserin sich ausschließlich auf ihr Gedächtnis verlassen muss, mangelt es diesen Aufzeichnungen an historischer Genauigkeit.
Selbst von Vergangenheit zu sprechen trifft es nicht ganz, denn das alles ist nicht in der Vergangenheit passiert, es passiert auch nicht jetzt oder in der Zukunft.
Ich möchte keine Details auflisten, nur den Rahmen für etwas Geschichtliches oder etwas Vergangenes abstecken. Überlieferte Details gibt es bestimmt schon in Hülle und Fülle. Hoffentlich werden sie als Flaschenpost das neue Universum erreichen und dort fortbestehen.
Ich schaffe also nur einen Rahmen, in den eines Tages sämtliche Details hineingepackt werden können. Nicht von uns natürlich. Doch hoffentlich von irgendwem, irgendwann.
Schade nur, dass dieses Irgendwann weder in der Vergangenheit, noch in der Gegenwart oder der Zukunft liegt.
Ich verrücke die Sonne etwas nach Westen, und durch den veränderten Einfallswinkel der Sonnenstrahlen funkeln die Tautropfen auf den Sprösslingen, als öffneten sich mit einem Mal unzählige Augen. Ich dimme das Sonnenlicht ein wenig, lasse die Dämmerung früher einsetzen und betrachte meine Silhouette am fernen Horizont. Ich hebe die Hand und winke. Und die Silhouette vor der Sonne winkt zurück. Beim Anblick dieser Silhouette fühle ich mich ziemlich jung.
Das ist eine gute Zeit. Der perfekte Moment, um sich zu erinnern.
Erster Teil
Mai 1453
Der Tod der Hexe
Konstantin XI. hielt kurz inne, dann schob er den Haufen mit den Plänen zur Verteidigung der Stadt von sich weg und verharrte still an seinem Schreibtisch.
Sein Zeitgefühl war ausgezeichnet: Die Erschütterung trat ein wie erwartet, so heftig und mächtig, als dränge sie aus den Tiefen der Erde herauf. Sie ließ den silbernen Lüster erzittern, und eine Staubschicht wehte von ihm herab, die sich wohl schon seit tausend Jahren über den Palast von Konstantinopel gelegt hatte. Der Staub fiel in die Flamme der Kerze und erzeugte dort sprühende Funken. Alle drei Stunden – so lange dauerte es, um die von einem Ingenieur namens Urban entwickelten Kanonen nachzuladen – schlugen die sechshundert Kilogramm schweren Geschosse gegen die Mauern Konstantinopels. Das waren die solidesten Befestigungsanlagen der Welt. Im fünften Jahrhundert von Theodosius II. errichtet, waren sie immer weiter verstärkt und vergrößert worden. Vor allem ihnen war es zu verdanken, dass das Byzantinische Reich so vielen mächtigen Feinden standgehalten hatte.
Doch mit jedem Treffer meißelten die gigantischen Steinkugeln klaffende Scharten in diese Mauern, die wie die Bisse eines Riesen aussahen. Dem Kaiser stand die Szene lebhaft vor Augen: Noch während die Trümmer der Explosion durch die Luft flogen, rannten Soldaten und Stadtvolk zu den Rissen und bemühten sich wie ein Haufen heroischer Ameisen, sie irgendwie zu stopfen, mit Mauerwerk und Holzpfeilern von den Häusern der Stadt, mit Leinensäcken voll Erde und wertvollen arabischen Wandteppichen … Selbst die enorme Staubwolke konnte er sich vorstellen, die vor dem Licht der untergehenden Sonne Richtung Stadt waberte und Konstantinopel in ein goldenes Leichentuch hüllte.
Seit Beginn der Belagerung vor fünf Wochen erfolgten die Erschütterungen sieben Mal am Tag, so regelmäßig wie der Glockenschlag einer gewaltigen Uhr. Sie läuteten ein neues Zeitalter ein, das Zeitalter der Heiden. Im Vergleich zu diesem Getöse wirkte das Läuten der Kupferuhr mit dem Doppeladler, die am Eckturm der Mauer die Zeit der Christenheit anzeigte, geradezu kraftlos.
Die Vibrationen versiegten, und Kaiser Konstantin zwang seine Gedanken wieder in die unmittelbare Realität zurück. Er signalisierte der Wache, dass er nun bereit war, den vor der Tür wartenden Besucher zu empfangen. Sein Vertrauter Sphrantzes betrat den Raum, in Begleitung einer schlanken, zerbrechlich wirkenden Gestalt.
»Euer Majestät, hier bringe ich Ihnen Theodora.« Sphrantzes trat zur Seite, um den Blick auf die Frau freizugeben.
Der Kaiser betrachtete sie. Die adligen Damen Konstantinopels bevorzugten Kleider, die mit schwerer Stickerei bedeckt waren, im Gegensatz zur schlichten, knöchellangen weißen Kleidung der einfachen Leute. Doch diese Frau trug beides. Statt der üblichen bestickten Tunika hatte sie ein langes, weißes Gewand an und darüber einen eleganten, kostbaren Umhang, der jedoch nicht die dem Adel vorbehaltenen Lila- und Rottöne aufwies, sondern von gelber Farbe war. Sie hatte ein entzückendes, sinnliches Gesicht, das an eine Blume erinnerte, die lieber bei der Zurschaustellung ihrer Pracht verrottete, als einsam vor sich hin zu welken. Eine Prostituierte der besseren Sorte. Sie hielt den Blick gesenkt und zitterte am ganzen Körper, doch Konstantin bemerkte den fiebrigen Glanz ihrer Augen, der von einem in ihren Kreisen seltenen, leidenschaftlichen Eifer kündete.
»Du behauptest also, über magische Kräfte zu verfügen?«, sprach der Kaiser sie an, bestrebt, diese Angelegenheit möglichst schnell hinter sich zu bringen.
Sphrantzes war für gewöhnlich ein untadeliger Mann. Unter den achttausend Soldaten, die gegenwärtig zur Verteidigung Konstantinopels im Einsatz waren, stammte ein kleiner Teil von der Armee, und zweitausend waren genuesische Söldner. Die Übrigen waren von Sphrantzes nach und nach aus den Reihen der Stadtbewohner rekrutiert worden. Sein aktuelles Anliegen interessierte den Kaiser zwar nur mäßig, doch aufgrund seiner Stellung hatte Sphrantzes es verdient, wenigstens angehört zu werden.
»Ja, ich kann den Sultan töten«, antwortete Theodora und kniete sich vor ihn hin. Ihre Stimme zitterte wie Spinnfäden im Wind.
Vor fünf Tagen war Theodora vor den Toren des Palasts aufgetaucht und hatte verlangt, den Kaiser zu sprechen. Als die Wachen sie fortjagen wollten, hielt sie ihnen rasch einen kleinen Gegenstand hin. Zwar konnten die Männer nicht genau erkennen, was es war, aber sie wussten, dass es nicht in ihre Hände gehörte. Statt zum Kaiser brachten sie die Frau ins Gefängnis, wo sie so lange verhört wurde, bis sie verriet, wie sie an den Gegenstand gelangt war. Nachdem ihr Geständnis überprüft worden war, hatte man sie Sphrantzes vorgeführt.
Sphrantzes wickelte nun den Gegenstand aus dem Leinentuch und legte ihn vorsichtig vor seinem Herrscher auf den Tisch.
Der Kaiser war ähnlich verblüfft wie die Wachen einige Tage zuvor. Im Gegensatz zu diesen wusste er jedoch sofort, worum es sich handelte. Es war ein Kelch aus purem Gold, an der Außenseite mit Edelsteinen verziert und von atemberaubender Schönheit. Der Kelch stammte aus der Zeit Kaiser Justinians. Neunhundertsechzehn Jahre zuvor war er als einer von zwei Kelchen angefertigt worden, die sich nur durch die Anordnung und den Schliff ihrer Edelsteine voneinander unterschieden. Einer davon war im Besitz der byzantinischen Kaiser verblieben, während der zweite im Jahr 537 nach Christus zusammen mit anderen Schätzen beim Wiederaufbau der Hagia Sophia in einer verborgenen Kammer im Fundament der Kirche eingemauert worden war.
Der Kelch im Palast, mit dem der Kaiser wohlvertraut war, hatte im Lauf der Jahrhunderte etwas von seinem blendenden Glanz eingebüßt, doch dieser hier strahlte so herrlich, als sei er erst gestern gefertigt worden.
Zunächst hatte niemand Theodoras Geschichte Glauben geschenkt, und man war sicher, dass sie den Kelch einem ihrer reichen Gönner gestohlen haben musste. Viele wussten von der verborgenen Kammer unter der Kirche, doch kaum einer vermochte zu sagen, wo genau sie zu finden war. Zudem lag sie unzugänglich unter Grundsteinen, die so groß und schwer waren wie die der Cheopspyramide. Es galt gemeinhin als unmöglich, ohne großen bautechnischen Aufwand in sie hineinzugelangen.
Vor vier Tagen hatte der Kaiser jedoch befohlen, die kostbaren Schätze der Stadt zu bergen, damit sie im Fall der Eroberung Konstantinopels nicht dem Feind in die Hände fielen. Was natürlich eine reine Verzweiflungstat war, denn der Kaiser wusste nur zu gut, dass die Türken alle Wege hinaus aus der Stadt abgeschnitten hatten und er unmöglich mit den Schätzen würde fliehen können.
Erst nach drei Tagen ununterbrochener Plackerei war es dreißig Mann gelungen, sich in die verborgene Kammer vorzuarbeiten. In der Mitte des Raums hatte ein schwerer, steinerner Sarkophag gestanden, verschlossen mit zwölf dicken Bandeisen. Sie durchzusägen hatte fast einen weiteren Tag gedauert. Schließlich konnten fünf Männer unter strenger Aufsicht zahlreicher Wachen den Deckel abheben.
Was die Anwesenden jedoch mehr erstaunte als der Anblick der seit tausend Jahren verschlossenen Reliquien und Schätze, war das halbe Bündel Trauben, das obenauf thronte.
Theodora hatte zu Protokoll gegeben, fünf Tage zuvor Trauben im Sarkophag hinterlassen zu haben, von denen alle bis auf sieben gegessen waren.
Die Arbeiter verglichen den Inhalt des Sarkophags mit der Liste der Gegenstände, die auf einer Kupferplatte im Inneren des Sargdeckels eingeprägt war. Einzig der Kelch fehlte. Hätte Theodora den Kelch nicht bereits präsentiert und seine Herkunft bezeugt, hätten alle Anwesenden mit ihrem Leben für den Verlust bezahlt, und wenn sie noch so sehr beschworen hätten, dass Kammer und Sarkophag bei ihrer Ankunft intakt gewesen seien.
»Wie bist du an diesen Kelch gekommen?«, fragte der Kaiser sie.
Theodora zitterte noch stärker als zuvor. Offenbar erfüllten sie ihre Zauberkräfte nicht mit Selbstvertrauen. Mit angstgeweiteten Augen starrte sie den Kaiser an. »Diese Orte … sind für mich …« Sie stammelte und schien um das passende Wort zu ringen. »… offen.«
»Beweise es mir. Hole etwas aus einem verschlossenen Behälter.«
Entsetzt schüttelte sie den Kopf und sah Sphrantzes Hilfe suchend an.
»Sie behauptet, dass sie ihre magischen Kräfte nur an einem bestimmten Ort entfalten kann, den sie jedoch nicht verraten darf. Und falls ihr jemand dorthin folgen sollte, wäre der Zauber für immer gebrochen.«
Theodora nickte bekräftigend.
Der Kaiser schnaubte verächtlich. »Eine wie die hätte man in Spanien längst auf dem Scheiterhaufen verbrannt.«
Theodora sank zu Boden und kauerte sich zusammen wie ein Kind.
»Weißt du, wie man jemanden tötet?«, hakte der Kaiser nach.
Unfähig zu sprechen, hockte sie bloß zitternd da, und Sphrantzes musste ihr gut zureden, bis sie schließlich bejahte.
»Gut«, sagte der Kaiser. »Prüfe sie.«
Sphrantzes führte Theodora eine lange Treppe hinab. Auf jedem Absatz flackerten Fackeln, unter denen jeweils zwei Wachen postiert waren. Der schwache Lichtschein wurde von ihren Rüstungen reflektiert und tanzte in unruhigen Mustern über die Wände.
Schließlich erreichten sie ein dunkles Kellerverlies, in dem das Eis für die Kühlung des Palasts im Sommer aufbewahrt wurde. Theodora zog den Umhang fester um sich.
Doch im Moment lagerte hier kein Eis. Stattdessen hockte ein Gefangener unter einer Fackel in der Ecke, seiner Kleidung nach zu urteilen ein anatolischer Offizier. Wie ein zorniger Wolf starrte er Theodora und Sphrantzes durch die Gitterstäbe an.
»Siehst du diesen Mann?«, fragte Sphrantzes.
Sie nickte.
Er reichte ihr einen Sack aus Lammfell. »Du kannst jetzt gehen. Wir erwarten dich bis zum Morgengrauen mit seinem Kopf zurück.«
Theodora zog einen Krummsäbel heraus, der im Fackelschein wie eine silberne Mondsichel schimmerte, und gab ihn Sphrantzes zurück. »Den brauche ich nicht.«
Anschließend stieg sie lautlos die Treppe hinauf. Jedes Mal, wenn sie kurz im Licht der Fackeln auftauchte, schien sie eine neue Gestalt anzunehmen – die einer Frau oder die einer Katze –, bis sie schließlich außer Sicht war.
Sphrantzes wandte sich an eine der Wachen. »Holt Verstärkung«, sagte er und deutete auf den Gefangenen. »Lasst ihn keine Sekunde aus den Augen.«
Nachdem die Wache gegangen war, winkte er aus der Dunkelheit einen Mann zu sich heran, der in eine schwarze Mönchskutte gehüllt war. »Halte Abstand«, sagte Sphrantzes. »Besser, du verlierst sie aus den Augen, als dass sie dich bemerkt.«
Der Mönch nickte und ging genauso lautlos wie zuvor Theodora die Treppe hinauf.
Konstantin XI. schlief in dieser Nacht nicht besser als in all den anderen Nächten seit Beginn der Belagerung. Sobald er einschlief, schreckten ihn die Erschütterungen durch den Beschuss des Feindes wieder auf. Noch vor Sonnenaufgang ging er in seine Bibliothek, wo Sphrantzes ihn bereits erwartete. Die Hexe hatte er schon wieder vergessen. Im Unterschied zu seinem Vater Manuel II. und seinem älteren Bruder Johannes VIII. war er ein praktisch denkender Mensch und wusste, dass diejenigen, die ihr Heil in Wundern suchten, allzu oft nur ihr eigenes frühzeitiges Ende heraufbeschworen.
Sphrantzes winkte in Richtung Tür, und Theodora schlich herein. Die Hand, in der sie den Lammfellsack hielt, zitterte. Sofort erkannte der Kaiser, dass er seine Zeit verschwendet hatte. Der Sack war weder ausgebeult noch sickerte Blut aus ihm. Ein abgeschlagener Kopf befand sich sicher nicht darin. Doch Sphrantzes’ Gesicht verriet keinerlei Enttäuschung. Er wirkte eher verstört, wie ein Schlafwandler.
»Sie bringt nicht das, was wir von ihr wollten, oder?«, fragte Konstantin.
Wortlos nahm Sphrantzes Theodora den Sack aus der Hand, legte ihn vor dem Kaiser auf den Tisch und öffnete ihn. Er starrte seinen Herrscher an wie einen Geist. »Nein, Majestät, aber beinahe.«
Konstantin XI. warf einen Blick in den Sack, in dem etwas Gräuliches, Schwammiges lag, das wie alter Ziegentalg aussah. Sphrantzes reichte ihm den Kandelaber.
»Es ist das Gehirn des Anatoliers.«
»Sie hat ihm den Schädel gespalten?« Konstantin sah Theodora an, die sich wie ein ängstliches Mäuschen in ihrem Umhang verbarg.
»Nein, der Körper des Gefangenen war äußerlich unversehrt. Ich habe ihn von zwanzig Mann bewachen lassen, immer fünf gleichzeitig, und auch die Wachen an der Tür waren besonders aufmerksam, keine Mücke wäre da hineingekommen.« Sphrantzes zuckte zusammen, als fürchtete er sich vor seinen Erinnerungen.
Der Kaiser bedeutete ihm mit einem Nicken, er solle fortfahren.
»Zwei Stunden nachdem sie gegangen war, wand sich der Gefangene plötzlich und fiel tot um. Unter den Zeugen waren ein griechischer Arzt und Veteranen aus vielen Schlachten, doch nie hatten sie jemanden so sterben sehen. Eine Stunde später kam sie zurück und zeigte ihnen den Sack. Daraufhin öffnete der griechische Arzt den Schädel des Toten. Das Gehirn fehlte.«
Konstantin sah sich den Inhalt des Beutels genauer an. Ein Gehirn, zweifellos, vollständig und ohne erkennbare Schäden. Das empfindliche Organ schien mit großer Sorgfalt entfernt worden zu sein. Der Kaiser betrachtete Theodoras Hände und stellte sich vor, wie sie die schlanken Finger nach einem Pilz im Gras ausstreckte oder eine Blüte von einem Zweig pflückte …
Er hob den Blick von dem Beutel und starrte die Wand an, als sähe er dahinter etwas am Horizont aufsteigen. Schon wieder erbebte der Palast unter der Wucht eines Treffers, doch zum ersten Mal spürte der Kaiser nicht die Erschütterung.
Wenn es tatsächlich Wunder gibt, dann ist ihre Zeit jetzt gekommen.
Konstantinopel befand sich in einer verzweifelten Lage, aber es bestand noch kein Grund, die Hoffnung aufzugeben. In den fünf Wochen voller blutiger Gefechte hatte auch der Feind große Verluste hinnehmen müssen. Mancherorts türmten sich die Leichen türkischer Soldaten haushoch, und die Angreifer waren ebenso erschöpft wie die Verteidiger. Vor wenigen Tagen hatte eine tapfere Flotte Genueser die Blockade am Bosporus durchbrochen, war ins Goldene Horn vorgedrungen und hatte die belagerte Stadt mit wertvollen Vorräten und Hilfsmitteln versorgt. Alle glaubten, dass sie nur die Vorhut einer größeren Armee waren, die das christliche Abendland zu ihrer Unterstützung schickte.
Im Heerlager der Osmanen herrschte Kriegsmüdigkeit, und von den Kommandeuren hätten viele gern das byzantinische Waffenstillstandsangebot angenommen und den Rückzug angetreten. Dass sie weiter ausharrten, lag nur an einer Person.
Jener Mann, der fließend Latein sprach, in den Künsten und der Wissenschaft bewandert und noch dazu ein versierter Krieger war, hatte ohne mit der Wimper zu zucken seinen eigenen Bruder in einer Badewanne ertränkt, um sich den Thron zu sichern. Und er hatte vor den Augen seiner Truppen ein schönes Sklavenmädchen enthaupten lassen, um zu demonstrieren, dass er sich nicht von Fleischeslust ablenken ließ. Dieser Mann war die Achse, um die sich die riesige, brutale osmanische Kriegsmaschinerie drehte. Wenn er nicht mehr war, würde ihre Einheit auseinanderbrechen.
Vielleicht ist ja wirklich ein Wunder möglich.
»Warum willst du das tun?«, fragte Konstantin XI., den Blick noch immer fest auf die Wand gerichtet.
»Ich möchte eine Heilige werden.« Theodora hatte offenbar nur auf diese Frage gewartet.
Konstantin nickte. Das schien ein glaubwürdiger Grund zu sein. Mit Geld oder Kostbarkeiten konnte man diese Frau nicht reizen. Da kein Schloss zu kompliziert und kein Gewölbe tief genug war, um sie aufzuhalten, konnte sie sich einfach nehmen, was sie wollte. Doch natürlich würde es einer Prostituierten gefallen, eine Heilige zu sein.
»Bist du eine Nachfahrin der Kreuzritter?«
»Ja, Euer Majestät«, erwiderte sie und fügte vorsorglich hinzu: »Aber keiner aus meiner Familie hat am Vierten Kreuzzug teilgenommen.«
Der Kaiser legte Theodora eine Hand auf den Kopf, und sie sank langsam auf die Knie.
»Geh, mein Kind. Wenn du Mehmed II. tötest, wirst du Konstantinopels Erlöserin sein und bis in alle Ewigkeit verehrt werden, als Heilige in einer Heiligen Stadt.«
Als der Abend dämmerte, ging Sphrantzes mit Theodora zur Stadtmauer und führte sie zum St.-Romanus-Tor hinaus. Der Sand unmittelbar vor der Befestigungsanlage war schwarz vom Blut der Gefallenen. Überall lagen Leichen verstreut, als wären sie vom Himmel herabgeregnet. In einiger Entfernung trieb der weiße Rauch aus den gerade abgefeuerten Riesenkanonen über das Schlachtfeld. Er war das Einzige, was dort lebendig wirkte. Dahinter erstreckte sich das Lager der Osmanen, so weit das Auge reichte, ein dichter Wald aus Flaggen, die unter dem bleifarbenen Himmel in der feuchten Meeresbrise flatterten.
In der anderen Richtung lagen die osmanischen Kriegsschiffe. Von Weitem sahen sie aus wie schwarze Eisennägel, die dicht an dicht ins blaue Meer genagelt den Seezugang bewachten.
Theodora schloss vor diesem Anblick die Augen. Das ist mein Schlachtfeld und mein Krieg. Erinnerungen an die Legenden ihrer Kindheit und die unzähligen Geschichten ihres Vaters über ihre Vorfahren tauchten vor ihr auf: In Europa, auf der anderen Seite des Meeres, hatte sich auf ein Dorf in der Provence eines Tages eine Wolke herabgesenkt. Ein Heer von Kindern marschierte aus der Wolke heraus, mit roten Kreuzen auf der Rüstung und angeführt von einem Engel. Ihr Urahn, der aus diesem Dorf stammte, folgte ihrem Ruf und wurde ein Streiter für Gott im Heiligen Land. Schnell stieg er zu einem Tempelritter auf. Später kam er nach Konstantinopel, wo er sich in eine schöne Frau verliebte, die ebenfalls eine Heilige Kriegerin war. Aus ihrer beider Liebe, so Theodoras Vater, sei ihre glorreiche Familie hervorgegangen …
Erst als Erwachsene erfuhr sie die Wahrheit. Im Grunde stimmte die Geschichte. Ihr Urahn hatte tatsächlich am Kinderkreuzzug teilgenommen, jedoch vor allem, weil er hoffte, nach den Verheerungen der Pest seinen hungrigen Magen füllen zu können. Das Schiff, auf dem er gefahren war, hatte in Ägypten angelegt, wo er zusammen mit Zehntausenden von Kindern als Sklave verkauft wurde. Nach vielen Jahren der Knechtschaft gelang ihm die Flucht, die ihn bis nach Konstantinopel führte, wo er tatsächlich einen weiblichen Tempelritter traf. Sie war um einiges älter als er, doch ihr Schicksal war nicht besser als seines. Das Byzantinische Reich hatte im Kampf gegen die Ungläubigen auf die besten Krieger der Christenheit gehofft. Stattdessen war jedoch eine Armee halb verhungerter Frauen zu ihnen gekommen. Der Hof von Byzanz verweigerte diesen zweifelhaften Heiligen Kriegerinnen die Unterstützung, und die Frauen mussten sich in der Folge als Prostituierte durchschlagen. Darunter auch Theodoras Urgroßmutter …
Über hundert Jahre lang war ihre glorreiche Familie so arm gewesen, dass sie kaum überleben konnte. Die Generation ihres Vaters war noch schlechter dran als die ihres Urgroßvaters. Die hungrige Theodora musste sich mit dem gleichen Beruf über Wasser halten wie einst ihre selige Urahnin, doch als ihr Vater davon erfuhr, drohte er sie umzubringen, sollte er sie noch einmal dabei erwischen … es sei denn, sie bringe ihre Kunden mit nach Hause, wo dann er den Preis verhandeln und das Geld einstecken könne. Verbittert kehrte sie ihm danach den Rücken und ging auf eigene Faust ihrer Tätigkeit nach. Die Geschäfte liefen gut und führten sie bis nach Jerusalem und Trapezunt und einmal sogar mit dem Schiff bis nach Venedig. Sie hatte genug zu essen und kleidete sich gut, doch sie wusste, dass sie nur ein kleines Sumpfgewächs im Morast war, über das die Menschen hinwegtrampelten.
Bis eines Tages ein Wunder geschah.
Anders als die angebliche Jungfrau Johanna von Orléans, die zwanzig Jahre zuvor von Gott nur ein Schwert erhalten hatte, um für ihn zu kämpfen, hatte der Herr sie mit etwas ausgestattet, das sie zur heiligsten Frau nach der Jungfrau Maria machen würde.
»Sieh, dort liegt das Lager Mehmeds II.«
Theodora warf nur einen kurzen Blick in die Richtung und nickte.
Sphrantzes gab ihr einen Beutel aus Ziegenleder. »Hier sind drei Bilder, die ihn von verschiedenen Seiten und unterschiedlich gekleidet zeigen. Außerdem ein Messer. Diesmal wollen wir nicht nur sein Gehirn, sondern den ganzen Kopf. Am besten wartest du bis zum Einbruch der Dunkelheit. Vorher wird er nicht in seinem Lager sein.«
Theodora nahm den Beutel. »Ich hoffe, dass Ihr Euch an meine Warnung erinnert.«
»Keine Sorge.«
Folgt mir nicht. Betretet nicht den Ort, zu dem ich gehen muss. Sonst wird der Zauber auf immer unwirksam sein.
Der als Mönch verkleidete Spion, den Sphrantzes auf sie angesetzt hatte, war ihr vorsichtig und trotz ihrer absichtlich verschlungenen Wege bis in die Vorstadt Blachernae gefolgt, wo die Bombardierung durch die Osmanen am heftigsten war.
Er hatte beobachtet, wie sie die Ruinen eines Minaretts betrat, das einmal zu einer Moschee gehört hatte. Als Konstantin die Zerstörung der Moscheen angeordnet hatte, war dieser Turm verschont geblieben. Seitdem während der letzten Epidemie ein paar Pestkranke in dem Bauwerk untergeschlüpft und gestorben waren, wollte ihm niemand zu nahe kommen. Kurz nach Beginn der Belagerung hatte ein verirrter Kanonenschuss die obere Hälfte des Minaretts weggerissen.
Der Spion hatte sich an Sphrantzes’ Weisung gehalten und das Minarett nicht betreten. Doch er hatte mit zwei Soldaten gesprochen, die vor dem verheerenden Treffer in dem Gebäude gewesen waren. Die erklärten ihm, dass sie ursprünglich einen Wachposten auf dem Turm hätten einrichten wollen, doch er sei zu niedrig und damit als Ausguck ungeeignet. Das Innere sei abgesehen von den Skeletten der dort verendeten Pestkranken völlig leer gewesen.
Diesmal schickte Sphrantzes ihr niemand nach. Er sah Theodora hinterher, wie sie sich ihren Weg durch die Soldaten bahnte, die sich auf der Stadtmauer drängten. Mit ihrem hellen Umhang stach sie zwischen den schmutzigen, blutverkrusteten Rüstungen der Soldaten heraus. Doch keiner der erschöpften Männer beachtete sie, während sie in zunehmender Dunkelheit von der Mauer hinabstieg und offensichtlich direkt nach Blachernae ging.
Konstantin XI. starrte auf den trocknenden Wasserfleck auf dem Boden, der ihm wie ein Sinnbild für seine schwindende Hoffnung erschien.
Er stammte von einem Dutzend Spione, die in der vergangenen Woche in den roten Uniformen der Osmanischen Armee und mit Turbanen auf den Köpfen in einem winzigen Segelboot die Blockade durchbrochen hatten. Sie hatten den Auftrag gehabt, die angeblich herannahende europäische Flotte in Empfang zu nehmen und mit den nötigen Informationen über das feindliche Lager zu versorgen. Doch das Ägäische Meer war leer geblieben, und sie hatten nicht mal einen Schatten von den erwarteten Rettern zu Gesicht bekommen. Enttäuscht waren die Spione wieder umgekehrt und hatten sich erneut durch die Blockade gemogelt, um dem Kaiser die erschütternde Nachricht zu überbringen. Damit war Konstantins Hoffnung auf Unterstützung aus Europa endgültig zunichtegemacht worden. Nachdem die heilige Stadt dem Ansturm der Muslime viele Jahrhunderte lang getrotzt hatte, waren die Fürsten und Könige der Christenheit nun übereingekommen, Konstantinopel den Ungläubigen zu überlassen.
Von außerhalb des Palasts drangen angsterfüllte Rufe an sein Ohr. Die Wachen berichteten von einer Mondfinsternis. Das war ein böses Omen, denn es hieß: Solange der Mond scheint, wird Konstantinopel nicht untergehen.
Durch eine schmale Fensterscharte beobachtete der Kaiser, wie der Mond im Schatten verschwand wie in einem himmlischen Grab. Eine innere Stimme sagte ihm, dass Theodora nicht zurückkehren würde und er den abgeschlagenen Kopf des Feindes niemals zu Gesicht bekommen sollte.
Ein Tag und eine Nacht verstrichen ohne ein Lebenszeichen von Theodora.
Sphrantzes und seine Leute zügelten vor dem Minarett in Blachernae die Pferde und stiegen ab. Sie trauten ihren Augen nicht: Im kalten weißen Schein des aufsteigenden Monds ragte die Spitze des Minaretts vollkommen unversehrt in den Nachthimmel. Der als Mönch verkleidete Spion schwor, dass dem Turm bei seinem letzten Besuch die Spitze noch gefehlt habe. Zahlreiche weitere Soldaten und Offiziere, die mit der Gegend vertraut waren, bestätigten dies.
Doch Sphrantzes war nicht zu überzeugen und starrte den Mann wütend an, sicher, dass er trotz all der Zeugen log. Schließlich ließ das intakte Minarett selbst keinen anderen Schluss zu. Er verzichtete jedoch darauf, den Späher zu bestrafen. Da die Stadt sicher bald fiel, würde ohnehin niemand dem Zorn des Eroberers entkommen.
Einer der Soldaten wusste genau, dass die Spitze des Minaretts nicht von einem Kanoneneinschlag zerstört worden war. Rund zwei Wochen zuvor hatte er mit eigenen Augen gesehen, dass die obere Hälfte des Turms fehlte, doch weder hatte es am Vorabend Angriffe gegeben, noch fanden sich in der Nähe des Bauwerks Trümmer. Zwei weitere Soldaten hätten das bezeugen können, wenn sie nicht mittlerweile in der Schlacht gefallen wären. Doch angesichts von Sphrantzes’ schlechter Laune behielt der Mann diese Information für sich.
Sphrantzes und sein Gefolge, darunter auch der vermeintlich verlogene Späher, betraten das Minarett. Als Erstes stießen sie auf die Überreste der Pesttoten, die streunende Hunde überall in der Ruine verteilt hatten. Doch nirgends fanden sie eine Spur von lebenden Menschen.
Sie stiegen die Treppe hinauf. Im flackernden Licht ihrer Fackeln entdeckten sie Theodora, die zusammengekauert unter einem Fenster hockte. Sie schien zu schlafen, doch ihre Augen waren nur halb geschlossen und spiegelten den Schein der Fackeln wider. Ihre Kleider waren zerrissen und schmutzig und ihr Haar wirr. Das Gesicht war von blutigen Kratzern verunziert, die sie sich offenbar selbst zugefügt hatte. Sphrantzes sah sich um. In diesem oberen, kegelförmigen Teil des Minaretts war alles von einer dicken, nur von wenigen Fußspuren durchbrochenen Staubschicht bedeckt, gerade so, als wäre auch Theodora eben erst angekommen.
Sie erwachte und zog sich mit tastenden Händen an der Wand hoch. Im Mondlicht, das durch das Fenster hereinfiel, schimmerte ihr wirres Haar wie ein silbriger Heiligenschein. Mit starrem Blick versuchte sie angestrengt, zu sich zu kommen, doch dann schloss sie die Augen wieder, als wollte sie weiter in einem Traum verweilen.
»Was wird das hier?«, herrschte Sphrantzes sie an.
»Herr, ich … ich kann dort nicht hingehen.«
»Wohin?«
Sie hielt die Augen geschlossen, als wollte sie ihre Erinnerungen nicht loslassen, wie ein Kind, das sein Spielzeug umklammert hält. »Groß ist es dort, gut und angenehm. Hier dagegen …« Sie riss die Augen auf und blickte sich erschrocken um. »Hier ist es wie in einem Sarg, auch draußen … ist es eng wie in einem Sarg. Ich möchte so gern dorthin!«
»Und was ist mit deinem Auftrag?«, fragte Sphrantzes.
»Wartet noch, Herr.« Theodora bekreuzigte sich. »Wartet!«
Sphrantzes deutete zum Fenster hinaus. »Worauf sollen wir denn noch warten?«
Von draußen wogte der Lärm zu ihnen herein. Wer genau hinhörte, konnte zwei Geräuschquellen unterscheiden.
Eine lag außerhalb der Stadtmauern. Mehmed II. hatte beschlossen, am kommenden Tag den finalen Angriff gegen die Stadt zu befehlen. In diesem Moment ritt der junge Sultan gerade durch das osmanische Heerlager und versprach seinen Soldaten, dass es ihm persönlich nur um Konstantinopel gehe – sämtliche Schätze und Frauen der Stadt sollten dagegen ihnen gehören. Nach dem Fall der Stadt würden sie drei Tage haben, um sie nach Belieben zu plündern. Die Soldaten johlten bei den Worten des Sultans, und ihre Freudenschreie wurden von Pauken und Trompeten untermalt. Dieser fröhliche Lärm legte sich zusammen mit den Funken und dem Rauch ihrer Lagerfeuer wie eine todbringende Wolke über Konstantinopel.
Die Töne, die aus der Stadt drangen, klangen dagegen traurig. Sämtliche Einwohner waren einer Prozession unter der Leitung des Erzbischofs gefolgt und versammelten sich nun in der Hagia Sophia zu einer letzten Messe. Das hatte es in der Geschichte der Christenheit noch nie gegeben, und es würde auch einmalig bleiben: Unter dem Klang feierlicher Hymnen versammelten sich im schummrigen Licht der Kerzen der Kaiser von Byzanz, der Patriarch von Konstantinopel, orthodoxe und römisch-katholische Christen, Soldaten in voller Rüstung, Händler und Seefahrer aus Genua und Venedig und sämtliche Bevölkerungsschichten Konstantinopels vor Gott, um sich auf die letzte Schlacht ihres Lebens vorzubereiten.
Sphrantzes wusste, dass sein Plan gescheitert war. Vielleicht war Theodora nichts weiter als eine geschickte Lügnerin, die über keinerlei magische Kräfte verfügte. Viel schlimmer wäre es jedoch, wenn sie tatsächlich über magische Kräfte verfügte und sie in den Dienst Mehmeds II. gestellt hatte.
Was hatte Byzanz, das am Rande des Ruins stand, ihr schon zu bieten? Dass der Kaiser sie tatsächlich zu einer Heiligen machen würde, war unwahrscheinlich, denn weder Rom noch Konstantinopel würden einer Hexe und Hure diese Ehre zuteilwerden lassen. Vermutlich hatte sie es mittlerweile auf zwei neue Opfer abgesehen: den Kaiser und ihn selbst.
Genau wie zuvor Urban. Der ungarische Ingenieur hatte zuerst den Kaiser aufgesucht und ihm seine Pläne für den Bau besonders schlagkräftiger Kanonen unterbreitet. Doch Konstantin XI. hatte nicht genug Geld für seine Dienste, und erst recht hatte er es sich nicht leisten können, die riesigen Kanonen zu gießen. Sofort war Urban mit seinem Vorschlag zu Mehmed II. gegangen. Die täglichen Bombardements der Stadt waren ein stetes Zeugnis dieses Verrats.
Sphrantzes gab dem Späher einen Wink, woraufhin dieser sein Schwert zog und Theodora in die Brust stieß. Die Klinge durchbohrte ihren Körper und blieb hinter ihr in einer Mauerspalte stecken. Vergeblich versuchte der Mann, die Waffe wieder herauszuziehen, doch sie bewegte sich keinen Millimeter. Da Theodoras Hände das Heft des Schwerts umklammert hielten und er sie nicht berühren wollte, gab er es schließlich auf, und Sphrantzes eilte mit seinen Männern davon.
Theodora hatte indes keinen Laut von sich gegeben. Während ihr Kopf auf die Brust sank, glitt ihr wirres Haar aus dem Mondlichtstrahl heraus, und der silberne Heiligenschein verschwand in der Dunkelheit. Stattdessen beleuchtete der Mond im finsteren Minarett nun ein kleines Stück Wand, über die ein feiner Blutstrom wie eine schwarze Schlange hinabmäanderte.
Kurz vor der großen Schlacht verstummte der Lärm innerhalb und außerhalb der Stadt. Das Byzantinische Reich an der Grenze zwischen Europa und Asien, wo Land und Meer aufeinandertrafen, erlebte seine letzte Morgendämmerung.
Im Obergeschoss des Minaretts starb die mit einem Schwert an die Wand gespießte Hexe. Gut möglich, dass sie die einzige echte Magierin in der Geschichte der Menschheit gewesen war, doch leider war zehn Stunden zuvor das ohnehin kurze Zeitalter der irdischen Magie zu Ende gegangen. Begonnen hatte es am 3. Mai 1453, um vier Uhr nachmittags, als das Fragment höherer Dimension zum ersten Mal mit der Erde in Berührung gekommen war, und geendet hatte es am Abend des 28. Mai 1453 um 21 Uhr, als es die Erde wieder verließ. Nach fünfundzwanzig Tagen und fünf Stunden war die Erde in ihren gewöhnlichen Orbit zurückgekehrt.
Am Abend des 29. Mai fiel Konstantinopel.
Als die blutige Schlacht sich ihrem unausweichlichen Ende näherte, schrie Konstantin XI. angesichts der osmanischen Truppen, die über die Stadt herfielen: »So wird sich denn kein Christ finden, der mir den Kopf abschlägt?« Dann riss er sich die purpurfarbene Robe vom Leib, zog sein Schwert und ritt gegen den Feind an. Seine silberne Rüstung leuchtete kurz auf wie ein Stück Aluminiumfolie im Schwefelsäurebad, bevor er im Nichts verschwand.
Die historische Bedeutung des Falls von Konstantinopel zeigte sich erst viele Jahre später. Zuallererst sah man darin das endgültige Ende des Römischen Reichs. Byzanz war ein Wagenanhänger, den das alte Rom noch tausend Jahre hinter sich hergezogen hatte und der trotz seiner vorübergehenden Glorie am Ende in der Sonne verdunstete wie ein Wassertropfen. Die alten Römer hatten einst zu ihrer Zeit pfeifend und trällernd in ihren luxuriösen Bädern gesessen und geglaubt, ihr Reich wäre so beständig wie der Marmor der großzügigen Becken, in denen sie sich treiben ließen.
Heute weiß man, dass kein Festmahl ewig währt. Alles ist endlich.
Jahr 1 der Krise
Faktor »Leben«
Yang Dong wollte sich retten, doch sie wusste, dass es wenig Hoffnung gab.
Sie stand auf dem Balkon im obersten Stockwerk des Kontrollzentrums und sah auf den bereits stillgelegten Teilchenbeschleuniger hinunter. Aus dieser Höhe konnte sie gerade so die ganze Anlage mit ihren zwanzig Kilometern Umfang überblicken. Die Röhre des Beschleunigers war nicht, wie sonst üblich, als Untergrundtunnel angelegt worden, sondern überirdisch in einer Pipeline aus Beton. Eben ging die Sonne hinter der ringförmigen Konstruktion unter. Der Anblick hatte etwas Endgültiges.
Ein Endpunkt ist erreicht. Welcher? Hoffentlich markiert er nicht mehr als das Ende der Physik.
Früher war für Yang Dong eines gewiss gewesen: Mochten das Leben und die Welt noch so hässlich sein, an ihren mikroskopischen und makroskopischen Ausläufern war alles harmonisch und perfekt. Das tägliche Leben war nur der Schaum auf dem Meer der Vollkommenheit. Doch nun offenbarte sich ihr das tägliche Leben als eine schöne Muschel, die furchtbar chaotische und hässliche Mikrowelten einschloss und von scheußlichen Makrowelten umgeben war.
Ich habe Angst.
Wenn sie nur aufhören könnte, sich über derlei Dinge den Kopf zu zerbrechen. Sie könnte ja auch etwas anderes machen als Physik. Sie könnte heiraten, Kinder bekommen und ein friedliches, zufriedenes Leben führen wie so viele andere Frauen. Allerdings wäre ein solches Leben für Yang Dong nur ein halbes Leben.
Und dann war da noch die Sache mit ihrer Mutter, Ye Wenjie. Rein zufällig hatte sie auf dem Computer ihrer Mutter auf mehreren Ebenen verschlüsselte Nachrichten entdeckt, was Yang Dongs erstauntes Interesse geweckt hatte.
Wie viele ältere Leute war ihre Mutter mit dem Internet und den Speichermechanismen ihres Computers nicht besonders vertraut. Daher hatte sie die Nachrichten einfach nur gelöscht, statt sie digital zu schreddern. Ihr war nicht bewusst, dass die Daten trotz der Neuformatierung der Festplatte leicht wieder abrufbar waren. Zum ersten Mal im Leben hinterging Yang Dong ihre Mutter und stellte die Dateien aus den gelöschten Nachrichten wieder her. Die Informationen waren so umfangreich, dass sie mehrere Tage brauchte, um sie zu lesen. In diesen Tagen erfuhr sie alles über Trisolaris und das Geheimnis, das Ye Wenjie und die Außerirdischen teilten.
Yang Dong war fassungslos. Die Mutter, auf die sie sich ihr ganzes Leben lang verlassen hatte, war plötzlich eine Fremde, mehr noch: ein Mensch, wie er nach ihrer Vorstellung auf der Welt gar nicht existieren konnte. Sie zur Rede zu stellen war undenkbar. Ausgeschlossen. Sobald sie sie danach fragte, würde ihre Mutter für immer zu einer Fremden werden, und die Frau, die sie großgezogen hatte, wäre unwiederbringlich verloren. Lieber der Mutter ihr Geheimnis lassen, so tun, als ob nichts geschehen wäre, und weiterleben wie bisher. Auch wenn es natürlich bloß noch ein halbes Leben sein würde.
Aber was war so schlecht daran, ein halbes Leben zu leben? Soweit sie es beurteilen konnte, taten das viele um sie herum. Solange man sich anzupassen wusste und Erinnerungen verdrängte, konnte man mit einem halben Leben ganz zufrieden, sogar glücklich sein.
Doch mit dem Ende der Physik und dem Geheimnis ihrer Mutter hatte Yang Dong gleich zwei halbe Leben verloren und damit zusammengenommen ein ganzes. Was blieb ihr jetzt noch?
Yang Dong lehnte sich über die Brüstung und starrte in den Abgrund unter ihr, verängstigt und verlockt zugleich. Als sie spürte, wie das Geländer unter ihrem Gewicht leicht nachgab, zuckte sie zusammen wie von einem elektrischen Schlag getroffen und kehrte verängstigt in die Computerhalle zurück.
Dort standen die Terminals für den gigantischen Hauptrechner, der die vom Teilchenbeschleuniger erzeugten Daten auswertete. Vor ein paar Tagen waren sämtliche Terminals heruntergefahren worden. Jetzt waren ein paar wenige eingeschaltet, was Yang Dong als tröstlich empfand, selbst wenn es eindeutig nichts mehr mit dem Teilchenbeschleuniger zu tun hatte. Der gigantische Rechner wurde jetzt für andere Projekte verwendet.
Nur noch ein weiterer Mensch befand sich im Raum, ein junger Mann, der eine Brille mit einem auffälligen, leuchtend grünen Gestell trug. Yang Dong erklärte ihm, dass sie nur ein paar persönliche Gegenstände abholen wolle. Doch als sie ihren Namen nannte, erhob sich Grünbrille aufgeregt von seinem Platz und begann, ihr das aktuelle Projekt am Großrechner zu erläutern.
Es ging um ein mathematisches Modell der Erde, mit dem die Entwicklungsgeschichte der Planetenoberfläche von der Vergangenheit bis in die Zukunft simuliert werden sollte. Anders als bei vergleichbaren Studien zuvor wurden in diesem Modell die Daten biologischer, geologischer, astronomischer, atmosphärischer und ozeanischer Elemente miteinander kombiniert. Grünbrille lenkte ihre Aufmerksamkeit auf ein paar großformatige Bildschirme, auf denen anstelle der üblichen langen Zahlenreihen und Kurvendiagramme grellbunte Bilder zu sehen waren, bei denen es sich offenbar um Satellitenaufnahmen der Ozeane und Kontinente handelte. Der junge Mann vergrößerte die Bilder so lange per Mausklick, bis sie Flüsse und Wälder erkennen konnte. Yang Dong war, als wehte ein Hauch von Natur durch diesen Ort, der bisher von abstrakten Zahlen und Theorien dominiert worden war. Sie fühlte sich wie befreit.
Als Grünbrille seinen Vortrag beendet hatte, holte sie ihre Sachen, verabschiedete sich höflich und wandte sich zum Gehen. Sie spürte seine Blicke im Rücken, doch das war sie von Männern gewohnt, und es störte sie nicht. Stattdessen erschienen ihr diese Blicke wie angenehm wärmende Sonnenstrahlen im Winter.
Plötzlich hatte sie das Bedürfnis, mit jemandem zu reden, und so blieb sie stehen und drehte sich zu Grünbrille um. »Glauben Sie an Gott?«
Ihre eigene Frage überraschte sie, aber vor dem Hintergrund der Bilder, die sie eben betrachtet hatten, kam sie ihr nicht unangemessen vor.
Grünbrille war nicht minder verdutzt. Mit offenem Mund starrte er sie an, und es dauerte einen Moment, bis er vorsichtig nachhakte: »An was für eine Art Gott denken Sie dabei?«
»Na, eben Gott.« Schon fühlte sie sich wieder erschöpft. Sie hatte keine Lust, etwas zu erklären.
»Nein.«
Yang Dong deutete auf die großen Monitore. »Aber die physikalischen Parameter, die menschliches Leben ermöglichen, sind extrem unbarmherzig. Nehmen Sie zum Beispiel Wasser, das sich nur in einem sehr kleinen Temperaturbereich verflüssigt. Oder das Universum insgesamt: Wäre der Urknall nur an einer klitzekleinen Stelle anders verlaufen, gäbe es keine schweren Elemente und damit kein Leben. Ist das kein Beweis für Intelligent Design?«
Grünbrille schüttelte den Kopf. »Mit dem Urknall kenne ich mich nicht gut genug aus, doch was die Erdatmosphäre betrifft, muss ich widersprechen. Die Erde hat das Leben hervorgebracht, aber das Leben hat auch die Erde verändert. Unsere gegenwärtigen Umweltbedingungen sind das Ergebnis dieser Interaktion.« Er griff zur Maus und öffnete eine Datei. »Wie wär’s mit einer Simulation?«
Auf dem Monitor erschien eine Konfigurationsschnittstelle, ein Fenster voller Zahlenkolonnen, bei deren Anblick einem schwindlig werden konnte. Er klickte in die obere Ecke, und die Ziffern verschwanden. »Sehen wir uns jetzt mal an, wie sich die Erde entwickelt hätte, wenn ich den Faktor ›Leben‹ deaktiviere. Ich reduziere die Pixel in der Darstellung, damit wir nicht zu viel Zeit mit ihrer Berechnung verlieren.«
Yang Dong warf einen Blick auf den Großrechner, der jetzt mit voller Kapazität lief, ein unglaublicher Energiefresser, der so viel Strom verbrauchte wie eine Kleinstadt. Doch sie sagte Grünbrille nicht, er solle aufhören.
Vor ihren Augen entstand ein neuer Planet. Seine Oberfläche war noch rot glühend wie ein Stück Kohle, das man gerade aus dem Feuer geholt hatte. Die Zeit verstrich in geologischen Epochen, und die heiße Kugel kühlte allmählich ab. Das zeitlupenartige Wechselspiel der Farben und Linien auf ihrer Oberfläche wirkte hypnotisierend. Wenige Minuten später zeigte der Monitor einen orangefarbenen Planeten. Die Simulation war abgeschlossen.
»Die Berechnungen sind sehr grob. Für präzisere bräuchten wir mehr als einen Monat.« Grünbrille vergrößerte die Planetenoberfläche und fuhr mit dem Cursor über die Darstellung. Ausgedehnte Wüstenflächen, eine Gruppe hoher Berge mit seltsamen Formen, eine runde Aushöhlung wie ein Krater.
»Was ist das?«, fragte Yang Dong.
»Die Erde. So würde ihre Oberfläche heute aussehen, wenn es kein Leben gäbe.«
»Aber … wo sind die Meere?«
»Es gibt keine Meere. Auch keine Flüsse. Die gesamte Erdoberfläche ist trocken.«
»Wollen Sie damit sagen, dass es ohne Leben auf der Erde kein Wasser geben würde?«
»Vermutlich wäre die Wirklichkeit noch schlimmer. Das ist, wie gesagt, nur eine grobe Simulation. Aber zumindest zeigt sie, wie viel Einfluss das Leben auf den gegenwärtigen Zustand der Erde hat.«
»Aber …«
»Glauben Sie etwa, das Leben wäre nur eine dünne, weiche und zerbrechliche Schicht auf der Erdoberfläche?«
»Stimmt das denn nicht?«
»Nur, wenn Sie den Zeitfaktor außer Acht lassen. Stellen Sie sich eine Ameisenkolonne vor, die ununterbrochen reiskorngroße Stücke des Tai Shan abtransportiert. Binnen einer Milliarde Jahre würde sie den Berg vollständig abtragen. Solange man dem Leben genügend Zeit lässt, ist es stärker als Stein und Metall und mächtiger als Taifune und Vulkane.«
»Aber die Entstehung von Bergen hängt von geologischen Kräften ab!«
»Nicht unbedingt. Das Leben mag vielleicht nicht in der Lage sein, Berge entstehen zu lassen, aber es kann die Verteilung von Gebirgen verändern. Wenn wir zum Beispiel drei Berge haben, von denen nur zwei mit Vegetation bedeckt sind, dann würde sich der ohne Vegetation durch die Bodenerosion bald verflachen. Mit ›bald‹ meine ich im Verlauf von ein paar Millionen Jahren, was geologisch gesehen nur ein Wimpernschlag ist.«
»Wie sind dann die Meere verschwunden?«
»Dazu müssten wir uns die Aufzeichnungen der Simulation ansehen, das wäre ziemlich aufwendig. Wir können aber davon ausgehen, dass Pflanzen, Tiere und Bakterien eine wichtige Rolle für den gegenwärtigen Zustand unserer Atmosphäre spielen. Ohne Leben wäre sie vollkommen anders und möglicherweise nicht in der Lage, die Erdoberfläche gegen Solarwinde und UV-Strahlen zu schützen. Ergo würden die Ozeane verdunsten, und schon bald sähe es auf der Erde aus wie auf der Venus. Der Wasserdampf würde im Laufe der Zeit ins Universum entweichen. Nach wenigen Milliarden Jahren wäre die Erde staubtrocken.«
Yang Dong starrte schweigend auf die Darstellung der ausgetrockneten orangefarbenen Kugel.
»Daher ist die Erde, auf der wir im Moment leben, eine Heimat, die sich das Leben selbst geschaffen hat. Mit einem Gott hat das nichts zu tun.« Offenbar sehr zufrieden mit seiner Rede machte Grünbrille eine Geste, als wollte er den Monitor umarmen.
Eigentlich war Yang Dong gerade nicht in der Stimmung für derartige Gespräche, doch als Grünbrille bei der Konfiguration das Leben deaktiviert hatte, war ihr plötzlich etwas eingefallen. Und so stellte sie die nächste furchterregende Frage: »Wie sieht es mit dem Universum aus?«
»Dem Universum?«
»Wenn wir ein ähnliches mathematisches Simulationsmodell für das gesamte Universum erstellen und den Faktor Leben aus der Konfiguration herausnehmen würden, wie sähe dann am Ende das Universum aus?«
Grünbrille überlegte kurz. »Es würde genauso aussehen. Als ich eben vom Einfluss des Lebens auf die Umwelt sprach, habe ich mich ausschließlich auf die Erde bezogen. Insgesamt gibt es jedoch so wenig Leben, dass es so gut wie keinen Einfluss auf die Entwicklung des Universums hat.«
Yang Dong wollte etwas sagen, überlegte es sich dann aber anders. Stattdessen rang sie sich ein anerkennendes Lächeln ab und verabschiedete sich ein zweites Mal. Draußen vor dem Gebäude hob sie den Kopf und blickte in den Sternenhimmel.
Aus den geheimen Dokumenten ihrer Mutter wusste sie, dass das Leben gar nicht so selten war. Genau genommen schien das Universum sogar ziemlich überfüllt zu sein.
Wie sehr ist es seit seinem Anbeginn also vom Leben verändert worden?
Die Frage ließ Yang Dong erschaudern.
Nun gab es kein Halten mehr. Sie bemühte sich zwar, nicht mehr weiter nachzudenken und ihren Geist in ein schwarzes Nichts aufzulösen, doch in ihrem Bewusstsein war bereits eine neue Frage aufgetaucht, die sich nicht mehr vertreiben ließ:
Was, wenn die Natur gar nicht natürlichen Ursprungs ist?
Jahr 4 der Krise
Yun Tianming
Bevor der Arzt nach seiner üblichen Krankenvisite das Zimmer wieder verließ, drückte er Yun Tianming noch eine Zeitung in die Hand. Da er nun schon eine ganze Weile im Krankenhaus sei, solle er doch wissen, was in der Welt draußen so vor sich gehe. Da Yun Tianming einen Fernseher im Zimmer hatte, fragte er sich verwundert, worauf der Arzt hinauswollte.
Sein erster Eindruck beim Lesen der Zeitung war, dass Trisolaris und die Erde-Trisolaris-Organisation ETO die Nachrichten nicht mehr so sehr beherrschten wie vor seiner Einlieferung. Immerhin gab es ein paar Artikel, die nichts mit der Krise zu tun hatten. Die Menschheit erwies sich wieder einmal als pragmatisch und befasste sich mehr mit den drängenden Fragen der Gegenwart als mit Ereignissen, die erst in vierhundert Jahren eine Rolle spielen würden.
Das wunderte ihn gar nicht. Er versuchte, sich daran zu erinnern, was vor vierhundert Jahren gewesen war … Damals hatten in China die Ming-Kaiser geherrscht, und Nurhaci musste gerade die Dynastie begründet haben, mit der die Mandschus den Ming bald darauf die Macht entrissen. In Europa ging das Finstere Mittelalter zu Ende. Bis zur Erfindung der Dampfmaschine sollte es noch ein Jahrhundert dauern, und auf die Elektrizität musste die Menschheit noch drei Jahrhunderte warten. Wäre damals einer auf die Idee gekommen, sich Gedanken über das Leben in vierhundert Jahren zu machen, man hätte ihn ausgelacht. Sich über die Zukunft zu sorgen war genauso lächerlich, wie ständig die vermeintlich guten alten Zeiten heraufzubeschwören.
Und er persönlich musste sich angesichts seines körperlichen Zustands nicht einmal mehr über das kommende Jahr Gedanken machen.
Eine der kleineren Schlagzeilen auf der Titelseite erregte allerdings seine Aufmerksamkeit:
Sondersitzung des Dritten Ständigen Ausschusses der Nationalversammlung verabschiedet Sterbehilfegesetz
Yun Tianming war verwirrt. Die Sondersitzung des Ständigen Ausschusses war wegen der Trisolaris-Krise zusammengetreten. Dieses Gesetz schien damit jedoch wenig zu tun zu haben.
War das die Nachricht, auf die mich Dr. Zhang aufmerksam machen wollte?
Ein Hustenanfall zwang ihn dazu, die Zeitung beiseitezulegen, und er versank in einen unruhigen Schlaf.
Am darauffolgenden Tag brachte auch das Fernsehen Berichte und Interviews zum neuen Sterbehilfegesetz, doch das öffentliche Interesse schien nicht sehr groß zu sein.
In dieser Nacht fand Yun Tianming kaum Schlaf. Er hustete und litt unter Atemnot. Ihm war übel von der Chemotherapie, und er fühlte sich geschwächt. Sein Bettnachbar setzte sich zu ihm und hielt ihm den Beatmungsschlauch. Er hieß mit Nachnamen Li, und jeder nannte ihn nur »Lao Li« – den alten Li. Nachdem er sich mit einem Blick vergewissert hatte, dass die anderen beiden Patienten im Krankenzimmer fest schliefen, sagte er: »Yun Tianming, hör mal, ich werde wohl früher gehen.«
»Du wirst entlassen?«
»Nein. Der sanfte Tod.«
Auch später noch würden die Menschen das Wort Sterbehilfe vermeiden, wenn sie sich an dieses Gesetz erinnerten.
Yun Tianming richtete sich auf. »Aber warum denkst du an so etwas? Deine Kinder kümmern sich doch vorbildlich um dich …«
»Genau deshalb habe ich mich dazu entschlossen. Wenn das noch lange so weitergeht, müssen sie meinetwegen ihre Wohnungen verkaufen. Und wozu? Es gibt ja doch keine Heilung für mich. Ich muss an meine Kinder und Enkel denken.«
Lao Li schien bewusst zu werden, wie unsensibel es war, mit ihm über dieses Thema zu reden. Er tätschelte Yun Tianming sanft den Arm, stand auf und kehrte in sein Bett zurück.
Während er auf die tanzenden Schatten starrte, die die schwankenden Bäume auf die Gardinen zeichneten, schlief Yun Tianming endlich ein. Zum ersten Mal seit dem Ausbruch seiner Krankheit hatte er einen friedlichen Traum.
Er saß auf einem kleinen weißen Origami-Boot und trieb ohne Ruder über ruhiges Wasser. Der Himmel war grau und verhangen. Ein kühler Nieselregen fiel, doch anscheinend nicht bis zur Wasseroberfläche, die glatt wie ein Spiegel blieb. Der Himmel und das ebenso graue Wasser verschmolzen miteinander. Es gab weder einen Horizont noch irgendein Ufer …
Als er am Morgen erwachte, wunderte sich Yun Tianming, wie sicher er in seinem Traum gewesen war, dass es an diesem Ort ewig nieselte, dass die Wasseroberfläche immer glatt und der Himmel stets grau und verhangen sein würden.
Das Krankenhauspersonal bereitete sich darauf vor, die Prozedur durchzuführen, um die Lao Li gebeten hatte. Nach einigem Hin und Her hatten sich die Medien auf den Begriff »durchführen« geeinigt. »Vollziehen« war eindeutig unangemessen, und »ausführen« klang ebenfalls nicht richtig. »Vollenden« wiederum unterstellte, dass der Tod unausweichlich wäre, was so nicht ganz stimmte.
Dr. Zhang fragte Yun Tianming, ob er sich zutraue, der »Durchführung« von Lao Lis sanftem Tod beizuwohnen. Da dies der erste Fall von Sterbehilfe in der Stadt sei, beeilte er sich zu erklären, bitte man Vertreter verschiedener Interessengruppen hinzu, darunter auch einen Patienten. Das sei alles.
Zwar war Yun Tianming davon überzeugt, dass es dem Arzt durchaus noch um etwas anderes ging. Aber da Dr. Zhang ihn bislang vorzüglich betreut hatte, sagte er dennoch zu.
Erst später fiel ihm auf, dass ihm Zhangs Gesicht und Name irgendwie vertraut vorkamen. Hatte er ihn etwa schon vor der Einweisung ins Krankenhaus gekannt? Ihm fiel nicht ein, woher. Dass er sich zuvor noch keine Gedanken darüber gemacht hatte, lag wohl daran, dass es in ihren bisherigen Gesprächen nur um seine Behandlung gegangen war. Während sie ihrem Beruf nachgingen, sprachen und agierten Ärzte anders als in ihrem Privatleben.
Keiner von Lao Lis Angehörigen kam zu der Prozedur hinzu. Er hatte ihnen seine Entscheidung verschwiegen und darum gebeten, dass nicht das Krankenhaus seine Familie anschließend über seinen »sanften Tod« informierte, sondern das Bürgeramt der Stadt. Das neue Gesetz ließ das zu.
Stattdessen tauchten zahlreiche Reporter auf, die jedoch auf Abstand gehalten wurden. Ein Raum in der Notaufnahme war zum Sterbezimmer bestimmt worden. Eine der Wände bestand aus einem Einwegspiegel, durch den man von der anderen Seite aus die Vorgänge im Raum verfolgen konnte, ohne vom Patienten gesehen zu werden.
Yun Tianming zwängte sich durch die Gruppe der Beobachter nach vorne. Als er das Innere des Sterbezimmers erblickte, überkamen ihn Angst und Ekel. Am liebsten hätte er sich übergeben.
Man hatte einige Mühe auf die Dekoration des Zimmers verwendet. Hübsche neue Gardinen zierten die Fenster, Vasen mit frischen Schnittblumen standen herum, und die Wände waren mit unzähligen rosafarbenen Herzen geschmückt. Doch der gut gemeinte Versuch, der Prozedur einen menschlichen Anstrich zu geben, hatte genau den gegenteiligen Effekt. Der Raum wirkte, als hätte sich jemand bemüht, eine Gruft in ein Brautgemach zu verwandeln. Dadurch wirkte die Fratze des furchtbaren Todes nur umso grotesker.
Lao Li lag auf einem Bett in der Mitte des Zimmers. Er schien gefasst und friedlich. Auf einmal wurde Yun Tianming bewusst, dass sie sich gar nicht richtig voneinander verabschiedet hatten, und ihm wurde schwer ums Herz. Im Raum befanden sich noch zwei Notare, die sich um den rechtlichen Teil der Prozedur kümmerten. Nachdem Lao Li die Papiere unterschrieben hatte, verließen sie das Zimmer.
Ein anderer Mann ging hinein und erklärte Lao Li den Ablauf. Er trug zwar einen weißen Kittel, doch es blieb unklar, ob er wirklich Arzt war. Zunächst deutete er auf den großen Bildschirm am Fußende des Betts und fragte Lao Li, ob er alles gut lesen könne. Als Lao Li nickte, bat er ihn, mit der Maus neben dem Bett versuchsweise die Schaltflächen auf dem Bildschirm anzuklicken. Gleichzeitig erklärte er, dass es auch andere Eingabemöglichkeiten gebe, falls das zu schwierig sei. Lao Li bewegte die Maus und versicherte, dass er gut damit umgehen könne.
Yun Tianming musste daran denken, wie Lao Li ihm einmal erzählt hatte, dass er noch nie einen Computer benutzt habe. Wenn er Geld abheben oder überweisen musste, hatte er sich vor dem Bankschalter angestellt. Wahrscheinlich hatte er noch nie zuvor eine Maus bedient.
Der Mann im weißen Kittel erklärte, dass auf dem Bildschirm eine Frage auftauchen würde – und zwar fünf Mal hintereinander. Unter der Frage würden jeweils sechs Schaltflächen erscheinen, durchnummeriert von null bis fünf. Wollte Lao Li sie bestätigen, musste er die passende Schaltfläche anklicken, die bei jeder Wiederholung der Frage nach dem Zufallsprinzip eine andere sein würde. Wollte er die Frage hingegen verneinen, dann musste er nur auf Null klicken, und der Prozess würde automatisch gestoppt werden. Einen »Ja«- oder »Nein«-Schalter würde es nicht geben.
Das Prozedere sei absichtlich derart kompliziert gestaltet worden, so der Mann weiter, damit der Patient nicht einfach immer denselben Schalter anklickte, ohne jedes Mal neu über seine Antwort nachzudenken.
Eine Krankenschwester trat ein. Sie hatte eine Infusionsnadel dabei und legte einen Zugang in Lao Lis linkem Arm. Der Schlauch, der von der Nadel abging, verlief zu einer automatischen Injektionsvorrichtung, die ungefähr so groß wie ein Notebook war. Der Mann im weißen Kittel zog ein versiegeltes Päckchen hervor, von dem er mehrere Schichten Schutzfilm abwickelte, bis eine gläserne Phiole zum Vorschein kam. Die gelbliche Flüssigkeit darin füllte er vorsichtig in die Injektionsvorrichtung. Dann verließ er mit der Krankenschwester das Zimmer.
Lao Li blieb allein zurück.
Die Prozedur für den sanften Tod begann. Auf dem Monitor erschien eine Frage, die parallel von einer freundlichen Frauenstimme vorgelesen wurde:
Möchten Sie Ihr Leben beenden? Für Ja wählen Sie die »3«, für Nein wählen Sie die »0«.
Lao Li klickte die »3« an.
Möchten Sie Ihr Leben beenden? Für Ja wählen Sie die »5«, für Nein wählen Sie die »0«.
Lao Li klickte die »5« an. Die Frage wurde noch zwei Mal wiederholt.
Möchten Sie Ihr Leben beenden? Dies ist die letzte Frage. Für Ja wählen Sie die »4«, für Nein wählen Sie die »0«.
Yun Tianming wurde derart schwindelig vor Trauer, dass er das Gefühl hatte, ohnmächtig zu werden. Nicht einmal beim Tod seiner eigenen Mutter hatte er solchen Kummer empfunden. Er wollte schreien, den Einwegspiegel zertrümmern und die freundliche Frauenstimme ersticken. Wähle »0«, Lao Li, wähle »0«!
Aber Lao Li klickte auf die »4«.
Lautlos begann die Injektion. Yun Tianming sah, wie die gelbliche Flüssigkeit in der Phiole weniger wurde und schließlich verschwand. Lao Li blieb währenddessen vollkommen reglos. Er schloss die Augen und schlief ein.
Als sich die Menge hinter dem Spiegel auflöste, blieb Yun Tianming, wo er war, und hielt beide Hände gegen die Glasscheibe gepresst. Seine Augen waren weit aufgerissen, aber nicht auf den leblosen Körper gerichtet. Er sah gar nichts.
»Er hatte keine Schmerzen.« Dr. Zhangs Stimme war so leise wie das Summen einer Mücke. Yun Tianming spürte eine Hand auf seiner linken Schulter. »Die Injektion besteht aus einer hohen Dosis Barbiturate, einem Muskelentspannungsmittel und Kaliumchlorid. Die Barbiturate wirken zuerst und versetzen den Patienten in Tiefschlaf, das Muskelentspannungsmittel stoppt die Atmung, und das Kaliumchlorid führt zum Herzstillstand. Das Ganze dauert nicht länger als zwanzig bis dreißig Sekunden.«
Dr. Zhang ließ die Hand noch einen Moment auf seiner Schulter liegen, bevor er sie schließlich wegzog. Yun Tianming hörte, wie sich seine Schritte entfernten, drehte sich aber nicht nach ihm um.
Da endlich wurde ihm bewusst, woher er Dr. Zhang kannte. »Dr. Zhang!«, rief er ihm nach.
Die Schritte hielten inne.
Yun Tianming drehte sich immer noch nicht zu ihm um. »Sie kennen meine Schwester, nicht wahr?«
Eine Weile herrschte Schweigen. »Ja«, kam dann die Antwort. »Wir sind zusammen zur Schule gegangen. Ich erinnere mich daran, dass ich Sie als kleinen Jungen ab und zu gesehen habe.«
Mit mechanischen Schritten verließ Yun Tianming das Hauptgebäude des Krankenhauses. Jetzt wusste er, was gespielt wurde. Dr. Zhang handelte im Auftrag seiner Schwester. Und die wollte ihn gern tot sehen. Nein. Sie möchte, dass ich »sanft entschlafe«.
Ihre gemeinsame Kindheit hatte er als sehr glücklich und unbeschwert in Erinnerung, doch als Erwachsene hatten er und seine Schwester sich auseinandergelebt. Es hatte zwar nie einen offenen Konflikt oder Kränkungen zwischen ihnen gegeben. Aber sie waren einander völlig fremd geworden und gingen beide davon aus, dass der andere sie verachtete.
Seine Schwester war gerissen, aber nicht unbedingt klug, und sie hatte einen Mann geheiratet, der ihr glich. Sie waren beide beruflich nicht sonderlich erfolgreich und konnten sich selbst jetzt, da die Kinder erwachsen waren, kein eigenes Zuhause leisten. Da es bei den Eltern seines Schwagers keinen Platz für sie gab, lebten sie im Haus von Yun Tianmings Vater.
Yun Tianming wiederum war ein Einzelgänger und hatte es beruflich und privat auch nicht weiter gebracht als seine Schwester. Er hatte stets allein in den Firmenwohnheimen seiner jeweiligen Arbeitgeber gelebt und die Betreuung des altersschwachen Vaters komplett seiner Schwester überlassen.
Jetzt begriff er, was sie im Sinn hatte. Seine Versicherung reichte zur Deckung seiner Krankenhauskosten nicht aus, und je länger er in Behandlung blieb, desto höher wurde die Rechnung. Sein Vater kam mit seinen Ersparnissen, die er nie angetastet hatte, dafür auf, um seine Schwester und ihre Familie beim Kauf einer Wohnung zu unterstützen. Aus Sicht seiner Schwester gab der Vater das Geld, das eigentlich ihr zustand, für Yun Tianmings Behandlung aus. Noch dazu wurde es für Therapien verschwendet, die seinen Zustand höchstens für eine Weile stabilisierten, aber keine Heilung bringen konnten. Sollte er sich für den sanften Tod entscheiden, käme sie an ihr Erbe, und sein Leiden hätte ein Ende.
Wie in seinem Traum war der Himmel von Wolken verhangen. Beim Anblick dieser grauen Endlosigkeit stieß Yun Tianming einen tiefen Seufzer aus.
Na gut, wenn du möchtest, dass ich sterbe, dann sterbe ich eben.
Ihm kam Das Urteil von Franz Kafka in den Sinn, in dem ein Vater seinen Sohn verflucht und ihm sagt, er solle doch sterben. Der Sohn stimmt zu, so selbstverständlich, als habe man ihm gesagt, er solle den Müll runterbringen oder die Tür zumachen, geht aus dem Haus, rennt durch die Straßen bis zur Brücke und springt über das Geländer in den Tod. Später erzählte Kafka seinem Biografen, er habe beim letzten Satz »an eine starke Ejakulation« gedacht.
Jetzt verstand er Kafka, diesen Mann, der vor über hundert Jahren mit Hut und Aktentasche stumm durch die schwach beleuchteten Straßen Prags gelaufen war – ein Mann, so einsam und exzentrisch wie er selbst.
Zurück im Krankenhaus erwartete ihn ein Besucher, sein alter Kommilitone Hu Wen.
Echte Freundschaften hatte Yun Tianming an der Uni nie geschlossen. Hu Wen kam der Vorstellung von einem Freund noch am nächsten. Anders als Yun Tianming war er der Typ Mensch, der mit jedem gut klarkam und jeden kannte. Yun Tianming gehörte sicher nur zum äußersten Kreis seiner zahlreichen Bekanntschaften. Nach dem Examen hatten sie sich nie wiedergesehen.