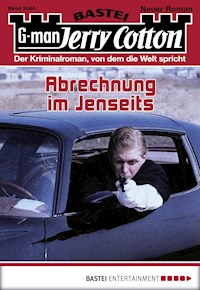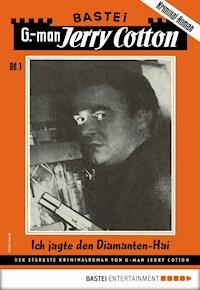
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Krimi
- Serie: Jerry Cotton
- Sprache: Deutsch
Eigentlich wollten Jerry Cotton und Phil Decker einen richtigen Urlaub auf einer unberührten Südseeinsel verbringen und unter Wasser nach Fischen jagen. So fängt dieser Roman recht harmlos und idyllisch an, und es wäre sicherlich ein schöner Urlaub geworden, wenn nicht vor der steilen und gefährlichen Küste dieser Insel ein gesunkener Dampfer gelegen hätte, in dessen Bauch eine Unmenge Diamanten auf einen Schatzsucher warteten. Der Schatzsucher kommt in Gestalt vieler verdächtiger Männer, und nun müssen Cotton und Decker fast unbewaffnet und ohne jede Hilfe von außen einen Kampf gegen Verbrecher führen, wie er unter so vollem Einsatz der eigenen Person selbst von diesen beiden berühmten G-men noch nicht geführt wurde.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 160
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
Cover
Impressum
Ich jagte den Diamanten-Hai
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige eBook-Ausgabe der beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgabe
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
© 2018 by Bastei Lübbe AG, Köln
Programmleiterin Romanhefte: Ute Müller
Verantwortlich für den Inhalt
Titelfoto: v. Mindszenty/Arion/Columbia
eBook-Produktion: César Satz & Grafik GmbH, Köln
ISBN 978-3-7325-7450-6
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
www.bastei.de
Ich jagte den Diamanten-Hai
Das Wasser war klar wie ein Bergquell, aber an manchen Stellen so tief, dass die Schwärze unter mir lag wie ein grundloser Krater. Diese Stellen hatten etwas Unheimliches. Man wurde nie ganz das Gefühl los, dass jeden Augenblick aus der Schwärze ein langer, glitschiger Arm hochschießen und einen hinabziehen könnte.
Nun, ich brauchte nicht unbedingt dort zu schwimmen. Unmittelbar an der Küste war die See flacher. Milliarden von Wogen hatten die Felsen zu feinem Sand zermahlen, auf dem ganze Wiesen seltsamer Lebewesen wuchsen, Mitteldinger zwischen Pflanzen und Tieren. Dazwischen schossen Fische aller Größen und in allen Farben des Regenbogens herum. Dunkle Spalten in den Felsen versprachen Überraschungen jeder Art.
Mir ging es so gut wie vielleicht noch nie in meinem Leben. Ich hatte einen neuen Sport für mich entdeckt und übte ihn mit Leidenschaft aus. Ich war von der Gangsterjagd zur Unterwasserjagd übergegangen, trug keinen Revolver mehr unter dem Jackett – ja, ich trug nicht einmal mehr ein Jackett –, sondern eine Pressluftharpune und ein breites Fischmesser aus rostfreiem Stahl, aber das nur zum Angeben. Auf die Nase hatte ich mir eine Taucherbrille gestülpt. Im Mund steckte das Mundstück des Atemgeräts, und anstelle der Schuhe trug ich hübsche grüne Flossen. Mich interessierten nicht mehr die Haifische der New Yorker Unterwelt, sondern nur noch dicke Zackenbarsche und schlangenköpfige Muränen.
Es war der prächtigste Urlaub meines Lebens, und Phil war durchaus meiner Meinung. Wir waren fast so braun wie die knapp hundert Insulaner, die die Insel bewohnten.
Wenn Sie glauben, ich triebe mich irgendwo vor Amerikas Küste herum, so sind Sie im Irrtum. Mit Amerika hatte die Gegend, in der wir uns befanden, nichts mehr zu tun. Ich schätze, der letzte Amerikaner ist so um 1945 hier gewesen, als es galt, die Japaner zur Vernunft zu bringen.
Unser Glück verdankten wir einem Stuhlwärmer in der Zentrale des FBI in Washington. Der Mann war auf den Gedanken gekommen, dass wir G-men bei unserem aufregenden Beruf alle zwei Jahre einen achtwöchigen Urlaub haben müssten, wenn’s bisher auch nicht in der Tarifordnung stand. Da dieser Mann zufällig noch ein hohes Tier in unserer Verwaltung war, konnte er seine menschenfreundliche Idee gleich in die Tat umsetzen. Jeder G-man erhielt alle zwei Jahre seine acht Wochen Urlaub, und jetzt waren Phil und ich an der Reihe.
No, wir fuhren nicht nach Mexiko, um unser Geld in Spielhöllen durchzubringen, nahmen auch keine Karte für einen Trip ins alte Europa, um Häuser anzuschauen, die schon gebaut worden waren, als Amerika gewissermaßen noch in den Windeln lag. Wir setzten uns auch nicht in den Havana Express und gondelten nach Kuba, wo man so viele Amerikaner trifft, dass man sich in Boston glaubt. Nein, wir knobelten uns ein besonderes Ding aus!
Wir hatten da unter unserer Kundschaft einen alten Seebären, der vor Jahren mal in Ostasien geschippert war. Der erzählte, wenn er betrunken war, mit tränenden Augen und whiskyschwangerem Tremolo in der Stimme von den Talaut-Inseln, diesem letzten Paradies auf Erden, in das er für sein Leben gern fahren würde, wenn er nur das Geld besäße und nicht fürchten müsste, dass es ihm dort an Sprit mangeln könnte.
Wir glaubten nicht recht an ein Paradies, weil solche längst von Reisebüros entdeckt und dann keine mehr sind. Aber eines Abends, zwei Tage nachdem wir den Bescheid hatten, an der Reihe zu sein, hatte unser Schiffer eine Seekarte bei sich und legte seinen Finger auf einen Punkt zwischen Mindanao und Celebes.
»Hier«, lallte er, »Talaut-Inseln, allerbestes Ostasien, das Paradies.« Dann begann er, zu singen: »Dorthin möcht ich mit dir, du Geliebte, ziehen.« Oder so ähnlich.
Was während der Nacht in meinem Gehirn vorgegangen war, kann ich nicht sagen, jedenfalls wachte ich am anderen Morgen mit dem festen Vorsatz auf, zu den Talaut-Inseln zu fahren.
Phil fragte, ob ich verrückt sei, dann ging er mit zum Reisebüro, und weil dort niemand wusste, wo die Talaut-Inseln lagen, buchten wir eine Flugreise nach Manila.
Drei Tage später hatten wir den Boden der Philippinen unter unseren Füßen. In Manila nahmen wir eine schrottreife Höllenkiste nach Suri auf Mindanao, und hier trafen wir Leute, die sogar wussten, wo die Talaut-Inseln lagen und wie hinzukommen war. Nach der Hauptinsel, Labian, ging einmal wöchentlich ein Postschiff. Es fuhr am anderen Tag, und wir schafften es. Labian gefiel uns nicht, weil es dort vierundzwanzig Autos und drei Kinos gab, womit uns die Insel zu amerikanisiert erschien, denn uns hatte gewaltige eremitische Sehnsucht gepackt.
Die kleinste der Talauten war Panafarut, das einmal monatlich von einem gebrechlichen Postdampfer bedient wurde, der gerade abging, als wir ankamen. Wir vertrauten unsere Seelen dem Himmel, unsere Leiber dem Wrack an und dampften los. Es war genau der richtige Tipp.
Die Talaut-Inseln gehören zu Indonesien. Sie bestehen – ach, Unsinn, lesen Sie das doch im Lexikon nach! Panafarut hatte einen Hafen, in den Hunderttonnenschiffe gerade noch passten, eine wild zerklüftete Steilküste, hundert Ureinwohner, die in einem Dorf im Inneren wohnten, obwohl sie sich von Fischfang ernährten, eine Telegrafenstation, die in einer Holzbaracke untergebracht war, und als Attraktion eine Art Hotel, das von einem fetten Halbblut bewirtet wurde, der sich Panhacker nannte.
Als sich die Amerikaner in der Gegend herumtrieben, war dieser Mister auf die wahnsinnige Idee verfallen, Panafarut zu einem amerikanischen Ferienparadies machen und dabei massig Dollars verdienen zu können. Sie wissen: Amerikaner schätzen Natur und Einsamkeit, wenn sie dabei nicht auf eisgekühlte Drinks und andere Zerstreuungen verzichten müssen. Panhacker hatte daher rings um sein wackliges Hotel zwischen Palmen und bunt blühendem Gebüsch eine Reihe kleiner, nicht einmal schlecht ausgestatteter Holzhäuser errichtet, die für ein oder zwei Personen gedacht waren und Einsamkeit mit Komfort versprachen. Aber die Amerikaner gewannen den Krieg gegen Japan und verschwanden aus der Gegend. Panhackers Weekend-Häuser standen plötzlich leer und drohten, zu verfallen.
Phil und ich waren eine Sensation für Panafarut. Panhacker überpurzelte sich vor Eifer, als er den ersten Dollarschein sah, und tat alles, um zwei seiner Häuser so bequem wie möglich für uns einzurichten. Er sprach nicht schlecht Englisch, und fast alle Halbblute, die sich außer ihm auf der Insel herumtrieben, konnten genügend davon, um sich mit uns zu verständigen.
In drei Tagen waren wir heimisch wie in New York oder Connecticut, nur dass das Leben hier bedeutend angenehmer war. Wir durchstreiften die dreißig Quadratmeilen große Insel, besuchten das Ureinwohnerdorf, palaverten mit dem Ältesten und kauften einige seltsame Geräte, aber hauptsächlich tummelten wir uns mit Atemgerät und Flossen in den klaren Gewässern vor der Küste.
Wir hatten einen hübschen, vielleicht zwölfjährigen braunen Ureinwohnerjungen engagiert, der auf den Namen Rago hörte. Er sollte uns die besten Fischgründe zeigen und das Ruderboot hüten, während wir uns unter Wasser herumtrieben. Aber manchmal ging sein Temperament mit ihm durch, und er tauchte auch ohne Atemgerät, denn er schwamm wie ein Aal und war olympiareif.
An den lauen Abenden saßen wir an Panhackers Hotelbar und tranken Eisgekühltes. Mit uns hockte Abend für Abend die gute Gesellschaft und die hohe Verwaltungsbehörde der Insel in dem Laden. Durch die Bank handelte es sich um Halbblute, obwohl nie klar zu erkennen war, was sich da eigentlich gemischt hatte. Der reiche Wang-Cho zum Beispiel, der den Ureinwohnern die getrockneten Fische abkaufte, hatte hauptsächlich chinesisches Blut, während an Single-Pag, dem Polizeichef und gleichzeitig einzigen Polizisten der Insel, ohne Zweifel ein Afrikaner beteiligt gewesen war. Wir vertrugen uns mit ihnen prächtig, tranken hin und wieder eine Runde, und an einem solchen Abend erfuhren wir die Geschichte von der Patronia, dem einzigen Kriegsereignis, das in Panafarut stattgefunden hatte.
Dieses niederländische Schiff war ein Kahn von hundertfünfzig Tonnen gewesen, den die Amerikaner übernommen hatten, als die Deutschen Holland besetzten, und er war nach Manila gedampft, um Flüchtlingsgut zu bergen, als die Japaner die Philippinen zu besetzen drohten. Unter anderem hatte das Schiff den gesamten Bestand einer englischen Diamantschleiferei an Bord genommen: Roh- und Fertigdiamanten im Werte von ungefähr einer Million Pfund. Entlang der Küsten hatte die Patronia versucht, sich in Sicherheit zu bringen, gerade vor Panafarut hatten japanische Bomber sie erwischt und ihr ein mittelschweres Ding versetzt. Sie war in zwei Hälften zerbrochen und wie ein Stein gesunken. Knapp zehn Prozent der Mannschaft nur hatten sich retten können.
»Sie liegt eine Meile vor der Ostküste«, erzählte Panhacker und goss uns neuen Whisky ein, »in einer Tiefe von hundert Fuß.«
»Ist nie versucht worden, sie zu bergen?«, erkundigte ich mich. »Diamanten im Wert von einer Million Pfund sind schließlich kein Pappenstiel. Die lässt man nicht ohne Weiteres auf dem Meeresgrund liegen.«
»Es gab schon endlose Streitereien um das Besitzrecht«, erklärte der Wirt. »Engländer, Niederländer und Amerikaner stritten sich, wem die Ladung gehöre und wer das Risiko der Bergung zu tragen habe. Es waren auch einige Male Kommissionen hier. Ich glaube, die amerikanische Regierung hat den Engländern den Schaden ersetzt, und die Patronia, so wie sie auf dem Meeresgrund liegt, zum Verkauf ausgeschrieben, aber das weiß ich nicht mit Sicherheit.«
»Yes«, meldete sich Single-Pag, der Polizeipräsident von Panafarut, »ich haben strenges Befehl, niemand tauchen zu lassen nach Wrack ohne Genehmigung der Regierung.« Er musterte uns aus seinen dunklen Malaienaugen mit angestrengtem Misstrauen.
»Keine Sorge, Chef«, erwiderte ich lachend. »Hundert Fuß sind leider zu tief für unsere Sportgeräte, sonst würden wir es wohl versuchen.«
Wir tranken aus, spazierten etwas an der Küste entlang, genossen ein wenig die herrliche Kühle der Nachtluft und strebten dann unseren Weekend-Pavillons zu.
»Was meinst du«, fragte Phil bei der Verabschiedung, »sollen wir morgen nicht einmal sehen, ob wir vielleicht nicht einen Zipfel von der Patronia erwischen können?«
»Hundert Fuß«, antwortete ich, »das ist hoffnungslos. Außerdem habe ich gestern den Schwanz einer Muräne gesehen, die gerade in eine Spalte wischte. Das Vieh möchte ich morgen fangen.«
***
Am Morgen tauchten wir vom Boot aus vor den Außenklippen des Hafens. Ich hatte die Spalte gefunden, in der ich meine Muräne vermutete, band einen toten Fisch an einen Stock und pflanzte ihn in den Sand, dann legte ich mich auf die Lauer.
Eine Muräne sieht aus wie ein Aal, nur dass sie groß werden kann wie ein ausgewachsener Mann und so dick wie der Schenkel eines Ringkämpfers. Außerdem haben sie das Maul voller Zähne, und ihr Biss ist giftig. Alles andere als ungefährlich, sie unter Wasser zu jagen.
Ich brauchte kaum drei Minuten zu warten, als sich meine Muräne aus der Spalte schlängelte, den Fisch erblickte, das Maul aufriss und ihn verschlang. Sie fuhr so gierig zu, dass ein Stück des Stockes mit in ihren Schlund geriet.
Ich zielte sorgfältig mit meinem Pressluftgewehr. Die Harpune zischte in weißer Blasenbahn durch das Wasser und bohrte sich hinter dem Kopf des Fisches quer durch die Nackenmuskulatur. Die Muräne spie den verschlungenen Fisch wieder aus, tobte in einem Knäuel herum und wollte in ihren Spalt zurückschwimmen, aber die links und rechts herausragende Harpune hinderte sie daran. Der dünne Stahl des Schaftes verbog sich, als der Fisch wuchtig gegen den Felsen prallte.
Ich hatte unterdessen neu geladen und schwamm langsam auf die Muräne zu. Jetzt erblickte sie mich und riss ihren scheußlichen Rachen auf. Ich stieß das Pressluftgewehr vor. Sie schnappte prompt danach. Der Lauf mit der vorstehenden Harpunenspitze verschwand in ihrem Maul, und ich betätigte den Drücker. Die Wucht des Stoßes warf den Fisch zurück. Die Harpune fuhr in sein Inneres und drang von innen kurz vor seinem Schwanzende nach außen.
Die Muräne streckte sich. Dunkel sprudelte ihr Blut. Sie sank auf den Sandboden. Ich stieß mich ab und tauchte auf. Rago hing halb über Bord, hatte den Kampf durch den Schaukasten verfolgt, er patschte seine Hand auf meine Schulter und lachte anerkennend. Ich nahm das Mundstück des Atemgeräts zwischen den Zähnen weg und schob die Taucherbrille in die Stirn.
»Schnall mir das Gerät ab«, bat ich und hielt mich am Boot fest.
Er löste die Gurte und gab mir den Widerhaken mit dem Seil daran. Ich schob die Brille wieder zurecht, holte tief Luft, drehte mich und tauchte.
Die Muräne lag an derselben Stelle, aber schon knabberte an ihr eine Menge kleiner Fische. Sie stoben davon, als ich zwischen sie fuhr. Ich befestigte den Widerhaken im Maul des Fisches und tauchte auf, während ich das Seil ablaufen ließ. Rago half mir ins Boot. Wir zogen mit vereinten Kräften.
»Hallo, Mister Amerika«, wurde ich von der Klippe her angerufen. Oben stand eines der Halbblute in weißer Leinenhose und -jacke und schwang einen Zettel. »Telegramm für Sie.«
»Verrückt«, brüllte ich zurück und zeigte unmissverständlich auf meine Stirn, aber er schwenkte weiter den Zettel.
»Wer soll uns hierher telegrafieren?«, brummte ich.
Natürlich hatten wir in Manila hinterlassen, wohin wir gehen würden. Dasselbe hatten wir in Labian getan. Es gab also durchaus einige, die wussten, wo wir zu erreichen waren.
»Wo ist Phil, Rago?«, fragte ich.
Er zeigte zu den gegenüberliegenden Klippen. »Perlen«, sagte er grinsend. »Nix Perlen!« Er schüttelte den Kopf, dass die Wassertropfen aus seinem nassen Haar stoben. Ich sprang über Bord, schwamm hinüber und tauchte. Phil kroch auf dem Boden herum. Er hatte sich ein Netz um den Bauch gebunden, in das er alles sammelte, was ihm perlenverdächtig aussah. Ich klopfte ihm auf die Schulter und bedeutete ihm, mit nach oben zu kommen. Wir tauchten auf. Er nahm das Mundstück des Luftschlauchs aus den Zähnen.
»Was ist denn los?«, fragte er.
»Der Idiot drüben auf der Klippe behauptet, wir hätten ein Telegramm bekommen.«
»Zu viel Sonne oder zu viel Whisky«, antwortete Phil nur, schwamm aber mit zum Boot.
Rago hatte inzwischen mit aller Kraft die Muräne so weit hochgezogen, dass ihr scheußlicher Kopf an der Oberfläche trieb. Er fasste die Riemen und steuerte zwischen den Außenklippen in den Hafen. Der Telegrammschwenker hüpfte wie eine Gämse die Klippen hinunter.
Wir legten an dem Holzsteg an, an dem auch der Postdampfer festzumachen pflegte. Wie immer lungerten die Halbblute, einschließlich Polizist und Wirt, herum und sahen uns zu. Der Telegrafenbote stand grinsend in Erwartung eines Trinkgelds und reichte mir mit tiefer Verbeugung den Wisch. Er war mit Worten einer Sprache beschrieben, die eine entfernte Ähnlichkeit mit Englisch hatte.
FBI-Hauptquartier an Cotton, Panafarut. Hebung Patronia geplant. Berechtigung erteilt – Achtet – Vorsicht – Nehmt Verbindung – Benachrichtet – Flybert – Meldung – High.
Ich las den Text einige Male. Auch die einzelnen Worte, die ich hier klar hingeschrieben habe, waren mehr oder weniger verstümmelt.
Phil studierte angestrengt und zuckte mit den Schultern. »Offenbar will uns der Chef mitteilen, dass unser Ferienidyll gestört wird. Wir bekommen Besuch.«
»Dafür schickt er doch kein Telegramm.«
»Vielleicht fürchtet er, dass dein kriminalistischer Instinkt wach wird, wenn sich die Leute hier um die Patronia-Diamanten kümmern.«
»Woher weiß Mister High überhaupt, dass hier ein Schiff mit Diamanten auf dem Meeresgrund liegt? Das ist nicht sein Ressort.«
»Weiß ich auch nicht«, brummte Phil. »Mich interessieren diese Diamanten überhaupt nicht, sondern ich will wissen, ob in diesen Muscheln Perlen sind.«
Ich knöpfte mir den Telegrafisten vor. »Dieses Telegramm ist verstümmelt. Konnten Sie es nicht genauer aufnehmen?«
Er lachte. »Viele Störungen. Ich habe geschrieben, wie es ankam.«
»Ich möchte eine Depesche aufgeben«, sagte ich.
»Kommen Sie mit.«
Ich begleitete ihn zu seiner Holzbude, in der sich die vorsintflutliche Telegrafenstation und gleichzeitig die gesamte Postverwaltung befanden. In großen Druckbuchstaben schrieb ich ihm den Text auf einen Zettel:
AN FBI-DISTRIKT NEW YORK, MR. HIGH, VEREINIGTE STAATEN – STOPP – TELEGRAMM UNLESERLICH ERHALTEN – STOPP – DRAHTET NEUE NACHRICHTEN – STOPP – WAS IST MIT PATRONIA – STOPP – COTTON.
Ich wartete, bis er es durchgemorst hatte. Ich konnte selbst telegrafieren, aber der Junge machte es korrekt und fehlerlos. Ich wartete noch die Bestätigung der Empfangsstation ab.
»Wann kann ich Antwort haben?«, wollte ich wissen.
»Vier Tage.« Er feixte. »Telegramm geht von hier nach Labian, von da nach Celebes, dann über Manila nach New York.«
Ich schüttelte den Kopf. »Vier Tage? Und das im zwanzigsten Jahrhundert! Hier ist wirklich das Paradies.«
Er verstand nicht, was ich meinte, lachte aber und nickte.
Ich kehrte zum Hafen zurück und beschäftigte mich mit meiner Muräne. Wir fotografierten sie, dann schnitten wir ihr den Kopf ab. Die Ureinwohner verstehen es prächtig, Fischköpfe zu präparieren, damit sie haltbar sind, und ich machte mich mit Rago auf den Weg ins Dorf, um dem Präparator meine Wünsche auseinanderzusetzen. Phil, der inzwischen seine Muscheln geöffnet hatte, ohne eine Perle zu finden, schloss sich uns an.
Wir blieben im Dorf, aßen Fisch und beschlossen, abends mit den Ureinwohnern auf Fischfang zu fahren.
Es war einer der schönsten Abende, die ich auf Panafarut erlebte. Ich kann es Ihnen nicht richtig beschreiben, denn mir fehlt die poetische Ader. Alles, was ich bestenfalls berichten kann, sind nackte Tatsachen. Wir waren schon auf dem Heimweg, als Ragos Vater, in dessen Boot wir saßen, mich leicht am Arm berührte.
»Schiff«, sagte er und zeigte in die Dunkelheit. In einiger Entfernung glitten ein paar Lichter durch die Nacht.
»Der Postdampfer?«, fragte ich.
»No, kommt erst in so vielen Tagen.« Er zeigte mit den Fingern die Zahl fünfzehn.
Phil und ich sahen uns bedeutungsvoll an.
»Also der von Mister High angekündigte Besuch«, brummte ich.
»Vielleicht fährt der Kahn vorbei«, sagte Phil.
Er fuhr nicht vorbei. Von den Bambustüren unserer Hütten aus sahen wir, wie die Lichter des Schiffes vor der Hafeneinfahrt zum Stillstand kamen. Wir glaubten, verwehte Kommandorufe zu hören, das Rasseln der Ankerkette, das schwere Klatschen, mit dem der Anker in die Wellen schlug.
»Schade um unseren Urlaub«, meinte Phil seufzend. »Hoffentlich sind es keine Amerikaner.«
»Hoffentlich keine alten Kunden aus New York«, gab ich zurück. »Ich bin hier, um Fische zu jagen, und habe keine Lust, anderes zu tun.«
Es war die erste Nacht auf Panafarut, in der ich nicht gut schlief.
***
Beim ersten Morgenlicht war ich auf den Beinen. Phil musste es nicht anders ergangen sein, denn wir trafen uns vor unseren Hütten. Wie immer trugen wir nur Badehose und Bademantel. Die Atemgeräte lagen im Boot und wurden von Rago betreut. Durch den verwilderten Park und an den leer stehenden Wochenendhäuschen vorbei gingen wir zu Panhackers Hotel, um das Frühstück einzunehmen.
»Haben Sie gesehen, Gents?«, überfiel uns das Halbblut glückstrahlend. »Ein großes Schiff ist angekommen, ein ganzes Schiff voll Amerikaner. Gerade läuft es in den Hafen ein. Ich werde meine Weekend-Wohnungen vermieten und viele Dollars verdienen.«
Wir teilten seine Begeisterung nicht, vertilgten unser Obstfrühstück und liefen zum Hafen.
Der verdammte Kahn war dabei, sich durch die enge Einfahrt zu tasten. Es war eine schlanke Motorjacht mit niedrigen Aufbauten, eines dieser Schiffe, die in Filmstreifen vorzukommen und blendend weiß zu sein pflegen. Auch dieses Schiff mochte einmal weiß gewesen sein, heute war es schmierig und verdreckt.
»Flyer«, las ich den Namen des Schiffes am Bug.
»Landsleute«, bemerkte Phil. Er hatte recht. Vom Heck wehte die amerikanische Flagge.
Die Flyer drehte sich jetzt langsam, um anzulegen. Wir konnten die hinteren Aufbauten erkennen.
»Sieht aus, als hätten sie in letzter Zeit einiges verändert und keine Zeit mehr gefunden, diese Reparaturen anzustreichen. Man kann am Heck eingeschweißte Platten feststellen, die flüchtig mit Mennige gestrichen sind.«
»Seltsamer Aufbau, den sie achtern haben«, wunderte sich Phil. »Wenn mich nicht alles täuscht, ein Gegengewichtskran, wie ihn Bergungsschiffe führen.«
Wir sahen uns an.
»Also die Patronia-Diamanten«, meinte ich.