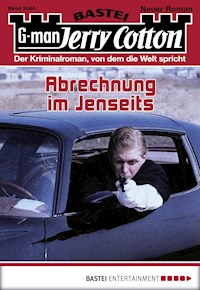1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Krimi
- Serie: Jerry Cotton
- Sprache: Deutsch
In einem leer stehenden Haus fanden Beamte des Manchester Police Department in New Hampshire zwei männliche Personen vor, die nebeneinander auf einer blutdurchtränkten Matratze lagen. Sie sahen aus wie Vater und Sohn. Der Junge war ein polizeibekannter vierzehnjähriger Straßendealer. Sein Körper war von Kugeln durchsiebt. Der andere war mein Freund und Partner Phil Decker - vollgepumpt mit Drogen und nicht vernehmungsfähig ... Und ich musste alles daransetzen, Phil von dem schrecklichen Verdacht zu befreien, dass er der Mörder des Jungen war!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 143
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
Cover
Impressum
Phil und der tote Junge
Vorschau
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige eBook-Ausgabe der beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgabe
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
© 2018 by Bastei Lübbe AG, Köln
Programmleiterin Romanhefte: Ute Müller
Verantwortlich für den Inhalt
Titelfoto: (Film) »Sturm der Vergeltung«/ddp-images
eBook-Produktion: César Satz & Grafik GmbH, Köln
ISBN 978-3-7325-6492-7
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
www.bastei.de
Phil und der tote Junge
»Verdammte Sauerei!«, schimpfte Jo Hunter. Sein zerknautschtes Bulldoggengesicht war puterrot verfärbt. Schweiß tropfte von seinem feisten Kinn auf den schmuddeligen, von Müll übersäten Teppichboden.
Pete Turner war sich nicht sicher, was genau seinem Partner so zu schaffen machte. War es die erdrückende Sommerhitze, die durch die zerbrochenen Fensterscheiben ungehindert in den muffigen, kleinen Raum drängte und sich darin staute? Oder der Anblick, der sich ihnen in diesem stinkenden Loch bot?
Hunter war schon seit drei Jahren beim Manchester Police Department. Und ziemlich abgebrüht. Turner war dagegen noch grün hinter den Ohren und hätte sich um ein Haar übergeben.
Auf einer blutdurchtränkten Matratze lag ein seltsames Paar. Die beiden sahen aus wie Vater und Sohn. Der Ältere hatte seinen linken Arm wie schützend um den Jüngeren gelegt. Die rechte Hand umklammerte eine Pistole. Die Brust des Jungen war von Schüssen zerfetzt.
Mit einer angewiderten Geste deutete Jo Hunter auf den Mann mit der Waffe. »Ich kenne den Kerl!«
»Und?«
»Phil Decker, ein FBI-Inspektor!«
Sonntagnacht. Es war gespenstisch. Ich stand mit Professor Adam Yeats in einem nüchternen, nach Desinfektionsmitteln riechenden Krankenzimmer, starrte auf das Bett und brachte kein Wort heraus. Die weißen Vorhänge am Fenster dämpften die nächtlichen Lichter der Großstadt draußen, formten sie um zu blassen, verschwimmenden Flecken. Mit Rücksicht auf den Patienten war der Raum nur matt beleuchtet. Im Halbdunkel wirkte Phils Gesicht wie eine wächserne Maske. Stirn, Schläfen und Hinterkopf waren mit einem Verband umwickelt. Darunter blickten mich zwei entsetzlich müde Augen fragend an.
»Hey, Jerry …« Ein brüchiges Stammeln.
Wenn das, was Phil da zustande brachte, ein Lächeln sein sollte, war es eindeutig misslungen.
»Hallo, Phil.«
Er antwortete nicht. Ich sah, dass er nur mühsam atmete.
»Man kann dich wirklich keine Sekunde allein lassen.«
Das sollte aufmunternd klingen. In Wahrheit fiel mir nichts Besseres ein. Bloß ein abgedroschener, blödsinniger Satz. Es machte mich einfach fertig, meinen Freund in diesem Zustand zu sehen.
Phils Blick wanderte zu Yeats.
»Wer sind Sie?« Kaum hörbar.
»Ich bin Ihr behandelnder Arzt«, stellte der Professor sachlich fest. »Wir wurden uns bereits vorgestellt.« Dann nahm er mich behutsam beiseite und raunte mir zu: »Ihr Partner ist noch sehr benommen, Inspektor. Wir sollten ihm nicht zu viel zumuten. Ich denke, Sie kommen morgen wieder. So gegen drei Uhr nachmittags.«
»Sorry.« Es klang wie das Brabbeln eines Babys. Phil schloss die Augen.
Yeats führte mich aus dem Zimmer und schloss sanft die Tür hinter sich. Da es schon auf Mitternacht zuging, war es auf dem Gang ruhig. Nur aus einem der Zimmer am hinteren Ende war ein unterdrücktes Stöhnen zu hören.
»Kommen Sie«, forderte mich Yeats auf.
Wenige Minuten später saßen wir uns in seinem Büro gegenüber. Der Professor hatte an einem Automaten zwei Plastikbecher mit Kaffee gefüllt, die jetzt auf dem Glastisch vor uns standen. Er war ein mürrischer, hagerer Mann mit ausgeprägten Sorgenfalten und Stirnglatze.
»Danke, dass Sie sich noch die Zeit genommen haben«, sagte ich.
Er zuckte nur gleichmütig mit den Schultern.
»In meinem Beruf gibt es keine geregelten Arbeitszeiten, Inspektor. Ich denke, das haben wir gemeinsam.«
Ich nickte.
»Und ich zweifelte nicht daran«, fügte Yeats hinzu, »dass Sie mich unbedingt noch sprechen wollten.«
Das war stark untertrieben. Seit man mir am Telefon mitgeteilt hatte, dass Phil mit einer schweren Kopfverletzung im Catholic Medical Center lag, hatte ich keine ruhige Sekunde mehr. Ich war in Washington gewesen und hatte drei Stunden warten müssen, bis die nächste Maschine nach Manchester gestartet war. Obwohl der Flug keine neunzig Minuten dauerte, traf ich erst fünf Stunden später im Krankenhaus ein. Und hatte bis jetzt keinen blassen Schimmer, wie schlimm es um Phil bestellt war.
»Wird er durchkommen, Professor?«
Yeats hob beschwichtigend die Hand. »Ja, da bin ich ziemlich sicher. Garantieren kann ich allerdings momentan nichts.«
Ich beobachtete ungeduldig, wie Yeats vorsichtig an dem heißen Kaffee schlürfte.
»Sagen Sie schon«, drängte ich, »wie steht es um meinen Partner?«
Yeats stellte den Becher auf dem Tisch ab und musterte mich prüfend. Vermutlich versuchte er, herauszufinden, ob ich hart gesotten genug war, um die Wahrheit zu ertragen.
»Ein Schuss hat ihn an der linken Schläfe gestreift und dort eine etwa zweieinhalb Inch breite, rinnenförmige Wunde verursacht. So weit die gute Nachricht.«
Yeats kühle Ironie gefiel mir nicht. »Was soll das heißen?«
»Nun, diese Verletzung ist eher harmlos. Aber Sie haben ja sicher bemerkt, dass Sie sich in der neurologischen Abteilung unseres Krankenhauses befinden.«
Ich nickte nur kurz und wartete darauf, dass der Arzt zur Sache kam.
»Die Wucht des Schusses«, fuhr Yeats fort, »hat eine Commotio Cerebri ausgelöst.«
Wieder traf mich ein taxierender Blick. Offenbar prüfte Yeats mein medizinisches Fachwissen.
»Ein Schädelgehirntrauma, das Sie unter dem Begriff Gehirnerschütterung kennen. In der Folge hat sich ein Ödem gebildet. Die Wassereinlagerung führt zu einer Zunahme des Innendrucks. Wir müssen das hier noch eine Weile beobachten. Wenn die Schwellung zu groß wird, drückt sie auf den Schädelknochen. Es kann zu einem Atem- und Kreislaufstillstand kommen.«
Ich fühlte, wie mir der Schweiß ausbrach. »Und dann?«
»Müssten wir operieren.«
Er ließ diese Diagnose erst einmal auf mich wirken. Ich fragte mich, was mit ihm los war. Offensichtlich gefiel er sich in der Rolle des unheilverkündenden Boten.
Yeats hüstelte, und ein winziges Lächeln kräuselte seine Lippen. »Aber machen Sie sich nicht verrückt, Inspektor. Noch ist es nicht so weit. Zurzeit erhält er Medikamente, die den Druck senken sollen. Wenn das nicht hilft, können wir zunächst immer noch mit einem Plastikschlauch Wasser absaugen.«
Ich atmete tief durch und entspannte mich etwas.
»Ich weiß nicht«, sagte Yeats, »ob es Ihnen aufgefallen ist. Ihr Partner hatte vergessen, dass er mich kannte.«
»Sie vermuten, er leidet unter einer Gedächtnisstörung?«
»Ja, die Fachbezeichnung ist retrograde Amnesie. Ein Verlust der Erinnerung an Geschehnisse, die vor und bisweilen auch nach dem traumatisierenden Ereignis liegen.«
»Wie lange hält so was an?«
»Ein paar Tage, eine Woche vielleicht«, antwortete der Professor. »Wenn es nicht zu unerwarteten Komplikationen kommt.«
»Wann wird er wieder sprechen können?«, wollte ich wissen.
»In ein, zwei Tagen, schätze ich. Aber nageln Sie mich nicht darauf fest.«
Ich hatte genug von Yeats überheblicher, kaltschnäuziger Art und davon, dass er seine Informationen nur scheibchenweise herausrückte.
»Danke, Professor. Ich will Sie nicht länger aufhalten.« Ich stand auf.
»Bleiben Sie!« Der Professor wies mit der Rechten auf meinen Stuhl. »Sie wissen noch nicht alles. Besser, Sie setzen sich noch einmal.«
Ich blieb stehen. »Vermutlich, weil Sie mir nicht alles gesagt haben.«
Er grinste schal. »Es sieht so aus, als hätte Ihr Partner ein Drogenproblem. Er ist bis oben hin vollgepumpt.«
»Wie bitte?« Ich war fassungslos. Davon hatte man mir am Telefon nichts gesagt.
»Er hat sich eine Art Cocktail verabreicht. Aus Alkohol, Opioiden und Amphetaminen.«
Phil schwer verletzt, neben ihm ein toter Vierzehnjähriger. Und jetzt auch noch das. Vielleicht war dieser Tag der härteste in meinem bisherigen Leben.
Doch Phil war unschuldig, so viel stand fest. Dieser Arzt hier hatte dazu allerdings offensichtlich eine andere Meinung.
»Mein Partner nimmt keine Drogen«, sagte ich entschieden und ging zur Tür. »Es wäre schön, wenn Sie ihm vorerst nichts anderes unterstellen würden.«
»Klar«, erwiderte Yeats mokant, »beim FBI gibt’s ja nur Unschuldsengel.«
Ich verließ das Zimmer mit dem Eindruck, dass Professor Yeats kein besonders umgänglicher Zeitgenosse war.
***
Lin Wu warf einen kurzen Blick auf die Leuchtziffern seiner sündhaft teuren Armbanduhr. Punkt zwölf, Mitternacht. Der Lkw mit der neuen Lieferung, der gerade auf den Parkplatz vor der stillgelegten Fabrik einkurvte, war pünktlich. Es beruhigte Wu, dass seine Partner seriöse, zuverlässige Leute waren. Keine Selbstverständlichkeit in dem Geschäft, das sie betrieben.
Bis auf den Randbereich, den die Scheinwerfer des Wagens abdeckten, und einer blakenden Funzel an der Hauswand war der Platz vor dem lang gestreckten, verwahrlosten Backsteingebäude stockfinster. Mehr als unwahrscheinlich, dass sich jetzt noch jemand hierher traute. Außer ihm selbst, seinen Leuten und denen da drüben im Bauch des Lkw.
Die Nacht, dachte Lin Wu, war sein Element. Von Beginn an. Seit seiner Kindheit. Heute noch konnte er die verächtliche Stimme seines Vaters hören: Elende Scheiße, was ist diese Missgeburt nun wirklich? Sieht aus wie ein Junge und benimmt sich wie ein gottverdammtes Mädchen! Man könnte glatt glauben, du hast mir diese Kreatur nur untergejubelt!
Wus chinesische Mutter hatte sich diese Anschuldigungen so zu Herzen genommen, dass sie ihren eigenen Sohn wie Aussatz behandelte. Wu hatte daraus geschlossen, dass er nicht besonders viel wert sein konnte, und gut daran tat, sich, wo immer es ging, einzuschmeicheln und durch aufgekratzte Lustigkeit und groteskes Gehabe fortwährend zur Unterhaltung anderer Menschen beizutragen. Als er dann mit achtzehn begann, sich entsprechend seiner Neigung wie eine Frau zu schminken und bunte Fummel zu tragen, machte er eine weitere wichtige Erfahrung. Dieselben verlogenen Spießer, die ihn für seine Kleinwüchsigkeit verachteten, applaudierten ihm, wenn er sich ihnen als parodierende Tunte präsentierte.
Seinen wahren Charakter aber verbarg Wu. Er blieb im Dunkeln. Eingesperrt in jenem feuchten Kellerloch, in das ihn seine Eltern häufig gesteckt hatten, um ihn zu demütigen. Der Lin Wu, der bis heute in diesem Loch lebte, war kindlich, grausam und unberechenbar. Beseelt von einer mörderischen Begierde, sich zu rächen. An allem und jedem.
Der gellende Schrei einer Frau riss ihn aus den Gedanken. Wu blickte zum Lkw hinüber, dessen Laderaum nun geöffnet war. Zwei Männer, undeutlich zu sehen im trüben Schimmer der Fabrikbeleuchtung, hatten den Kegel der Taschenlampen auf die dunkle Höhlung des Lkw gerichtet. An der vorderen Kante der Ladefläche kniete eine dunkelhäutige, halbnackte Frau. Ein weiterer Mann tauchte hinter ihr auf und versetzte ihr einen brutalen Tritt. Sie flog wie ein Ball durch die Luft und schlug mit allen vieren hart auf dem Beton des Bodens auf. Entsetzten und Wut ließen sie brüllen wie ein verendendes Tier.
Sie verstummte jäh, als sich einer der Männer vor ihr aufbaute und mit der Taschenlampe auf sie hinunterleuchtete.
Stille. Der Mann im Wagen rief etwas. Dann verließ eine dicht gedrängte Menge von Menschen den Laderaum: Männer, Frauen und einige Kinder. Allesamt Afrikaner. Lin Wu fragte sich, ob er mit dem Einkauf dieser Ware keinen Fehler begangen hatte. Bisher hatte er auf Mexikaner und Asiaten gesetzt. Na schön, das blieb abzuwarten. Kein Gewinn ohne Risiko!
Während sich die Afrikaner stehend, hockend oder sitzend gegen die Fabrikwand pressten, bewacht von den beiden Kerlen mit den Taschenlampen, kam der dritte auf Wu zu. Der Chinese stieß einen halblauten Pfiff aus. Sofort flammten hinter ihm Scheinwerfer auf und tauchten das Gesicht des Mannes, der sich Wu näherte, in gleißende Helligkeit.
Er war ein bulliger Mexikaner, nicht viel größer als Wu. Gerade so, dass er noch als normal gewachsen durchgehen mochte. Auf seiner wulstigen Stirn prangte eine Schlangentätowierung.
Knast,dachte Wu. Unprofessionell. Hat ihm irgendein Stümper verpasst.
Wenn Wu etwas nicht ausstehen konnte, war es schlechter Geschmack. Seinen Körper zierten auch ein paar hübsche Tätowierungen. Aber sie blieben da, wo sie waren, für die meisten unsichtbar. Nur Männer, die Gnade vor ihm fanden und in seinem Bett landeten, durften sie bewundern. Und außerdem: Seine Tattoos waren kleine, erlesene Meisterwerke.
»Hey, Süßer«, knurrte der Mexikaner feindselig, »was soll die Festbeleuchtung?«
»Ich kenne dich nicht«, erwiderte Wu. »Ich muss sehen, mit wem ich’s zu tun hab.«
»Das wirst du gleich merken, wenn ich ein paar Kugeln in den Wagen da reinjage.«
»Ich fürchte, das würde meinen Freunden nicht gefallen.« Er deutete zu dem Chevrolet mit den aufgeblendeten Scheinwerfern hinüber, der zwanzig Yards hinter ihm im Dunklen stand. »Sie sind zu dritt und haben heute noch keinen Spaß gehabt. Was soll’s, wahrscheinlich würden sie auch gern ein bisschen in der Gegend rumballern.«
Der Mexikaner starrte Wu ungläubig an. So was hatte er noch nicht erlebt. Ein ausgeflippter Freak mit Fistelstimme erdreistete sich, ihn zu provozieren. Jesus, bisher hatte er geglaubt, Menschenhandel sei was für harte Typen. Er unterdrückte das Verlangen, dieser Schwuchtel die Fresse zu polieren. Schließlich erwartete sein Boss, dass der Handel glatt über die Bühne ging.
»Pass auf«, sagte er, »wir machen es so: Deine Joker da hinten knipsen jetzt die Fluter aus. Ich krieg die Kohle, ihr übernehmt die Ware.«
Lin Wu lächelte kokett. Ein zweiter Pfiff, die Scheinwerfer erloschen. Jetzt konnten beide Männer im Dunkeln nur noch undeutlich die Silhouette des anderen ausmachen.
Der Mexikaner zuckte zusammen, knirschte vor plötzlicher Anspannung mit den Zähnen. Er spürte, wie unterhalb seines Kehlkopfs die kühle Schneide eines Messers entlangglitt.
Ein leises Kichern. Zwei feuchte, leicht geöffnete Lippen berührten sein linkes Ohr, während sich der Druck der Klinge unmerklich verstärkte.
»Nein«, flüsterte Lin Wu, »so machen wir es nicht. Halt einfach dein hässliches Maul, okay? Ich zeige dir, wie das hier läuft.« Er glitt hinter den Mexikaner, ohne die Position des Dolchs zu verändern, und rief etwas zu dem Chevrolet hinüber, was der Mexikaner nicht verstand.
Die Klinge an seiner Kehle machte dem Gangster zu schaffen. Er konnte sich auf nichts anderes konzentrieren, schnaufte vor Anspannung. Seine Hände waren eiskalt. Doch sein Kopf glühte, als steckte er in einem Backofen. Auf einmal wurde ihm bewusst, dass er jeden Augenblick tot sein konnte. Er hatte diese verfluchte Tunte hinter sich unterschätzt.
Während Wu mit der Rechten weiter den gebogenen Dolch am Hals des Mexikaners kontrollierte, nestelte er mit der Linken an dessen Hosenbund herum. Er fischte den Revolver heraus, der dort klemmte, und warf ihn weit hinter sich.
»Sag deinen Leuten«, zischte Wu, »sie sollen die Füße stillhalten!«
»Haz lo que él quiere!« Das Kommando des Mexikaners klang heiser und gepresst.
Die drei Männer aus dem Chevrolet gingen mit raschen Schritten auf die Kumpane des Mexikaners zu. Sie trugen Kapuzenpullis und hielten Großkaliberpistolen in den Fäusten. Wu sah zu, wie sie die Kerle mit den Taschenlampen entwaffneten und sie veranlassten, den Afrikanern einzeln ins Gesicht zu leuchten. Es war ein erster Check, ob die Ware in Ordnung war. Keine fünf Minuten später erhielt Wu das verabredete Zeichen von seinen Leuten.
Der Mexikaner hatte alles mitbekommen. Immer noch lag die Klinge des Dolchs an seiner Kehle. Er war also auf der Hut. »Kommen wir jetzt ins Geschäft?«
»Du willst das Geld?«
Der Mexikaner nickte vorsichtig. Er hätte sonst was dafür gegeben, das Gesicht von Lin Wu sehen zu können. So fiel es ihm schwer, einzuschätzen, was in dem Chinesen vor sich ging.
»Immer hübsch der Reihe nach«, knurrte Wu. »Mach dir keine Sorgen. Erst mal werden sich deine Jungs zu den Afrikanern stellen.«
»Was soll der Scheiß?«
Die Klinge beschrieb eine kurze, rasche Bewegung auf der Haut des Mexikaners.
»Verdammt, du hast mich geritzt, Cabrón!«
»Wie lautet dein Name, Chico?«
»Was geht dich das an?«
»Man sollte immer den Namen des Kerls kennen, den man tötet. Das hat was mit Respekt zu tun. Und ich respektiere dich, Chico.« Die Stimme des Chinesen war plötzlich hauchdünn und zart wie ein Schlangenbiss.
»Pablo«, sagte der Mexikaner.
»Fein, Pablo. Jetzt sag den Blödmännern, mit denen du hergekommen bist, sie sollen sich an die Wand stellen.«
»Ir a los negros, compañeros!«
Zögernd folgten seine Kumpane der Aufforderung. Auf Zuruf des Chinesen nahmen ihnen zwei von Wus Leuten die Taschenlampen ab.
»Sie sollen sich ausziehen«, verlangte der Chinese. »Sag ihnen das, Pablo!«
Der Mexikaner wagte keinen Widerspruch. »Quítate la ropa!« Es klang wie das Heulen eines geprügelten Hundes.
»Scheiße, Pablo!«, brüllte einer der beiden Gangster an der Wand. »Müssen wir uns das gefallen lassen?«
Sofort zog ihm einer der Kapuzentypen den Lauf seiner Pistole über die Nase, um ihn im nächsten Moment mit der Taschenlampe, die er in der anderen Hand hielt, anzuleuchten. Es war zu sehen, wie das Blut hervorschoss und sich in der unteren Gesichtshälfte ausbreitete. Aus der Gruppe der Afrikaner waren unterdrückte Schreckenslaute zu hören. Zwei Mädchen wollten wegrennen, wurden aber von den Erwachsenen zurückgehalten. Ein Junge begann, lautstark zu weinen.
»Quítate la ropa!«, wiederholte der Mexikaner seinen Befehl.
Kurz darauf hatten sich die beiden Männer vollständig entkleidet. Im spärlichen Schein der Fabriklampe wirkten ihre trainierten Körper unnatürlich bleich und schutzlos. Sie blickten mit gesenkten Köpfen in Richtung ihres Anführers.
»Deine Jungs zählen auf dich, Pablo.« Wu kicherte vergnügt. »Bin gespannt, ob sie damit recht behalten.«
»Worum geht’s dir eigentlich?«, fragte der Mexikaner.
»Ich will wissen, wer dein Boss ist.«
»Hernandez, du kennst ihn. Verdammt, ihr habt die Sache schließlich ausgehandelt.«
»Verarsch mich nicht, Pablo! Hernandez ist bloß ein besserer Laufbursche. Ich will den Big Boss, kapiert?«
»Wenn es ihn gäbe, würde ich es dir nicht sagen.«
»Ich respektiere das. Du bist kein Verräter. Dein Boss kann stolz auf dich sein.«
Es klang wie ein echtes Lob. Für einen Moment glaubte der Mexikaner, dass er das Schlimmste überstanden hatte. Er lauerte auf seine Chance.
Unvermittelt setzte heftiger Regen ein. Durch das prasselnde Geräusch der auf dem Betonboden aufschlagenden Tropfen gellte der Ruf des Chinesen: »Zeig’s ihm, Jake!«