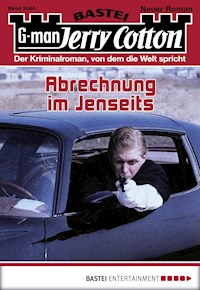1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Krimi
- Serie: Jerry Cotton
- Sprache: Deutsch
Nachdem Don Lorenzo Cosentino, Oberhaupt einer der mächtigsten Mafiafamilien, die New York zurzeit zu bieten hatte, gestorben war, ordneten sich die Reihen der Mobster neu. Das FBI wollte diese Chance nicht vertun. Es schickte mich - mit Phil als einzigem Kontaktmann - auf einen gefährlichen Undercovereinsatz, um den Cosentino-Clan zu unterwandern. Ein mehr als heikler Job, denn ich musste nicht nur Tausende Menschen vor einem Bombenanschlag retten, sondern auch zusehen, dass meine Tarnung nicht aufflog. Doch dann erfuhr ich am eigenen Leib: Der wahre Feind lauerte in den eigenen Reihen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 139
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
Cover
Impressum
New York darf nicht sterben
Vorschau
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige eBook-Ausgabe der beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgabe
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
© 2018 by Bastei Lübbe AG, Köln
Programmleiterin Romanhefte: Ute Müller
Verantwortlich für den Inhalt
Titelfoto: (Film) »Remo, unbewaffnet und gefährlich«/ddp-images
eBook-Produktion: César Satz & Grafik GmbH, Köln
ISBN 978-3-7325-6505-4
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
www.bastei.de
New York darf nicht sterben
Diese Cops mussten lebensmüde sein!
Sie störten die größte Mafiabeerdigung aller Zeiten in New York. Mit ihrem Streifenwagen rauschten sie aus einer Seitenstraße heran. Schalteten das Warnlicht ein. Ließen die Sirene kurz aufheulen. Rechtwinklig stießen sie auf die Metropolitan Avenue vor – mitten hinein in den pompösesten Trauerzug seit Frank Sinatra.
Die vordere Hälfte des Zugs bewegte sich weiter. Im Schritttempo ging es in Richtung St. John Cemetery. Ausgerechnet vor meinem Kenworth-Sattelschlepper stellte sich der Streifenwagen quer. Ich bremste.
Hinter mir kam alles zum Stehen. Die lebensgroße Pferdestatue auf meinem Sattelauflieger schwankte. An der Beifahrerseite des Streifenwagens stieg ein Sergeant aus. Ich ließ die Scheibe hinunter.
Er kam auf mich zu und schnarrte: »Fahrzeugkontrolle, Sir.«
Im selben Moment traf mich der Schock. Der Mikro-Empfänger in meinem Ohr schrie: »Alarm! Bombendrohung! Du hast eine gottverdammte Bombe in deinem Bronzepferd!«
Ich erlaubte mir keine Schrecksekunde, brüllte zum Seitenfenster hinaus, dass die Halsschlagadern schwollen.
»Alarm! Bombendrohung! Da ist eine Bombe im Pferd!« Heftig fuchtelnd zeigte ich nach hinten.
»Anonymer Anruf«, präzisierte Phil in meinem Ohr. »Der Kerl muss uns mal zusammen gesehen haben. Jedenfalls wusste er verdammt genau über dein Pferd Bescheid.«
Mein Pferd!, dachte ich entnervt und wünschte das Bronzeross inbrünstig auf den Grund des Hudson River. Das lebendige Original hieß Caliméro und war zu Lebzeiten des verstorbenen Mafiabosses Don Lorenzo Cosentino dessen Lieblingsrennpferd gewesen.
Der Sergeant brüllte zurück. »Raus da! Und deine Hände will ich sehen, Amico. Los, los, beweg dich!«
»Der Kerl hat sofort aufgelegt«, fuhr Phil unbeirrt fort. »Kein Wort darüber, wann, wo und wie die Bombe hochgehen soll. Rufidentifizierung positiv, aber nutzlos. Ein Wegwerfhandy.«
Ich sah das Entsetzen in den Gesichtern der Menschen auf den Bürgersteigen. Nur der Sergeant ließ sich nicht beeindrucken.
Während er kommandierte, zog er seine Dienstwaffe, hob sie in den Beidhandanschlag, tat zwei Schritte rückwärts und blieb breitbeinig stehen.
Ich glaubte es nicht. Ich konnte einfach nicht glauben, dass ich das erlebte.
Mein Freund Phil, derzeit im Undercovereinsatz wie ich, hatte mir gerade knallhart gesagt, was Sache war. Wir hier im Trauerzug würden gleich alle in die Luft fliegen.
Und ausgerechnet jetzt drehten zwei Cops durch, spielten sich angesichts der Mafiaparade auf und nutzten ihren Streifenwagen als Barriere.
Meine Nackenhaare sträubten sich, weil ich wusste, dass Phil keine Witze machte. Eine Bombenwarnung ohne Grund würde es von ihm nicht geben.
Damit nicht genug, durfte ich in die Neun-Millimeter-Mündung einer Glock 19 blicken. Es war die Standard-Dienstpistole des New York Police Department, aber kein Trost für mich. Denn als FBI-Kollege konnte ich mich auf keinen Fall zu erkennen geben.
Zum Glück hörte Phil alles mit.
»Bleib ganz ruhig«, sagte er mir ins Ohr. »Ich regele das.«
Ich antwortete nicht, weil niemand mitbekommen musste, was ich hier im Gangland trieb. Auch die beiden forschen Kollegen vom NYPD nicht. Und ruhig bleiben konnte ich nur mit Mühe.
Ich war Ross Oliver. Hätte der Sergeant meine Papiere zu sehen bekommen, hätte er darin den Geburtsnamen Calogero Olivieri gelesen. Bei Phil, der irgendwo in der Nähe in seinem Chrysler saß, war es ähnlich. Matteo Vincente, amerikanisiert zu Matt Vincent. Es verstand sich von selbst, dass wir beide nicht mehr im Entferntesten aussahen wie Jerry Cotton und Phil Decker.
Noch stand ich auf dem Bremspedal, die Automatik auf Vorwärtsfahrt, Kriechgang. Wegen des Schritttempos.
»Verdammt, Mann!«, bellte der Sarge. »Was habe ich gerade gesagt? Hoch die Hände! Und zwar presto, sonst …« Er unterbrach sich, denn ihm fiel Wichtigeres ein. Nur kurz ruckte sein Gesicht in Richtung Streifenwagen, und er rief: »Hey, Partner, gib zehn-fünfzig durch. Der Kerl macht Ärger.«
Ich sah, dass der Cop am Lenkrad das Funkmikro schon in der Hand hatte. Zehn-fünfzig war der Funkcode für »ungebührliches Benehmen«. Keine Straftat, aber es konnte schnell eine daraus werden, wenn die Dinge aus dem Ruder liefen.
Der Sergeant fixierte mich sofort wieder mit zornig-strengem Blick. Auf den Bürgersteigen entstand Bewegung. Ich hörte, dass sich das Wort »Bombe« fortpflanzte.
Leute, die es mitbekamen, drängten sich an denen vorbei, die noch nichts begriffen hatten. Es gab Rempeleien. Flüche wurden laut. Lange würde es nicht mehr dauern, dann brach Panik aus. Ich spürte, wie meine Nerven zu vibrieren begannen. Die Zeit zerrann mir unter den Fingern, so kam es mir vor.
»Ich habe mit Steve geredet«, sagte Phil, nur für mich hörbar. »Er hat das Police Department schon in der Leitung.«
Ich sah den Fahrer des Streifenwagens ins Mikro sprechen.
Für mich blieb die Lage unverändert. Und mit jeder vertickenden Sekunde kam ich der Explosion näher – wenn die Bombenbauer einen Zeitzünder installiert hatten. Falls sie einen Fernzünder verwendeten, mussten sie meinen Truck beobachten.
Ich befürchtete, dass Steve Dillaggio, unser alter Freund und Kollege und heutiger Chef des FBI Field Office New York, kaum noch rechtzeitig etwas ausrichten konnte. Außerdem war Fingerspitzengefühl angesagt, damit wir nicht vorzeitig aufflogen. Für mich hätte das ein Ende im Kugelhagel der Mafia bedeutet, bevor mir die Bronzebrocken um die Ohren flogen.
»Letzte Warnung«, rief sich der Sergeant in Erinnerung. »Sonst wird’s ernst, Freundchen.« Seine Stimme zitterte vor erzwungener Ruhe. »Raus aus der Kiste. Und die Hände hoch.«
Der Fahrer redete immer noch. Die Menschen wurden lauter. Erste Schreie gellten aus der Menge. Ich reagierte so, wie es Ross Olivers Naturell entsprach.
»Hast du was an den Ohren, Mann?«, fuhr ich den Sergeant an. »Ich habe eine Bombe an Bord! Kapiert? Ich muss hier weg, verdammt noch mal.«
Er starrte mich nur an.
»Den Streifenwagen weg!«, schrie ich.
Der Sergeant reagierte nicht. Auch sein Kollege nicht.
Mir riss der Faden.
Ich gab Gas.
Donnergrollen brach vorne unter der langen Haube aus. Das ganze riesige Geschütz schüttelte sich unter der bevorstehenden Anstrengung. Die 510 PS des Kenworth T680 erwachten zu röhrendem Leben. Ich wechselte von der Bremse aufs Gaspedal, trat es durch. Ein Rucken lief durch die Zugmaschine und ihre Anhängelast. Es war, als sträubte sich der Bronzegaul hinter mir wie ein Esel. Doch nur für einen Atemzug.
Denn dann packte der Sechszylinder zu wie eine Herde Büffel im Zuggeschirr. Mit voller Kraft nahm das Gespann Fahrt auf. Ich zog ein Stück nach rechts, nur so weit, dass ich die Bordsteinkante nicht touchierte.
Der wummernde Motor übertönte alles – das Gebrüll des Sergeants und die Schreie der Menschen. Rechts vor mir rannten sie, was sie konnten. Viele nutzten die freie Straßenfläche zur Flucht. Der vordere Teil des Trauerzugs war immerhin schon zweihundert Yards entfernt.
Ich setzte dem Lärm noch eins drauf und löste die Fanfare aus. Vom Dach des Fahrerhauses trompetete es wie vor den Mauern von Jericho. Der Fahrer des Streifenwagens hatte sein Funkmikro weggeworfen und schaltete die Sirene ein. Gegen meine Fanfare klang sie dünn. Gleichzeitig versuchte er, die Automatik auf Rückwärts zu reißen und den Streifenwagen in Sicherheit zu bringen. Es war zu viel auf einmal. Es klappte nicht.
Die Stoßfänger der Kenworth-Front waren tief genug, um den blau-weißen Chevrolet unterhalb seiner Gürtellinie zu fassen zu kriegen. Das Schmettern der Fanfare und das Heulen der Sirene vereinten sich zu wahrem Höllenlärm, als der Kenworth-Stahl den Kotflügel des Chevy quetschte und Widerstand am oberen Viertel von Vorderrad und Felge fand.
Der Streifenwagen fing zu rutschen an. Schräg von oben sah ich das entsetzte Gesicht des Cops hinter dem Lenkrad. Er tat mir leid, doch ich wusste, dass ihm nichts Ernsthaftes passieren würde. Es sei denn, mein Bronzepferd flog schon jetzt in die Luft, in den nächsten Sekunden.
Ich gab mehr Gas. Den Streifenwagen schob es beiseite wie ein Spielzeugauto. Die Reifen radierten über den Asphalt. Ihr Kreischen bildete die dritte Stimme zum Duett von Fanfare und Sirene. Links von mir klatschte es. Ich spürte einen sengenden Luftzug. Im selben Moment sah ich ein Loch in der Windschutzscheibe, links oben.
Ich duckte mich nach rechts. In der Seitenscheibe, untere Hälfte, gab es ein weiteres Loch. Der Sergeant hatte tatsächlich auf mich gefeuert. All right, aus seiner Sicht gerechtfertigt. Mein ungebührliches Benehmen war in Fahrerflucht übergegangen. Und schon hatten es die Cops mit einer Straftat zu tun.
Ich beschleunigte weiter. Links unter mir schrammte und schepperte die wund gescheuerte Flanke des Streifenwagens. Eine weitere Kugel klatschte in die Dachkante des Fahrerhauses. Den Schuss hörte ich auch diesmal nicht. Das Sirenengeheul und meine lärmende Fanfare übertönten alles. Ich schaltete sie auf Dauerbetrieb. Die Reifen des Streifenwagens kreischten nicht mehr.
Die weiß-blaue Limousine mit der Warnlichtbatterie blieb hinter mir zurück. Endlich hatte ich die freie Fahrbahn vor mir. Ich erhöhte das Tempo. Die digitale Tachoanzeige stand mittlerweile bei dreißig Meilen pro Stunde. In den Spiegeln schwankte die Pferdestatue wie auf einem Lastkahn im Seegang.
Der Kenworth rumpelte voran. Auf einer Avenue in New York unterwegs zu sein, bedeutete nicht immer, auf einer ebenen Fahrbahn dahinzugleiten. Bodenwellen und Schlaglöcher waren keine Seltenheit.
Einen Slalomkurs brauchte ich gar nicht erst zu fahren, denn dann hätte sich das bronzene Kunstwerk hinter mir garantiert aus seinen Verzurrungen gerissen und womöglich Menschen auf dem Bürgersteig erschlagen.
Ob es noch seinen vorgesehenen Platz neben dem Mausoleum der Familie Cosentino finden würde, war mehr als fraglich. Es sei denn, die Bombendrohung entpuppte sich als blinder Alarm.
Auf den Bürgersteigen zu beiden Seiten war inzwischen Panik ausgebrochen. In wilder Hast flohen die Leute in alle Richtungen. Viele rannten sich gegenseitig über den Haufen. Keine Frage, dass der Fanfarenton meines Kenworth das Chaos anheizte.
Die Schreckensmeldung von der Bombe im Bronzepferd hatte sich wie ein Lauffeuer verbreitet. Und alle sahen, dass der Fahrer des Sattelschleppers mit ebenjener Statue an Bord offenbar verzweifelt versuchte, Land zu gewinnen. Also musste etwas dran sein an der unheilvollen Nachricht.
Das freie Stück Fahrbahn vor mir war trügerisch. Das Ende des Trauerzugs, zweihundert Yards vor mir, bewegte sich weiterhin nur im Schritttempo. Und es sah nicht danach aus, dass sie so was wie eine brauchbare Rettungsgasse für mich freischaufeln würden.
Der Fahrer des letzten Wagens zog zwar nach links, und auch der Fahrer vor ihm versuchte sein Bestes. Aber was dann kam, glich einer Blockade. Einige der Fahrzeuge hatten Überbreite. Jedes einzelne stellte Szenen und Symbole aus dem Leben des Verstorbenen dar.
Direkt vor mir, mittlerweile nur noch hundert Yards entfernt, war es ein blumenumkränzter Siebentonner Chevrolet Kodiak, der noch ausreichend Platz gemacht hatte. Auf der offenen Ladefläche des Trucks war eine überdimensionale Zigarre aufgebaut, die schräg in den Himmel zeigte und Don Lorenzos einstige Vorliebe für teure Havannas demonstrieren sollte.
Auch vor dem Zigarren-Wagen hatte ein mittelgroßer Truck zur Seite gezogen. Es war ein Western Star 6900, ein Achttonner mit ebenfalls offener Ladefläche. Darauf thronte ein original Golf Cart inmitten eines Green aus Pappmaschee. Golf spielen war das Lieblingsfreizeitvergnügen des Cosentino-Familienoberhaupts gewesen, bevor er ins Hochsicherheitsgefängnis von Marion, Illinois eingeliefert worden war.
Die weiteren Motivwagen des Trauerzugs vorne zeigten Szenen aus dem Leben von Lorenzo Cosentino, nachgestellt mit Schaufensterpuppen. Etwa die Trauung mit seiner Frau Carmela, die ihn überlebt hatte. Oder die Taufe ihres ältesten Sohns Robert Lawrence, der heute nur noch »Bob« genannt wurde.
Neben den Bildern aus der Familiengeschichte gab es auch Wagen, die überdimensionale Architektenmodelle zeigten, von vier verschiedenen Kindergärten etwa, von zwei Freibädern und einem Hallenbad, von einer Baseballarena und einer Parkanlage. Alle Modelle waren in Brooklyn und Queens verwirklicht worden und hatten eines gemeinsam: Don Lorenzo hatte die Projekte finanziert und nach ihrer Fertigstellung den Einwohnern geschenkt. Dafür wurde er als Wohltäter gefeiert.
Zum Trauerzug gehörten ebenso Jagdszenen aus Oregon, wo Don Lorenzo Grizzlys und Elche geschossen hatte. Und das Cockpit seiner privaten Cessna, mit der er eigenhändig dorthin, an die Westküste, geflogen war. Große Bildwände zeigten Szenen aus den Kino- und Fernsehfilmen, die über sein Leben gedreht worden waren – solche und viele weitere geschmückte Wagen kamen dort vorne nach und nach zum Stehen, während ihre Fahrer verzweifelt versuchten, mir so viel Platz zu geben, wie sie konnten.
Ich nahm nur wenig Gas weg, als ich an der Zigarre und dem Golf Cart vorbeizog. Dann wurde es eng. Das freie Stück Fahrbahnbreite reichte nicht für meinen Kenworth. Ohne Rücksicht auf Verluste zog ich nach rechts, auf den Bürgersteig.
Zum Glück gab es an der Metropolitan nicht die sonst in Queens üblichen Straßenbäume, und parkende Autos waren für die Dauer des Trauerzugs weggeschafft worden. Die Cosentinos hatten sich die Mammut-Prozession rechtzeitig von dem für Queens zuständigen Bezirksbürgermeister genehmigen lassen.
Im bordeigenen Funklautsprecher des Kenworth krachte und schepperte es. Eine barsche Männerstimme drang durch, als der Sattelschlepper über die Bordsteinkante rumpelte.
»Ross Oliver, verdammt noch mal! Was ist da los bei dir? Rückmeldung!«
Die Stimme gehörte Nelson Todaro, dem Underboss, der für die Organisation des Trauerzugs verantwortlich war. Seine mobile Funkzentrale befand sich in einem schwarzen Cadillac Escalade, der am Tor des St. John Cemetery stand.
Der Bürgersteig war breit, aber nicht breit genug. Ich musste Gas geben, denn die Antriebsräder auf der rechten Seite der Zugmaschine wühlten sich in den Rasen der Vorgärten.
Doch nur für einen Moment, dann griffen die Differenzialsperren der beiden Hinterachsen, und der Antrieb verlagerte sich nach links. Dort wurden die Bürgersteigplatten zwar knöcheltief in den Untergrund gedrückt, aber für die kurze Zeit der Belastung gaben sie nicht weiter nach.
Die Menschen flüchteten schreiend auf den freien Teil der Fahrbahn und in die Einfahrten der Hausgrundstücke.
»Rückmeldung!«, brüllte sich mein Underboss in Erinnerung.
Ich schaltete auf Senden und schrie in das Mikro, das hin und her schaukelnd vom Himmel des Fahrerhauses herabhing: »Lass mich in Ruhe, Mann! Ich muss sehen, dass ich hier klarkomme, mit der Bombe im Nacken. Du hast genug Beobachter rumstehen. Lass dir gefälligst von denen berichten!«
»Beobachter?«, bellte Todaro zurück. »Mann, die haben doch alle einen FBI-Beschatter im Nacken. Ich will von dir wissen, was Sache ist. Und zwar sofort.«
»Himmel noch mal!«, platzte es aus mir heraus. »Ich muss dieses Baby hinter mir in Sicherheit schaukeln, kapiert? Und ich habe noch nicht die leiseste Ahnung, wie ich das hinkriege. Also lass mich gefälligst in Ruhe! Ich muss fahren, Mann. Fahren, bevor ich hier in die Luft fliege!«
Ich hörte noch, wie Todaro Atem holte, bevor ich das Funkgerät ausschaltete.
Kaum hatte ich das Lenkrad wieder mit beiden Händen im sicheren Griff, schlug es aus. Das rechte Vorderrad war in eine weiche Stelle am Rasenrand getaucht. Als Resultat hieb mir die Speiche aus flachem Edelstahl in den Daumenwinkel der rechten Hand.
Ungewollt schrie ich auf, hörte Schmerz und Wut aus meiner eigenen Stimme. Trotzdem lockerte ich meinen Griff um keinen Zoll. Eisern hielt ich den Kenworth auf Kurs, konnte ein Ausbrechen gerade noch verhindern.
In diesem Augenblick meldete sich Phil in meinem Ohr. »Eine Drohne fliegt auf dich zu«, rief er alarmiert. »Mehrere Kollegen haben das Ding gesichtet, unabhängig voneinander. Das bedeutet, dass es jeder sehen kann.«
Mein Kenny kam aus dem Rasenloch frei. Ich warf einen besorgten Blick in die Spiegel und nahm Gas weg. Wenn die hinteren Räder der Zugmaschine und die des Aufliegers in die weiche Stelle gerieten, konnte die Pferdestatue mitsamt Bombe umkippen.
Was dann passieren würde, stand in den Sternen.
»Eine Kameradrohne?«, fragte ich so ruhig ich konnte.
»Ja«, bestätigte Phil. »Die Kollegen von der Technik sind schon dabei, den Fernlenker zu orten.«
Mein Freund hatte es kaum ausgesprochen, als ich den Flugapparat sah. Er schwebte von oben in mein Blickfeld, war vielleicht hundert Yards entfernt. Ich fuhr nur noch Schneckentempo, beobachtete gleichzeitig die Drohne vor mir und die Anhängelast in den Spiegeln.
Einem großen Glotzauge gleich flog die Kamera der Drohne unter den Rotoren auf mich zu. Zugmaschine und Auflieger schwankten schon jetzt im Gegentakt. Jeden Moment mussten die Antriebsräder der Zugmaschine im Rasen einsinken.
Ich hielt das Lenkrad wie einen Schraubstock, brachte meine Fingerknöchel dazu, weiß hervorzutreten.
Etwa dreißig, vierzig Yards vor mir senkte die Drohne ihr Hinterteil ab, um rechtzeitig vor meinem Fahrerhaus in den Steigflug überzugehen. Den Hauch einer Sekunde lang richtete sich das Kameraobjektiv nach oben. Dann zerlegte sich das Gerät.
Ich riss die Augen weit auf.
Die Drohne zersprang in tausend Teile. Kunststoff- und Metallsplitter flogen nach allen Seiten auseinander. Ein Teil des Regens kleiner Trümmer ergoss sich prasselnd auf die Kenworth-Motorhaube.
Meine Nerven und meine Muskeln spannten sich an. Der Fluchtreflex in mir wurde übermächtig, doch mir war klar, dass ich nicht wegkonnte. Ich duckte mich unwillkürlich, rechnete fest mit der Detonation. Jeden Sekundenbruchteil konnte die Bombe hochgehen, ausgelöst durch die zerschossene Drohne, in der sich womöglich der Funkzünder befunden hatte.