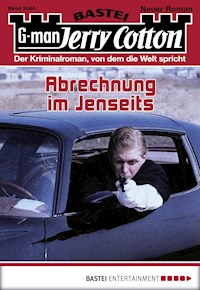1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Krimi
- Serie: Jerry Cotton
- Sprache: Deutsch
Phil und ich waren auf ganzer Linie gescheitert: Während unseres von langer Hand geplanten Undercovereinsatzes in New York waren wir im Kampf gegen das Organisierte Verbrechen aufgeflogen. Das hatten wir einem FBI-Kollegen, Inspektor Albert Drummond, zu verdanken. Er hatte unsere wahren Identitäten Frank Montagna verraten, dem Ex-Mann der schönen Virginia Cosentino. Der Mobster behielt sein brandgefährliches Wissen vorerst für sich. Doch es war nur eine Frage der Zeit, bis die Cosentinos, eine der einflussreichsten Mafiafamilien der Stadt, erfuhren, wer wir wirklich waren. Und schon bald stand meinem Freund und mir ein Kampf bevor - ein Kampf auf Leben und Tod!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 127
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
Cover
Impressum
Entscheidung in der Mafiahölle
Vorschau
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige eBook-Ausgabe der beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgabe
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
© 2018 by Bastei Lübbe AG, Köln
Programmleiterin Romanhefte: Ute Müller
Verantwortlich für den Inhalt
Titelfoto: (Film) »Erdbeben in New York«/ddp-images
eBook-Produktion: César Satz & Grafik GmbH, Köln
ISBN 978-3-7325-6506-1
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
www.bastei.de
Entscheidung in der Mafiahölle
»Jetzt bist du mein Held«, sagte die Gräfin. Auf den Sitzpolstern des Sportboots schmiegte sie sich an mich. All die Sehenswürdigkeiten schienen sie weniger zu interessieren. Die Skyline Manhattans, der Hafen, die riesigen Containerfrachter, die Kreuzfahrtschiffe und die Freiheitsstatue rauschten an ihr vorüber, als gäbe es nur mich. Dabei hatten wir einen dritten Mann an Bord.
»Ich bin dein Leibwächter«, entgegnete ich. »Kein Held.«
»Sei nicht zu bescheiden«, widersprach sie mir mit ihrem starken sizilianischen Akzent. Mit einem Auge zwinkerte sie mir zu, mit dem anderen warf sie einen beiläufigen Blick auf den Mann vorne am Steuerruder. Es war Nelson Todaro, seines Zeichens Underboss. Er war eifersüchtig. Denn eigentlich hatte er neben der Contessa sitzen wollen. Aber sie hatte mich an ihre Seite kommandiert.
Plötzlich griff sich Todaro an den Hals.
Es sah so aus, als wollte er eine Mücke wegwischen.
Caterina und ich achteten nicht darauf. Dafür waren wir zu sehr mit uns selbst beschäftigt. Sie versuchte mit aller Macht, ihre Wirkung auf mich auszutesten. Und ich musste mich anstrengen, so zu tun, als würde ich mich ihren weiblichen Waffen ergeben.
Ihre Kleidung, ein leichter weißer Sommeranzug mit kurzen Hosen, zeigte viel von diesen Waffen.
Nelson Todaro ließ die Hand an seinem Hals, als hätte er dort etwas anderes als eine Mücke entdeckt. Er machte Anstalten, sich zu Caterina und mir umzudrehen. Dabei musste er eigentlich einer Fähre ausweichen, die auf uns zukam.
Viele Freizeitskipper waren auf der Upper Bay unterwegs. Das Weiß der Segelboote und Motorjachten leuchtete auf dem Blaugrau des Wassers. Die obere New Yorker Bucht, in die der Hudson River mündete, war groß genug für alle, einschließlich der Giganten der Berufsschifffahrt.
Todaro neigte sich nach rechts. Dabei fuhr er gar keine Steuerbordkurve. Vielmehr hielt er unseren schnittigen, flachen Flitzer stur auf Geradeauskurs. Warnend ließ der Kapitän des Küstenfrachters das Typhon ertönen.
Todaro zuckte zusammen.
Doch er hatte sich nicht erschrocken. Eher schien es so, als hätte ihm jemand einen Fausthieb zwischen die Rippen verpasst. Noch im selben Atemzug begriff ich, was wirklich geschah.
Es war der Moment, in dem Nelson seine Hand vom Hals sinken ließ. Eine breite, schmierige Blutspur entstand auf der gebräunten Haut, bis hinunter zum weißen T-Shirt. Und er neigte sich weiter nach rechts.
Zwischen seinen Schulterblättern, wo ihn der vermeintliche Hieb getroffen hatte, entstand ein kleiner, bleistiftdicker Blutfluss. Eine Einschussöffnung war die Quelle.
Noch in dem Sekundenbruchteil, in dem ich das Geschehen erfasste, nutzte ich die Tatsache, dass Caterina ihre Arme von der Seite her um meine Schultern geschlungen hatte.
»Runter!«, rief ich und packte sie, riss sie mit mir auf den Teppichboden des Fußraums vor der Hecksitzbank.
Sie sträubte sich nicht, unterstützte mich vielmehr, denn auch sie begriff jetzt, was passierte. Zwei Kugeln schlugen kurz nacheinander in den glasfaserverstärkten Kunststoff des Bootshecks.
Der Bug des Küstenfrachters wuchs auf uns zu, eine haushohe, scharfkantige schwarze Stahlfront. Todaro wankte, schien sich aber festzuklammern, um das Boot auf Kurs zu halten.
»Übernimm das Ruder!«, stieß Caterina hervor.
Ich war bereits unterwegs, robbte von ihr weg, nach vorne. Abermals röhrte das Typhon des Frachters. Wieder wurde Todaro von einer Kugel getroffen. Jetzt fing er an, in sich zusammenzusinken. Ich brauchte noch zwei Schritte, um ihn zu erreichen.
Im Fallen schlug er mit dem Gesicht auf die Armaturenkante, rutschte an dem Steuergehäuse abwärts. Ich spürte, wie das Boot aus dem Ruder zu laufen begann. Es scherte nach Steuerbord aus.
Ich zog die Beine an, stieß mich ab und schnellte auf den Kommandostand zu.
Der Bug des Frachtschiffs wuchs höher und höher. Das Typhon war in einen durchdringenden Dauerton übergegangen. Aus meinem flachen Sprung heraus erreichte ich den Kommandostand.
Direkt vor mir war Nelson Todaro zusammengesunken. Ich war gezwungen, mich mit beiden Händen auf seinem leblosen Körper abzustützen. Als ich mich hochstemmte, sengte ein Geschoss haarscharf über meinen Kopf hinweg. Es war wie ein glühender Kamm, der mir einen neuen Scheitel zog.
Mit einem Schmetterschlag fuhr das Geschoss vor mir in die Kunststoffverkleidung. Das Röhren des Typhons schwoll an. Der Bug des Frachters füllte mein Blickfeld jetzt vollständig. Dabei hatte ich mich noch nicht einmal bis zur Windschutzscheibe hochgezogen.
Ich glaubte bereits, die Bugwelle des Küstenfrachters rauschen zu hören. Wir konnten nur noch einen Steinwurf weit entfernt sein.
Ich kauerte mich neben den reglosen Körper Todaros und streckte die Arme senkrecht hoch. Mit beiden Händen packte ich zu – links das Steuerruder, rechts die Gashebel.
Das Geschehen verdichtete sich zum Chaos. Innerhalb eines Sekundenbruchteils lief ein ganzer Film ab. Ich spähte über die Unterkante der Windschutzscheibe. Der Schiffsrumpf und die mittige Schärfe des Bugs füllten mein Blickfeld voll aus. Es konnten nur noch wenige Yards sein, die uns von dem stählernen Koloss trennten.
Wegen des Rechtsdralls unseres Boots würde er unseren Rumpf an Backbord treffen, etwa in der Mitte.
Ich riss das Steuerruder nach links – und atmete auf. Denn das Boot reagierte schnell und präzise, schwenkte gehorsam. Ein Geschoss zischte an meinem rechten Ohr vorbei und schlug ein Loch in die Windschutzscheibe. Irgendwo, nah vor uns, musste es gegen den Rumpf des Frachters prallen. Aber davon war nichts zu hören, geschweige denn zu sehen. Der Kurswechsel hatte mir das Leben gerettet.
Unser Boot hatte einen Fünfundvierzig-Grad-Winkel zum alles überragenden Schwarz des Frachters erreicht. Jeden Moment würde er uns auf den Grund der Upper Bay rammen.
Mit einem Ruck stieß ich die Gashebel nach vorne.
Die beiden Mercury-Außenborder brüllten in jäher Kraftentfaltung. Zweimal 200 PS trieben den weißen Bug unseres Boots himmelwärts und pressten das Heck tief in die schäumende Hecksee.
Die Beschleunigungskraft der Mercury unterschied sich kaum von der meines Jaguar an Land. Hätte ich mich nicht festgehalten, wäre ich in Richtung Bootsheck geschleudert worden.
Der enorme Vortrieb drückte Caterina mit dem Rücken gegen die Sitzbank. Das Schnellfeuergewehr hielt sie schützend an ihren Oberkörper. Sie hatte es gerade erst aus dem Staufach unter dem Polstersitz geholt. Es war eine Präzisionswaffe von Remington, mit Zielfernrohr und Schalldämpfer ausgestattet.
Mit voller Kraft voraus lenkte ich unser Boot von dem Frachter weg. Das Typhon verstummte. Nach etwa hundert Yards fuhr ich einen erneuten Fünfundvierzig-Grad-Bogen, diesmal nach Steuerbord.
Der mächtige Schiffsrumpf war jetzt rechts von uns. Unser Kurs verlief parallel dazu. Wenn mich nicht alles täuschte, war der Frachter zum natürlichen Schutzwall zwischen uns und den Heckenschützen geworden. Denn die hatten ursprünglich von rechts hinter uns gefeuert.
Ich richtete mich auf und nahm Gas weg. Der Bug unseres Boots senkte sich bis in Horizontallage. Der schwache Wellengang in der Bay erzeugte jetzt ein gleichmäßiges Rattern an der Glätte des Bootsrumpfs.
Mit immer noch zügiger Geschwindigkeit glitten wir dahin, ein Eindruck, der allerdings durch den in entgegengesetzter Richtung fahrenden Küstenfrachter verstärkt wurde.
Caterina rappelte sich auf, hielt das Schnellfeuergewehr am langen Arm. Geduckt eilte sie zu mir nach vorne.
Mit der freien Hand deutete sie nach hinten und stellte fest: »Die sind weg.« Sie legte das Gewehr zu Boden, betrat die untere Stufe zum Kommandostand und beugte sich über Nelson Todaro.
Ich behielt die Umgebung im Auge, damit wir nicht erneut in Havariegefahr gerieten. Als der Frachter vorbei war, schien es, als würden wir auf einen Schlag stillstehen. Ich spähte nach Steuerbord, suchte die Wasserfläche dort mit meinem Blick ab.
In unmittelbarer Nähe, noch im Kielwasser des Frachters, war alles frei. Doch schon in geringer Entfernung begann das Gewimmel von offenen Sportbooten unterschiedlichster Größe, von Kajütbooten und Motorjachten, von kleinen und größeren Seglern.
Und alle hielten respektvollen Abstand von den Überseeriesen.
Ich sah, dass Caterina am Hals Todaros nach dem Puls tastete. Einen Moment später blickte sie zu mir auf. Ihre dunklen Augen waren matt. Sie schüttelte kaum merklich den Kopf, als würde sie durch eine zu heftige Bewegung die Totenruhe stören.
Phil zog seine Waffe, als sich der Fahrstuhl dem fünften Stock näherte. Draußen dämmerte es bereits. Der Mann, den er sich zur Brust nehmen wollte, war ein FBI-Kollege: Inspektor Albert Drummond. Von ihm drohte derzeit die größte vorstellbare Gefahr. Es war widersinnig und doch bittere Realität.
Deshalb gab es keinen Grund mehr, Rücksicht zu nehmen. Phil war fest entschlossen, sich zur Wehr zu setzen, falls ihn Drummond oder etwaige Handlanger angreifen würden. Denn damit musste er rechnen.
Es hatte ihn wie ein Donnerschlag aus heiterem Himmel getroffen, nachdem Drummond plötzlich drüben in Humphrey’s Diner aufgetaucht war und damit gedroht hatte, Jerry und ihn, Phil, in ihren Undercovereinsätzen auffliegen zu lassen.
Als angebliches Motiv dafür wollte er ihnen unterjubeln, dass sie ihren Undercoverjob in Wirklichkeit benutzten, um nicht gegen, sondern für die Mafia zu arbeiten.
Phil hatte sehr rasch herausgehört, was Albert Drummond antrieb, einen derart ungeheuerlichen Kollegenverrat zu begehen. Drummond war geradezu krankhaft neidisch auf die Erfolge, die Jerry und er, Phil, als FBI-Inspektoren erzielt hatten. Das schloss auch ihren Chef, John D. High, in Washington mit ein.
Ihr derzeitiger verdeckter Einsatz an ihrer alten Wirkungsstätte New York lief auch dienstlich unter strenger Geheimhaltung. Doch es war Drummond aufgefallen, dass die Kollegen Cotton und Decker seit nicht genau feststellbarer Zeit, aber mindestens seit mehr als einem Jahr aus dem normalen Dienstbetrieb abgezogen worden waren.
Als FBI-Inspektor verfügte Drummond über genügend Kontakte, um selbst vertrauliche Informationsquellen anzuzapfen.
Auf die Weise hatte er herausgefunden, dass die beiden verhassten Inspektorenkollegen als Ross Oliver und Matt Vincent im New Yorker Gangland aufgetaucht waren.
Ihr Einsatzziel war es, in die Führungsstrukturen der Mafiafamilie Cosentino einzudringen und damit gleichzeitig Zugang zu jenen sogenannten fünf Familien zu finden, die das Organisierte Verbrechen an der nordamerikanischen Ostküste beherrschten.
Der Anlass war klar umrissen. Die Mafia formierte sich neu, nachdem ihr in den Jahren vor dem Anschlag auf das World Trade Center in New York schwere Schläge versetzt worden waren. Nach Nine-eleven hatten sich das FBI und die anderen Ermittlungsbehörden überwiegend auf den Kampf gegen den Terrorismus konzentriert.
Einsätze gegen das Organisierte Verbrechen waren zu sehr vernachlässigt worden.
Die Mafia in all ihren Erscheinungsformen hatte Zeit und Ruhe gehabt, sich neu zu formieren und neue Taktiken und Strategien zu entwickeln. Die blutigen Bandenkriege wie zu Zeiten eines Al Capone in Chicago und eines John Gotti in New York sollten endgültig der Vergangenheit angehören.
Mit dem Tod von Don Lorenzo Cosentino sollte die neue Mafia entstehen. Don Lorenzos Sohn Bob wurde der neue Boss eines Verbrecherimperiums, das auf ein Höchstmaß an gewinnbringenden Geschäftsmethoden setzte – und ein Mindestmaß an Gewalt.
Jerry Cotton und Phil Decker hatten den Auftrag erhalten, die neuen Mafiastrukturen in verdecktem Einsatz auszuforschen. Dafür brachten sie die denkbar besten Voraussetzungen mit, denn nach wie vor waren sie fundierte Kenner der New Yorker Ganglandszene.
Mit größter Sorgfalt hatten sie ihre Legenden aufgebaut. Doch weder sie selbst noch Mr. High in Washington oder sein Nachfolger Steve Dillaggio in New York hatten damit rechnen können, dass jemand aus den eigenen Reihen ihre akribisch konstruierten neuen Identitäten auffliegen lassen würde.
Phil verdrängte die bedrückenden Gedanken und konzentrierte sich auf die Aufgabe, die er sich gestellt hatte, um zu retten, was noch zu retten war.
Er hielt die Beretta auf dem Rücken, unter dem Saum seiner sommerlich leichten Army-Kampfjacke. Die Jeans und die Sneakers, die er dazu trug, waren so alt wie sie aussahen. Schulterlanges Haar und ein Spitzbart vervollständigten sein ungepflegtes Gesamtbild.
Phil war Matt Vincent, Undercoverkumpan seines Dienstpartners Jerry Cotton, der als Ross Oliver in der New Yorker Mafiaszene unterwegs war. Unter ihren Aliasnamen lebten sie seit mehr als einem Jahr in Brooklyn.
Phil alias Matt hatte sich im Gangland überwiegend als Gelegenheitsjobber einen Namen gemacht. Er nahm die Aufträge an, die ihm gefielen. So war er scheinbar zufällig mit Jerry alias Ross zusammengekommen.
Es war ihnen beiden gelungen, das Vertrauen der Familie Cosentino zu gewinnen. Nicht zuletzt dadurch, dass Phil einen Hinweis aus Ganglandkreisen erhalten und Jerry vor der Bombe im Trauerzug gewarnt hatte. Dadurch hatte es Jerry geschafft, die explosive Fracht mitsamt Sattelschlepper im Newtown Creek zu versenken.
Die Cosentinos waren der führende Clan der New Yorker Mafiafamilien. Jerry war zu ihrem Helden aufgestiegen, als er ohne Rücksicht auf sein eigenes Leben gehandelt und vermutlich Hunderten von Trauergästen das Leben gerettet hatte.
Doch wie es aussah, schwebten sie nun beide in akuter Gefahr, aufzufliegen. Schuld daran war kein anderer als der Inspektorenkollege vom FBI, der im fünften Stock dieses Hauses, des Pacifica Hotel in Brooklyn, wohnte.
Ein hochtrabender Name für ein Hotel in diesem Teil der Flatbush Avenue, einer Gegend, die nicht zu den renommiertesten in New York gehörte.
Phil hatte in allen Diners des Viertels herumgefragt, und im Pacifica Diner im Erdgeschoss des Hotels war er fündig geworden. Die Beschreibung des Mannes, den er suchte, passte auf einen Gast des Hauses.
Albert Drummond.
Der Fahrstuhl stoppte ruckend im fünften Stock. Die Türsegmente glitten zur Seite und gaben den Blick frei auf den Vorraum der Zimmerflucht, die sich nach links und rechts erstreckte. Nirgendwo war eine Menschenseele zu sehen. Keine Tür stand auch nur spaltweit offen.
Drummond hatte die Nummer 512. Phil blieb einen Moment stehen und horchte. Doch es herrschte völlige Stille. Die schallschluckenden Fenster an den Korridorenden ließen nicht einmal Straßenlärm durch.
Die 512 war das zweite Zimmer auf der linken Seite. Phil spähte in beide Richtungen und vergewisserte sich, dass ihn niemand beobachtete. Die Mündung zur Decke gerichtet, hob er die Beretta in den Beidhandschlag.
Er erreichte Drummonds Zimmertür. Mit dem Rücken an der Korridorwand schob er sich bis zum Türrahmen vor. Er nahm die Linke vom Pistolengriff und streckte den Arm über die Breite des Türblatts hinweg aus.
Er bekam den Knauf zu fassen.
Und glaubte, seinem Tastsinn nicht trauen zu können.
Der Knauf ließ sich drehen. Die Tür war unverschlossen. Phil schüttelte seine Verblüffung ab und überlegte nicht lange. Die Tür hatte keine Sicherungskette, nur einen Innenriegel, der über den Mechanismus des normalen Schlosses funktionierte.
Mit der gebotenen Vorsicht trat er ein. Seine Blickrichtung und die Visierlinie der Pistole wurden eins. Die in unzähligen Einsätzen geübte Routine war ihm längst in Fleisch und Blut übergegangen.
Und doch war aus der Routine kein Automatismus geworden. Denn jeder Sekundenbruchteil der Unaufmerksamkeit konnte zur tödlichen Gefahr werden.
Das Zimmer war eine Art kleine Suite mit Wohnraum, per Durchgang erreichbarem Schlafraum und einem Bad mit Milchglas in der oberen Türhälfte. Phil folgte der Richtung seiner Waffe bis in alle Winkel und überzeugte sich, dass Drummond nicht zu Hause war. Besuch hatte er auch nicht.
Phil trat an das Fenster des Schlafzimmers. Er ließ die Pistole sinken, hielt sie jedoch schussbereit. Das Fenster zeigte auf den Hinterhof. Zugleich war es der Zugang zur Feuerleiter.
Phil öffnete das Fenster und blickte hinaus. Die Wände der Gebäude umgrenzten den Hof wie ein großer dunkler Schacht. Außer Batterien von Mülltonnen gab es unten nur nackten Betonboden. Nirgendwo bewegte sich etwas.
Durch Fensterglas gedämpft, waren aus einigen der Hotelzimmer Radio- oder Fernsehgeräte zu hören, keine anderen Geräusche.