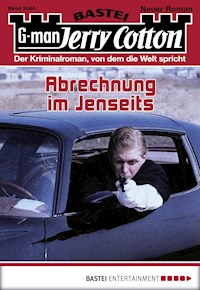1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Krimi
- Serie: Jerry Cotton
- Sprache: Deutsch
Das illegale Geschäft mit verbotenen Psychopharmaka und gefälschten Krebsmedikamenten boomt. In New York gab es zwei konkurrierende Firmen, die eine landesweite Vernetzung anstrebten. Als Rob Freemans geheime Drogenküche in die Luft flog und sein gesamtes Chemikerteam von maskierten Bewaffneten liquidiert wurde, schwor er seinem Rivalen, Jack Massavatis, den er für den Drahtzieher des Anschlags hielt, grimmig Rache. Nachdem Phil und ich den Gangstern auf die Spur gekommen waren, stießen wir auf einen einzigen Zeugen - einen Autisten. Und wir fragten uns, ob es unserer Kriminalpsychologin rechtzeitig gelingen würde, zu dem jungen Mann vorzudringen, bevor weitere Menschen starben ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 138
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
Cover
Impressum
Gift auf Rezept
Vorschau
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige eBook-Ausgabe der beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgabe
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
© 2018 by Bastei Lübbe AG, Köln
Programmleiterin Romanhefte: Ute Müller
Verantwortlich für den Inhalt
Titelfoto: (Film) »Valley of the Dolls«/ddp-images
eBook-Produktion: César Satz & Grafik GmbH, Köln
ISBN 978-3-7325-6513-9
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
www.bastei.de
Gift auf Rezept
»An und für sich ist Sterben die einfachste Sache der Welt«, dozierte der Mann, der, mit einem schneeweißen Keramikmesser in der Hand, vor Sandy Rowe gemächlich hin und her schlenderte. »Das kann jeder, vom blödesten Rauschkind bis zu … Albert Einstein zum Beispiel. Und doch stirbt jeder anders. Der eine legt sich einfach hin und schläft friedlich ein. Der andere krepiert brüllend unter unsäglichen Schmerzen. Man sollte es nicht für möglich halten, mit wie vielen Gesichtern der Tod an uns herantreten kann. Mal ist er freundlich, sanft und nett zu uns. Dann ist er wiederum grausam, herzlos und brutal.«
Das blonde Mädchen, zu dem er sprach, hing kopfüber an einem Haken von der Kellerdecke und hatte wahnsinnige Angst. Es war nackt. Der Mann hatte ihm alles, was es getragen hatte, mit satanischem Genuss vom Leib geschnitten – Minikleid, Push-up-BH, G-String …
Er hielt das Messer grinsend hoch. »Ich liebe dieses Ding«, schwärmte er mit irrem Blick. »Es ist nicht nur formschön, sondern liegt auch gut in der Hand, und die Klinge besteht aus Zirkonoxid, einem sehr hochwertigen keramischen Werkstoff mit bester Schneideeigenschaft. Stahlmesser müssen wesentlich öfter geschliffen werden. Das hier behält seine Schärfe für sehr lange Zeit.«
Sandy Rowe weinte herzzerreißend. »Bitte«, flehte sie verzweifelt. »Bitte … nicht …«
Doch ihre Tränen berührten ihn nicht. Sie war nicht die Erste, die um ihr Leben bettelte. Es hatte ihnen allen nicht geholfen. Wenn sie einmal in seinem Keller waren, konnte sie nichts und niemand mehr retten. Und diesmal würde es nicht anders sein.
»Jerry. Phil«, sagte Helen, die gut aussehende, stets freundliche Sekretärin unseres Chefs, als wir mit Schwung und Elan zur Tür hereinkamen. »Kaffee?«
Mein Partner griente. »Haben wir schon mal Nein gesagt?«
Helen zuckte mit den Schultern. »Ich kann mich nicht erinnern.«
»Wir sagen auch diesmal Ja«, meinte mein Partner.
»Okay. Kommt sofort.«
Ich zeigte auf die Tür, die in Mr. Highs Büro führte. »Wie ist die Wetterlage?«
»Gut«, gab Helen zur Antwort.
»Wunderbar.«
Als wir gleich darauf das Büro unseres Chefs betraten, stellten wir fest, dass er nicht allein war. Dr. Iris McLane leistete ihm Gesellschaft.
Wir mochten und schätzten die groß gewachsene, schlanke Psychologin mit der blonden Kurzhaarfrisur sehr. Sie war Anfang fünfzig.
Zwischen uns stimmte die Chemie, und das war für uns alle sehr angenehm. Wenn es Iris darauf anlegte, konnte sie mit dem offenen Blick ihrer großen blauen Augen jederzeit jeden Mann komplett entwaffnen und voll in ihren Bann ziehen. Wir begrüßten sie und Mr. High und setzten uns zu ihnen an den großen Konferenztisch.
Helen brachte den versprochenen Kaffee. Iris hatte schon einen. Der Chef wollte keinen. Seine Sekretärin zog sich mit kaum hörbaren Schritten zurück.
Mr. High hatte die attraktive Psychologin zu sich gebeten, um ihre jüngsten Erkenntnisse zu einem Fall abzurufen, der uns seit zwei Jahren beschäftigte.
Nicht permanent, aber immer wieder, zwischendurch. Die Mordserie hatte vor fast genau vierundzwanzig Monaten begonnen, und mittlerweile waren dem Killer sieben Frauen aus den verschiedensten Gesellschaftsschichten zum Opfer gefallen – eine junge Anwältin, eine Erzieherin, eine Lagerarbeiterin … Die Medien, die in solchen Fällen immer gleich mit einem griffigen Namen für solche Typen bei der Hand waren, nannten ihn »den Schächter«, weil die Körper der von ihm getöteten Frauen stets völlig blutleer gewesen waren.
Dr. Iris McLane, die sich auf schwere Dissoziationsstörungen spezialisiert hatte, war eine anerkannte Koryphäe auf ihrem Gebiet und gefeierte Autorin mehrerer Fachbücher über Serienkiller, die mittlerweile zu internationalen Standardwerken avanciert waren. Sie hatte viele Jahre für das FBI Field Office in Boston als Profiler gearbeitet, bevor sie zu uns gekommen war. Mr. High hatte sie gebeten, uns zu helfen, das trübe Täterprofil, das wir hatten, zu schärfen, damit es uns endlich gelang, dem grausamen Frauenmörder das Handwerk zu legen.
Iris hatte eine dünne braune Mappe vor sich liegen, in der sich alles befand, was sie aus den bislang vorhandenen Fakten gefiltert hatte.
Nachdem sie einen Schluck Kaffee getrunken hatte, öffnete sie die Mappe und setzte eine Brille auf, die perfekt zu ihrem fein geschnittenen Gesicht passte.
»Ich denke, es handelt sich um einen großen, kräftigen, gut aussehenden Mann mittleren Alters«, begann sie. Wie immer hatte sie dabei, vermutlich unbewusst, einen Zug um die Mundwinkel, der nicht leicht zu deuten war. »Hautfarbe höchstwahrscheinlich weiß. Abgesehen von der stets gleichen Tötungsart lässt sich kein starres Verhaltensmuster erkennen.«
»Wie meinst du das?«, fragte ich.
»Nun, er schlägt zum Beispiel nicht immer an einem Wochenende zu. Zwischen den Morden liegen einmal nur wenige Tage, dann wiederum Wochen. Er holt sich seine Opfer mal hier, mal da, mal dort. Ihre Haarfarbe ist ihm ebenso egal wie ihre Hautfarbe. Wichtig scheint ihm nur ihr Alter zu sein. Von Frauen jenseits der dreißig lässt er die Finger. Finanziell dürfte er keine Sorgen haben. Ich halte ihn für intelligent. Das bedeutet jedoch nicht zwangsläufig, dass er akademisch graduiert sein muss. Aber über eine gute Allgemeinbildung scheint er zu verfügen.«
»Halten Sie ihn für voll zurechnungsfähig?«, warf Mr. High ein. »Weiß er, was er tut?«
Iris schüttelte den Kopf. »Das bezweifle ich, Sir. Mir kommt es eher so vor, als würde er eine Zeit lang völlig normal unter uns leben und irgendwann – ganz plötzlich und für ihn selbst total überraschend – überschnappen.«
»Was lässt Doktor Jekyll von einer Minute zur anderen zu Mister Hyde werden?«, wollte Phil wissen. »Gibt es einen erkennbaren Auslöser? Wodurch schnappt er über? Welcher Umstand legt in seinem Kopf den gefährlichen Hebel um?«
Iris zuckte mit den Schultern. »Das weiß ich leider nicht, Phil.«
Mein Partner kniff die Augen zusammen. »Wieso hat er vor zwei Jahren plötzlich begonnen, Frauen zu ermorden?«
»Vielleicht hatte er einen Unfall – auf der Straße, zu Hause, beim Sport –, der ein Schädel-Hirn-Trauma zur Folge hatte«, nahm die Psychologin an. »So etwas kann die Psyche eines Menschen stark verändern. Möglicherweise war er mal Eishockeyspieler. Auch beim American Football kommen solche Verletzungen häufig vor.«
»Und du meinst, seitdem tickt er nicht mehr richtig?«
»Das wäre jedenfalls eine plausible Erklärung, Phil«, gab Iris zurück.
»Kann es sein, dass er sich in psychiatrischer Behandlung befindet?«, fragte Mr. High.
»Völlig auszuschließen ist es nicht, Sir«, antwortete Iris.
»Kann er geheilt werden?«, erkundigte sich mein Partner.
»Theoretisch ja«, sagte Iris McLane.
Mir schoss ein Gedanke durch den Kopf, der mir überhaupt nicht gefiel. Der Killer hatte vor sechs Wochen zum letzten Mal zugeschlagen.
Nach seinem irren Gesetz musste es bald wieder an der Zeit sein, den nächsten Mord zu verüben – falls er noch nicht geheilt werden konnte.
Als ich diesen unangenehmen Gedanken aussprach, sagte die Psychiaterin mit sorgenumwölkter Stirn: »Daran habe ich auch schon gedacht, Jerry. Es ist ernsthaft zu befürchten.«
»Soll ich dir ein Geheimnis anvertrauen?«, fragte der Killer. »Ich mag dich nicht, Sandy Rowe.« Er lachte. »Da staunst du, was? Das hättest du nicht für möglich gehalten.«
Er gab ihr einen leichten Stoß. Sie schrie ängstlich auf und pendelte langsam hin und her.
»Ich hab dir was vorgespielt«, sagte er selbstgefällig, »hab dich getäuscht und von vorne bis hinten belogen.« Er fuchtelte erregt mit dem Keramikmesser herum. »Die traurige Geschichte von meinem süßen kleinen Hund, den der Retriever meines Nachbarn totgebissen hat, war frei erfunden. Ich habe noch nie einen verdammten Köter besessen. Ich hasse sie genauso wie rollige Katzen – zweibeinige wie vierbeinige.«
Sie pendelte noch immer hin und her.
»Als ich dich im Battery Park angesprochen habe, hast du sofort an Sex gedacht, stimmt’s? Natürlich stimmt es. Leugnen ist zwecklos. Ich hab die Gier in deinen Augen gesehen. Du hast dir gewünscht, von mir flachgelegt zu werden, warst vom ersten Augenblick an scharf auf mich. Schärfer als dieses Messer – und das will etwas heißen.« Er vollführte ein paar nicht besonders elegante Tanzschritte vor ihr und drehte eine Pirouette.
Sie schwieg verbissen.
»Hast du das gesehen?«, fragte er eingebildet. »Ich bin gut, was?« Er blies seinen Brustkorb auf. »Ich könnte Mick Jagger ein paar verdammt coole Moves beibringen … Das … Oder das …« Er zeigte, was er – vermeintlich – draufhatte, übernahm sich und wäre beinahe gestürzt. Sein Blick verfinsterte sich. »Du bist ein dreckiges kleines Luder, Sandy Rowe, weißt du das? Man trägt seine schmutzigen Gedanken nicht so offen zur Schau. Das gehört sich nicht. Aber ich werde dich reinigen. Du wirst absolut sauber vor deinen Schöpfer treten.« Er nickte sehr bestimmt. »Sauber … Seelisch unbefleckt … Blutleer … Komplett ausgeblutet …« Er streckte die Hand aus und stoppte sie. »Hör auf damit. Das macht mich nervös.« Er holte eine hellgrüne Plastikwanne und stellte sie unter sein Opfer.
Sandy schluchzte heftig.
»Sie nennen mich Schächter«, erzählte er ihr, »und ich muss sagen, das gefällt mir, trifft auf das, was ich tue, ziemlich genau zu. Das kann nicht jeder. Das will gelernt sein, ist eine kleine Wissenschaft. Es geht nämlich nicht bloß darum, einem Opfer irgendwie – vielleicht sogar stümperhaft – die Kehle durchzuschneiden. Das ist ein Ritual, das man beherrschen muss und für das sich nicht jeder eignet.« Er ging in die Hocke, um näher bei ihrem Gesicht zu sein. »Es gibt Religionen, die den Verzehr von Blut verbieten«, erklärte er. »Wusstest du das? Nein? Das ist wahr. Das sauge ich mir nicht aus den Fingern.« Er erhob sich wieder und begann, sich zu entkleiden, legte Hemd, Unterhemd, Hose und alles Weitere auf einen Hocker, damit in Kürze keine Blutspritzer darankamen.
Die junge Frau unterdrückte einen Schrei.
»Manche Leute müssen eine intensive Ausbildung, die sowohl den praktischen als auch den geistigen Aspekt ihrer Tätigkeit umfasst, absolvieren, bevor sie ans Werk gehen dürfen. Ich habe mir alles selbst beigebracht. Wenn man nicht ganz blöd ist, begreift man sehr schnell, worauf es ankommt. Den Rest macht die Praxis. Learning by doing. Übung macht den Meister.« Er musterte das verzweifelte Mädchen mit finsterer Miene.
»Nein …«, flüsterte die Kleine.
»Wichtig ist in erster Linie, dass das Messer so scharf wie eine Rasierklinge ist«, fuhr er in schulmeisterlichem Ton fort. »Dann wird mit einem einzigen Schnitt ohne jede Verzögerung die Kehle durchgeschnitten, wobei so rasch wie möglich beide Halsschlagadern, beide Halsvenen, die Luft- und die Speiseröhre sowie beide Vagusnerven durchtrennt werden müssen.« Er zuckte geisteskrank grinsend mit den Schultern und schnalzte amüsiert mit der Zunge. »Das war’s dann auch schon«, sagte er mit merklich veränderter Stimmlage. Ein Zeichen dafür, dass er es gleich tun würde. »Der Rest erledigt sich im Grunde genommen von selbst.« Er nahm das Keramikmesser fester in die Hand.
Sandy Rowes Herz raste wie von Sinnen. Sie sehnte sich nach einer Ohnmacht, doch ihr wurde diese Gnade nicht zuteil. Sie musste alles bei vollem Bewusstsein miterleben – bis zum schrecklichen Ende.
Nach der Besprechung in Mr. Highs Büro kehrten wir an unsere Schreibtische zurück.
»Ich schätze Iris sehr«, sagte Phil. »Wie eigentlich alle in diesem Haus. Sie ist eine wunderbare Frau und eine Expertin für abnorme Verbrecher, hat einen Master in Rechtswissenschaften und Soziologie und einen Doktortitel in Psychologie, sieht umwerfend aus, ist ehrlich, sympathisch, intelligent und kompetent und trägt ihr Herz auf der Zunge …« Er brach seufzend ab.
»Aber?«, fragte ich, damit er weiter sprach.
»Aber was sie sich über unseren Serienkiller zusammengereimt hat, ist, mit Verlaub gesagt und bei allem Respekt, nicht besonders viel.«
»Wir dürfen keine Wunder von ihr erwarten.«
»Das tu ich nicht, aber das meiste von dem, was sie uns erzählt hat, wussten wir schon. Sie hat das bereits vorhandene Gesamtbild nur geringfügig abgerundet.«
»Mehr ist im Moment einfach nicht drin«, meinte ich verständnisvoll.
»Ich mache ihr keinen Vorwurf«, erklärte mein Partner. »Es frustriert mich nur entsetzlich, dass wir in dieser Angelegenheit so gar nicht vom Fleck kommen.«
»Geisteskranke sind immer sehr schwer zu erwischen, weil man sie nicht ausrechnen kann«, erwiderte ich. »Das ist nicht neu für uns, Phil. Sie tun, was ihr Irrsinn gerade von ihnen verlangt, ohne groß darüber nachzudenken, und wissen zumeist erst hinterher – wenn überhaupt –, was sie angestellt haben.«
Phil sah zum Fenster und verzog missmutig das Gesicht. »Ich kriege Magenkrämpfe, wenn ich daran denke, dass er da draußen frei herumläuft und sich vielleicht in diesem Moment in seinem Kopf – klick – ein verhängnisvoller Schalter umlegt. Eben war er noch ganz harmlos unterwegs, genehmigte sich möglicherweise irgendwo einen erfrischenden Longdrink oder leckte genüsslich an einem Softeis, und plötzlich wird er zum gefährlichen Monster, das sich die erstbeste junge Frau krallt, die ihm über den Weg läuft.«
Er nahm das ausgeblutete Opfer vom Haken, legte es auf die billige graubraune Plastikplane, die er in einem großen Baumarkt in Brooklyn gekauft hatte, und sprach dabei mit sich selbst. Mal war er er, mal war er der andere.
»Was hast du schon wieder angestellt?«, fragte er ärgerlich, während er auf die nackte Tote starrte.
»Keine Vorwürfe, okay?« Wenn er der andere war, sprach er etwas höher. »Ich will keine Vorwürfe hören.«
»Ich würde kein Wort verlieren, wenn ich nicht hinterher immer die Drecksarbeit für dich erledigen müsste«, maulte er und wickelte Sandy Rowe in die reißfeste Plane.
»Ich dachte, wir wären Freunde.«
»Ich fühle mich von dir ausgenutzt«, beschwerte er sich, nahm seine Klamotten und zog sie an.
»Wir sind ein Team.«
»Die Lasten sind unfair verteilt«, nörgelte er. »Du hast das Vergnügen, und ich darf für dich die Leichen entsorgen. Wieso machst du das nicht selbst?«
»Ich erledige meinen Teil des Jobs, du deinen. So haben wir es abgemacht.«
»Ich kann mich nicht erinnern, so einem Vorschlag jemals zugestimmt zu haben«, erwiderte er unwirsch.
»Schaff das Mädchen fort.«
»Ich bin nicht dein Lakai!«, protestierte er. »Ich warne dich. Treib’s nicht zu bunt, sonst schmeiße ich alles hin und rühre keinen Finger mehr für dich.«
Er tat aber schließlich doch, was der andere von ihm verlangte. Natürlich befand er sich nicht immer in diesem zwielichtigen Zustand.
Er hatte über weite Strecken hinweg auch viele helle Momente, verfügte über einen intakten Freundes- und Bekanntenkreis, und niemand wusste um dieses besonders düstere Geheimnis, dass er der gefährliche Schächter war, nach dem seit zwei Jahren fieberhaft gesucht wurde.
Verdrossen schleppte er die achte Leiche seines zweiten Ichs aus dem Keller und legte sie in den Kofferraum seines Wagens. Wann er sie fortbringen würde, wusste er nicht, und er hatte auch noch keine Ahnung, wo er sich ihrer entledigen würde. Das überließ er dem Zufall.
Es würde sich in den nächsten Stunden eine Möglichkeit ergeben, die Tote loszuwerden, diesbezüglich machte er sich keine Sorgen. In einer Stadt wie New York gab es unzählige Plätze, die sich bestens dafür eigneten.
Die nächste blutleere Frauenleiche wurde von einem obdachlosen Junkie in einem Abbruchhaus in Brooklyn entdeckt. Der dürre, unrasierte Mann, dessen Alter kaum zu schätzen war, war komplett durch den Wind, als wir vor dem hässlichen Gebäude mit verwitterter Fassade mit ihm sprachen, während drinnen die Kollegen von der Spurensicherung ihren Job so akribisch wie möglich erledigten und jedes Molekül unter die Lupe nahmen.
Sein Name war Lev Kaling. Ausweisen konnte er sich nicht. Angeblich hatte man ihm kürzlich seine Papiere geklaut, als er volltrunken in irgendeinem Hinterhof gelegen hatte. Seine Augen lagen in tiefen Höhlen. Die Wangenknochen traten kantig unter der pickeligen Haut hervor. Ein knöchellanger, zerschlissener Mantel, in dem drei von seiner Sorte Platz gehabt hätten, umhüllte seine jämmerliche Spargelgestalt.
»Wieso treffen alle Schicksalsschläge immer mich?«, greinte Kaling unglücklich. »Was habe ich verbrochen, dass mich der Herr so hartherzig bestraft? Ich habe mein ganzes Leben Pech, immer nur Pech, bin ein kranker Unglücksrabe, der nicht mehr lange zu leben hat …«
»Sagt das der Arzt?«, fragte Phil.
»Ich gehe zu keinem Arzt, kann mir keinen Doktor leisten, weiß selbst, wie es um mich bestellt ist.«
»Alkohol und harte Drogen präsentieren einem irgendwann die Rechnung, wenn man zu leichtfertig mit ihnen umgeht«, sagte ich.
»Wenn man so viel einstecken muss wie ich, kommt man ohne sie einfach nicht zurecht«, rechtfertigte Lev Kaling seinen Drogenmissbrauch. »Ich bin ein Verfluchter.« Er seufzte geplagt. »Manchmal denke ich, ich muss das ganze Unheil dieser Welt auf meinen schmalen Schultern tragen.«
»Können wir über die Tote reden?«, bat ich.
Kaling atmete schwer aus. »Wenn es sein muss.«
»Erzählen Sie uns, was Sie erlebt haben«, forderte ich ihn auf.
»Mir ging es heute Abend ziemlich dreckig. Ich hatte Brechdurchfall, muss wohl was Verdorbenes gegessen haben. Nachdem alles draußen war, habe ich ein bisschen was eingeworfen, um mich besser zu fühlen und wenigstens ein paar Stunden schlafen zu können.« Er zeigte auf das Abbruchhaus. »Ich habe mich da drinnen irgendwo, direkt auf dem Boden, zusammengerollt und war binnen weniger Minuten weg.«
»Und dann?«, fragte mein Partner.