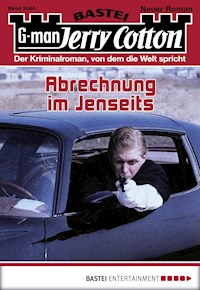1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Krimi
- Serie: Jerry Cotton
- Sprache: Deutsch
Tod eines Lobbyisten
Als sich der Waffen-Lobbyist Shia Morse das Leben nahm, hielt sich das hartnäckige Gerücht, dass er ermordet worden war. Wer schoss sich schon bei geschlossenen Lippen und zusammengepressten Zähnen in den Mund?
Phil und ich wurden auf den undurchsichtigen Fall angesetzt und schon bald von einem Unbekannten gewarnt: Wir sollten uns aus der Sache heraushalten, sonst sei auch unser Leben in Gefahr. Natürlich hielt uns das nicht davon ab, unsere Ermittlungen beharrlich voranzutreiben. Dabei kam uns zu Ohren, dass sich in New York einen Terrorzelle gruppiert hatte, die entweder Anschläge auf öffentliche Einrichtungen oder auf beliebte Touristenattraktionen plante ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 137
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
Cover
Impressum
Tod eines Lobbyisten
Vorschau
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige eBook-Ausgabe der beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgabe
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
© 2019 by Bastei Lübbe AG, Köln
Programmleiterin Romanhefte: Ute Müller
Verantwortlich für den Inhalt
Titelfoto: (Film) »Assault on Wall Street/Bailout: The Age of Greed«/ddp-images
Datenkonvertierung eBook: César Satz & Grafik GmbH, Köln
ISBN 978-3-7325-8703-2
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
www.bastei.de
Tod eines Lobbyisten
Wer billig kauft, kauft teuer, sagt man. Den Waffen-Lobbyisten Shia Morse, der dafür bekannt war, dass er zwar sehr gerne Geld einsteckte, es aber nur höchst ungern ausgab, kostete seine ausgeprägte Sparsamkeit in einer stillen, friedlichen, lauen Juni-Nacht das Leben, denn da bekam er Besuch von zwei Spezialisten, die zuerst seine »preiswerte« Alarmanlage und dann ihn ausschalteten …
Morse war ein Nachtmensch. Wenn andere müde zu Bett gingen, kam er erst so richtig in Fahrt, und damit ging er so manchem Geschäftsfreund mächtig auf den Geist.
Aber das störte ihn nicht. Er hatte noch nie auf jemanden Rücksicht genommen. Deshalb hatte auch seine Ehe nur ein Jahr gehalten.
Doch er weinte Elaine keine Träne nach, denn es hatte sich bedauerlicherweise – oder zum Glück – schon sehr bald herausgestellt, dass sie mit Geld nicht umgehen konnte. Sie hatte es hemmungslos zum Fenster hinausgeworfen. Als würde es täglich nachwachsen wie das Gras im Garten.
Die Scheidung war eine schnelle, glatte Sache gewesen, weil Shia Morse in weiser Voraussicht vor der Trauung auf einen Ehevertrag bestanden hatte.
Deshalb hielt sich der finanzielle Verlust hinterher auch in überschaubaren Grenzen …
In dieser milden Juni-Nacht saß er am Computer und kontrollierte akribisch seine Einnahmen. Das war eine seiner liebsten Beschäftigungen, wenn nicht die liebste überhaupt.
Geld war seiner Ansicht nach nicht dazu da, um sinnlos verschwendet zu werden. Es musste sich vermehren. Nur das machte Freude. Wenn es weniger wurde, hatte man etwas falsch gemacht …
Ein Geräusch drang an Shia Morses Ohr. Er hob alarmiert den Kopf, kniff die Augen zusammen und lauschte. Was war das gewesen?
Eine Ratte? Ein Marder? Ein streunender Hund? Die gefräßige, fette Nachbarskatze, die sich – nicht zum ersten Mal – an einem der Mistkübel zu schaffen machte? Oder …
Morse öffnete die oberste Lade seines Schreibtischs, griff entschlossen nach seiner Beretta und stand auf.
Er hatte kaum Freunde. Feinde hatte er hingegen genug. Elende Neider, die ihm seinen geschäftlichen Erfolg nicht gönnten. Oder Leute, die er mit seiner bisweilen sehr schroffen, rücksichtslosen Art verprellt hatte. Einigen hatte er auch beruflich sehr geschadet.
Kurzum, es gab eine erkleckliche Anzahl von Personen, für die er ein rotes Tuch war, die aus den unterschiedlichsten Gründen nicht gut auf ihn zu sprechen waren.
Einige von ihnen hätten ihn vermutlich auch ganz gerne tot gesehen, doch das kratzte ihn nicht. Damit konnte er leben.
Er verließ das Arbeitszimmer. In seinem Haus war es so still wie in einer Gruft.
Der dreiundvierzigjährige Waffen-Lobbyist sah gut aus und war auch daheim stets tipptopp angezogen – taubengrauer Anzug mit messerscharfen Bügelfalten, dezent gemusterte Krawatte –, Kleider machen schließlich Leute.
Bevor Shia Morse die Terrassentür öffnete, schaute er argwöhnisch durch das Glas. Zu sehen war niemand. Aber das Geräusch …
Dem musste er auf den Grund gehen. Sonst hätte er nicht weiterarbeiten können.
Er streckte die linke Hand nach dem Türgriff aus und drehte ihn langsam, während seine rechte Hand die Beretta fest umschloss.
Seine innere Anspannung wuchs. Jetzt zog er die Tür auf und ging auf die große Terrasse hinaus. Rechts stand eine breite Hollywoodschaukel.
Auf der hatte Elaine gerne gesessen und in teuren Modejournalen geblättert. Er hatte das nie gern gesehen, weil sie immer irgendetwas gefunden hatte, das sie unbedingt – und natürlich auch sofort – haben musste.
Im Moment war die Schaukel zwar leer, aber sie pendelte verdächtig stark vor und zurück. Als hätte sie jemand kurz vor Morses Erscheinen verlassen.
»Wer ist da?«, fragte der Waffen-Lobbyist schneidend. Niemand sollte glauben, dass er sich fürchtete.
Die Terrasse ging flach in ein großes, gepflegtes Grundstück über, und ein breiter Fliederbusch bot den gewünschten Sichtschutz vor neugierigen Blicken aus der Nachbarschaft.
Die Blätter und Zweige bewegten sich verdächtig.
»Komm hervor, du Strolch!«, schnarrte Shia Morse streng. »Ich weiß, dass du da bist!«
Nichts geschah.
»Ich habe eine Schusswaffe!«, ließ Morse den ungebetenen Gast wissen. »Und ich habe keine Skrupel, sie zu gebrauchen! Also – wird’s bald?«
Das Blattwerk teilte sich, und ein langhaariger junger Mann in schwarzen Jeans, weißem T-Shirt und schwarzer Lederjacke zeigte sich. Er trug weiche weiße Sneakers, deshalb waren seine Schritte nicht zu hören.
Damit Morse nicht auf ihn schoss, hob er die Hände und sagte: »Immer mit der Ruhe, Mann. Kein Grund zur Aufregung! Echt nicht. Okay?«
Morse musterte ihn argwöhnisch. »Wer sind Sie? Was wollen Sie? Was haben Sie hier zu suchen?«
»Der Hund meiner Freundin ist abgehauen«, erklärte der Fremde. »Sie wohnt ein paar Häuser weiter die Straße runter. Ich dachte, ich hätte den kleinen Racker durch die Gitterstäbe Ihres Rolltors schlüpfen sehen.« Er sah, dass Morse ihm die Geschichte nicht abkaufte und grinste mokant. »Nicht gut, wie?«
»Gar nicht gut«, zischte Morse. »Ich will die Wahrheit wissen.«
»Ich habe mir gleich gedacht, dass Sie die Hundegeschichte nicht schlucken würden, aber sie war ’nen Versuch wert – finde ich. Die Wahrheit sieht ein bisschen anders aus. Unerfreulich – für Sie. Also vergessen Sie den Hund. Und ich hab auch keine Freundin. Das heißt, ich habe natürlich schon eine, aber sie wohnt nicht hier, sondern in Queens. Der Grund, weshalb wir hier sind, ist ein völlig anderer …«
Shia Morse horchte auf. »Wir? Haben Sie wir gesagt?«
»Oh, habe ich zu erwähnen vergessen, dass ich nicht allein bin? Dann muss ich das wohl nachholen. Wir sind zu zweit, verstehen ein bisschen was von Alarmanlagen. Von Gleichstromtechnik, IR-Technologie, Bus-Technik und all dem Kram. Ihre Anlage hat uns nicht gerade überfordert. Das nur so nebenbei.«
Der Langhaarige schüttelte vorwurfsvoll den Kopf.
»Wie konnten Sie sich nur einen solchen Schrott andrehen lassen? Dieses Sicherheitspaket ist der reinste Mist. Die Anlage war in null Komma nichts ausgeschaltet. Aber zu Ihrem Trost: Wir sind Spezialisten. Wir wären auch mit einem teureren System mühelos fertiggeworden. Schließlich hat man uns das beigebracht. Wie man sieht, zahlt es sich aus, in der Schule aufzupassen. Mein Kumpel steht übrigens direkt hinter Ihnen.«
Morses Blut verwandelte sich in Eiswasser, denn von dieser Story glaubte er dem Langhaarigen jedes Wort.
Er fuhr herum – und drehte sich direkt in einen verflucht harten Schlag, der ihn brutal auf den marmorierten Terrassenboden warf und ihm augenblicklich das Bewusstsein raubte.
Der Mann, der zugeschlagen hatte, war ein Knochenbrecher allererster Güte. »Wo der hinschlägt, wächst kein Zahn mehr«, pflegte man von ihm zu sagen.
Er hatte kein Gewissen, dafür aber stahlharte Muskeln, war groß, kompakt und tödlich. Warum man ihn »Easy« nannte, wusste eigentlich niemand so genau. Nicht einmal er selbst. Vermutlich hatte man seinen Spitznamen davon abgeleitet, dass er seine Jobs immer ziemlich unterkühlt, nüchtern und – eben – easy erledigte.
Frauen interessierten ihn nicht. Männer auch nicht. Er hatte vor zehn Jahren einen Motorradunfall mit katastrophalen Folgen »dort unten« gehabt, und seitdem hatten jene Dinge, die andern Menschen Spaß machten und Befriedigung bescherten, keine Bedeutung mehr für ihn.
Er hatte sich inzwischen daran gewöhnt. Die Sache hatte auch ihr Gutes, wie er fand: Er konnte sich voll und ganz auf seine Arbeit konzentrieren, weil ihn kein animalischer Trieb und kein hormonell gesteuertes Verlangen ablenkte.
»Gut gemacht, Easy«, lobte ihn der Langhaarige grinsend.
»War ’ne leichte Übung«, gab der Kompakte zurück. »Heb seine Beretta auf, Locke!«
Während der Langhaarige die Pistole an sich nahm, hievte Easy den Bewusstlosen hoch und legte ihn sich über die Schulter. Für ihn schien der Lobbyist leicht wie eine hohle Schaufensterpuppe zu sein.
Er trug Shia Morse in die Garage und setzte ihn in seinen Wagen.
Lockes Handy vibrierte so laut, dass Easy es hörte. »Verdammt, warum hast du das Ding nicht abgeschaltet?«
»Der Anruf könnte wichtig sein.« Locke holte sein Smartphone hervor.
»Und?«, fragte Easy. »Ist er wichtig?«
»Für mich schon.« Locke zeigte ihm ein gestochen scharfes Foto von seiner neuesten, sehr leicht bekleideten Flamme. Eigentlich war sie fast völlig nackt. Ihr Anblick hätte bei so manchem gesunden Mann wahre Fieberschübe ausgelöst.
Easy wackelte vorwurfsvoll mit dem Kopf. »Du immer mit deinen Weibergeschichten.«
»Man hat schließlich auch noch ein Privatleben«, gab Locke anzüglich schmunzelnd zurück. Du natürlich nicht, dachte er. Weil sie dir damals einige wichtige Parameter abgeschnitten haben. Doch das behielt er für sich, weil er nicht wollte, dass Easy ihm den Kopf von den Schultern schlug.
Er drückte die scharfe Lady weg, würde sie später zurückrufen und vielleicht auch noch treffen, wenn es sich irgendwie einrichten ließ.
Die Nacht ist ja noch jung, dachte Locke. Lorraine und ich sind es auch. Und verflucht heiß aufeinander. Und diese Hitze muss von Zeit zu Zeit raus, damit sie uns nicht verbrennt.
Easy richtete sich auf. »Da sitzt er nun, der arme, bedauernswerte Hund«, sagte er, als hätte er Mitleid mit Morse, in Wirklichkeit aber empfand er überhaupt nichts für den Mann. »Er hat ’ne Menge Zaster verdient, doch wie man sieht, macht Geld allein nicht glücklich.« Seine Lippen wurden schmal. »Deshalb hat er auch genug von seinem beschissenen Lobbyistenleben. Er möchte es nicht mehr fortsetzen. Ist verzweifelt. Kann nicht mehr. Will nicht mehr. Wirft das Handtuch. Zieht die Reißleine. Gibt auf. Schießt sich mit der eigenen Beretta in den Mund.« Er sah seinen Komplizen an. »Denk an deine Fingerabdrücke, Locke.«
»Bin ich ein Anfänger?«
»Ich will’s nur gesagt haben.«
Der Langhaarige holte ein Taschentuch hervor und polierte die Pistole des Lobbyisten blank, bevor er sie ihm in die schlaffe Hand legte.
Easy nickte. »Gut so, Kumpel.« Er feixte. »Ich glaube, du musst ihm ein wenig zur Hand gehen. Im Moment sieht es nämlich nicht so aus, als wäre er selbst in der Lage, seiner Todessehnsucht zum gewünschten Erfolg zu verhelfen.«
»Den kleinen Freundschaftsdienst erweise ich ihm natürlich gerne«, sagte Locke zynisch. »Man ist schließlich kein Unmensch.«
Er nahm die Hand des Bewusstlosen, hob sie, setzte die Beretta an und sorgte dafür, dass der Lobbyist abdrückte.
Mit dem Knall schien sich der Wagen mit Blut zu füllen.
Easy trat zurück. »Igitt, was für eine Sauerei.«
»Ein Herzschuss wäre sauberer gewesen«, gab Locke seinem Komplizen recht. »Aber er wollte es – davon gehe ich mal aus – auf diese Art machen, und des Menschen Wille ist bekanntlich sein Himmelreich.«
Sie verließen die Garage.
Das Handy des Langhaarigen vibrierte erneut, doch es war nicht wieder Lorraine, die mit ihm an diesem Abend noch etwas ganz Bestimmtes im Sinn hatte, sondern der Mann, der Locke und Easy zu Shia Morse geschickt hatte.
»Wo seid ihr?«, wollte er wissen.
»Am Einsatzort.«
»Heißt das, die Sache ist erledigt?«
»Das heißt es«, bestätigte Locke. »Und zwar höchst positiv.«
»Ist er …«
»Im Himmel«, sagte Locke. »Oder in der Hölle. So genau weiß ich das nicht. Auf jeden Fall weilt er nicht mehr unter uns.«
»Ich werde für ihn eine Kerze anzünden.«
»Er würde sagen, dass das rausgeschmissenes Geld ist.« Der Langhaarige lachte. »Er war ja ein ziemlicher Geizkragen.«
»Macht euch vom Acker.«
»Das haben wir vor.«
»Aber achtet darauf, dass euch niemand sieht.«
»Wir werden unsere Tarnkappen aufsetzen«, versprach Locke und beendete das Gespräch.
Tags darauf stand es in allen Zeitungen: Der Waffen-Lobbyist Shia Morse hatte sich das Leben genommen. Auch Hörfunk und Fernsehen berichteten über den unbegreiflichen Suizid.
Ich legte die New York Post – sie ist eine der ältesten Tageszeitungen der USA – auf meinen Schreibtisch, zeigte auf den üppigen Bildbericht und sagte zu Phil, der mir gegenübersaß: »Was sagt man dazu?«
»Was willst du hören, Jerry?«, fragte mein Partner.
»Shia Morse … Wohlhabend … Ein Mann in den besten Jahren … Erfolgreich … Kerngesund … Freitod …« Für mich passte das irgendwie nicht zusammen.
»Ich hab’s gelesen«, sagte Phil.
»Was ist da schiefgelaufen?«
»Keine Ahnung.« Phil zuckte mit den Schultern. »Vielleicht kommt es irgendwann ans Tageslicht. Auf jeden Fall müssen wir uns nicht darum kümmern. Dafür sind andere zuständig, nicht das FBI.«
Ich rümpfte die Nase, als würde ich einen Kabelbrand riechen. »Mir schmeckt die Sache nicht.«
»Du brauchst sie ja nicht zu essen.«
»Daran ist irgendwas faul.«
»Wer sagt das?«, wollte Phil wissen.
»Mein Bauch.«
Mein Partner schmunzelte. »Na, dann.«
Eine halbe Stunde später erschien Zeerookah in unserem Büro. Er sah wie immer wie aus dem Ei gepellt aus. Sein silbergrauer Anzug musste ein Vermögen gekostet haben. So viel Geld gaben normalerweise nur Leute wie George Clooney oder Brad Pitt für Klamotten aus.
»Der Waffen-Lobbyist Shia Morse hat sich angeblich in seiner Garage umgebracht«, sagte Zeery.
»Wissen wir schon«, gab Phil lakonisch zurück. »Wieso angeblich?«
»In der Stadt hält sich das hartnäckige Gerücht, dass es kein Selbstmord war«, berichtete unser indianischer Kollege.
»Sondern?«, fragte Phil.
»Mord«, antwortete Zeerookah.
Ich warf Phil einen bedeutungsvollen Blick zu. Siehst du, sollte das heißen.
»Mord«, wiederholte Phil. »Wie kommen die Leute auf so was?«
»Mit Waffen ist eine Menge Geld zu verdienen.«
Phil lächelte schmal. »Du erzählst uns nichts Neues, Zeery.«
»Es gibt kriminelle Interessensverbände, mit denen nicht gut Kirschen essen ist«, fuhr der Indianer fort. »Um die Waffenverbreitung anzukurbeln und Rüstungs- und Exportkontrollen entweder zu lockern, zu verhindern oder zu umgehen, nehmen manche Typen extrem viel Schmiergeld in die Hand, und wenn das nichts bringt, gehen sie auch schon mal eiskalt über Leichen.«
»Da bin ich ganz bei dir, Zeery«, sagte Phil. »Aber in Morses Fall …«
»Warum hat er sich in der Garage erschossen und nicht in seinem Haus?«, fragte der Indianer.
Phil lehnte sich zurück. »Die Garage ist ein Teil seines Hauses«, sagte er.
»Warum setzt er sich in seinen Wagen?«, fragte Zeerookah weiter.
»Man kann ihn nicht mehr fragen«, gab Phil trocken zurück. »Vielleicht wollte er nicht, dass in seinem Haus alles voller Blut ist.«
»Das kann einem Selbstmörder doch egal sein.«
»Vielleicht war Morse ein Ästhet.«
»Es gibt keinen Abschiedsbrief«, fuhr Zeerookah fort.
Ich hörte ihm und Phil interessiert zu.
Mein Partner sagte: »Er hatte keine Angehörigen, war geschieden, lebte allein. Für wen hätte er einen Abschiedsbrief hinterlassen sollen? Möglicherweise war der Selbstmord auch eine spontane Entscheidung – eine Kurzschlusshandlung.«
Zeerookah schüttelte den Kopf. »Ich sage dir, der Mann wurde gekillt. Wer schießt sich schon bei geschlossenen Lippen – durch die Zähne – in den Mund?«
Darauf hatte Phil keine vernünftige Antwort. Und eine weitere halbe Stunde später beorderte Mr. High, unser unmittelbarer Vorgesetzter, uns in sein Büro.
Normalerweise hat Helen, die gut aussehende, dunkelhaarige, tüchtige und immer freundliche Sekretärin unseres Chefs, einen erlesenen Geschmack, was ihr Büro-Outfit anbelangt, doch diesmal hatte sie eindeutig danebengegriffen.
Grundgütiger. Ihr Hosenanzug war ein absolutes No go. Zu weit, zu asymmetrisch, zu bunt, zu surreal. Ich fragte mich unwillkürlich, wer ihr das aufgeschwatzt hatte. Ein Freund – oder eine Freundin – konnte das nicht gewesen sein. Wenn sie etwas auffallend Schönes, das hervorragend zu ihrem Typ passte, trug, sparte ich nicht mit ehrlicher Bewunderung, doch zu einem verlogenen Lob hätte ich nicht stehen können, deshalb hielt ich lieber den Mund.
Auch über Phils Lippen kam kein falsches Kompliment. Er sprach lieber über das Wetter, und als Helen »Kaffee?« fragte, antworteten wir zeitgleich: »Ja, bitte.«
Dann verschwanden wir in Mr. Highs Allerheiligstem.
»Jerry. Phil«, begrüßte uns unser Chef. »Haben Sie Helens Hosenanzug gesehen?« Er bot uns Platz an.
Wir setzten uns.
»Wir haben nicht so sehr darauf geachtet«, schwindelte mein Partner.
»Was halten Sie davon?«, wollte John D. High trotzdem wissen.
Phil hob abwehrend die Hände. »Ich möchte mich nicht dazu äußern, Sir.«
»Ich auch nicht«, sagte ich.
Mr. High nickte. »Ich verstehe.« Das war ihm Urteil genug.
Er wechselte das Thema, und mich wunderte es, ehrlich gesagt, nicht, dass er über den Tod des Waffen-Lobbyisten Shia Morse sprach. Schließlich war die Begebenheit an diesem Tag brandaktuell und in aller Munde.
Helen – die ungekrönte Coffee Queen – brachte den Kaffee und kehrte gleich wieder ins Vorzimmer zurück.
Ich hatte den Eindruck, dass wir diesen schockierenden Hosenanzug ganz bestimmt nicht noch mal sehen würden.
»Shia Morse hat sich nicht selbst umgebracht«, eröffnete uns der Chef, ein schlanker Mann mit silbergrauem Haar, schmalem, markant geschnittenem Gesicht und den feingliedrigen Händen eines Pianisten. »Er wurde ermordet. Das ist inzwischen erwiesen. Man hat auf seiner Terrasse Blutspuren gefunden. Er wurde dort niedergeschlagen, in die Garage getragen und in seinen Wagen gesetzt.«
»Wozu dieser Aufwand?«, fragte Phil und trank einen Schluck Kaffee.
Mr. High hob die Schultern. »Viele Selbstmörder nehmen sich in ihrer Garage das Leben. Einige atmen die Abgase ihres Wagens ein, andere schießen sich eine Kugel in den Kopf … Scheint so, als wären Garagen ein klassischer Suizid-Ort. Man ist dort allein und ungestört. Niemand im Haus bekommt zu früh mit, was man vorhat, und kann den Plan dadurch auch nicht vereiteln.«