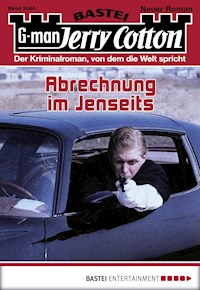1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Krimi
- Serie: Jerry Cotton
- Sprache: Deutsch
Wer mit Blut zahlt ...
In Brooklyn tauchten im Abstand von drei Wochen zwei verstümmelte Leichen am Straßenrand auf. Aus den Körpern der Opfer war jeweils ein Stück Fleisch herausgeschnitten worden. Schnell fanden Phil und ich heraus, dass die Opfer finanzielle Probleme gehabt hatten. Waren sie tatsächlich wegen offenstehender Rechnungen ermordet worden? Aber was hatte es mit dem entnommenen Fleisch auf sich? Es war ein mehr als rätselhafter Fall ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
Cover
Impressum
Wer mit Blut zahlt …
Vorschau
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige eBook-Ausgabe der beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgabe
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
© 2019 by Bastei Lübbe AG, Köln
Programmleiterin Romanhefte: Ute Müller
Verantwortlich für den Inhalt
Titelfoto: peeterv/iStockphoto
Datenkonvertierung eBook: César Satz & Grafik GmbH, Köln
ISBN 978-3-7325-8853-4
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
www.bastei.de
Wer mit Blut zahlt …
Das Licht der Glühbirne an der unverputzten Decke pulsierte wie ein Alarmsignal.
Brad atmete schwer durch und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Obwohl es in dem verdammten Kellerloch so kalt und feucht war, dass einem die Knochen wehtaten, hatte ihn die Arbeit erhitzt. Oder besser gesagt, die Art der Arbeit. Denn es war keineswegs natürlich, einem Menschen, der kerngesund war, einen Muskel aus dem Bauch herauszuschneiden. Für so was brauchte man starke Nerven, und Brad fragte sich unwillkürlich, ob er sich nicht ein weiteres Mal übernommen hatte.
Er streckte die Hände aus und sah, dass sie zitterten.
Dann blickte er wieder auf den nackten Körper auf dem Stahltisch.
Überall Blut. Die Frau hatte zu viel davon verloren. Sie war tot.
Ein beschissener Kunstfehler!
In diesem Moment wünschte sich Brad, er hätte sein Medizinstudium damals nicht abgebrochen.
Ihm wurde übel. Er wich von dem Tisch mit dem Toten zurück, beugte sich vor und erbrach sich unter Krämpfen auf den mit Sägespänen bedeckten Betonboden.
Manchmal überlagerten sich die Bilder im Kopf. Man wusste nicht mehr genau, was man wirklich gesehen hatte und was nur in der Einbildung existierte.
So erging es mir mit Miss Mandy Morock an diesem Morgen Ende November. Soweit man es nach ihrem jetzigen Zustand beurteilen konnte, musste sie eine sehr attraktive Person gewesen sein. Ihr bleiches Gesicht mit den trüben, blickleeren Augen war perfekt proportioniert.
Ich befand mich real zwar im gut gewärmten, hell ausgeleuchteten Raum des Kings County Hospital Center, in dem die Obduktion ihrer Leiche vorgenommen wurde. Zugleich aber geisterten die Bilder durch meinen Kopf, die die Schilderung von der Entdeckung der Toten in mir hervorgerufen hatten.
Konnte es etwas Einsameres geben als eine verstümmelte Tote, morgens um sechs, auf einer von Dreck übersäten Nebenstraße in Bushwick?
An den Rand gespuckt wie Abfall von einem unerbittlichen, launigen Schicksal.
Entdeckt von einem kleinen Mädchen, das seine neun Monate alte Schwester in einem klapprigen Kinderwagen vor sich herschob.
Ein schwarzes Mädchen, zehn Jahre alt, in einem dünnen Sommerkleidchen. Bei fünf Grad minus auf der Flucht vor seinen gewalttätigen Eltern, die sich zu Hause eine Faustschlacht geliefert hatten.
Ein tapferes Mädchen, das sofort eine Anwohnerfamilie aus dem Schlaf geklingelt und sie aufgefordert hatte, die Polizei zu verständigen.
Das war gestern, am Sonntag, gewesen.
Noch am Abend war die Entscheidung gefallen: Die Sache war ein Fall für das FBI. Denn neun Monate zuvor hatte es in Saint Louis, im Bundesstaat Missouri, einen ähnlichen Fall gegeben. Ein Theater- und Filmagent namens Randolph Oatis war auf dieselbe Weise getötet worden wie Miss Morock. Und vor nicht ganz zwei Wochen hatte man an einer Straße in Bedford Stuyvesant den zweiunddreißigjährigen Vermögensverwalter Al Perquinno gefunden.
Allen drei Opfern hatte man einen Muskel aus dem Bauch entfernt, alle drei waren verblutet.
Phil befand sich in diesem Moment in Saint Louis, wo er die Mutter von Randolph Oatis besuchte.
Ich konzentrierte mich wieder auf die Person, die vor mir lag und die einmal Miss Morock gewesen war.
Die weiße Gewebeplatte des Bauches bot sich immer noch ungeschützt dar.
Doc Wesley – ein spindeldürrer Pathologe mit lichtem, gescheiteltem Haar und nervösem Augenzucken – hatte seine Untersuchung beendet und wusch sich ausgiebig die Hände.
Zuvor hatte er seine Latexhandschuhe umständlich von den langen Fingern gezupft.
Ich schätzte ihn auf Anfang sechzig.
»Der Täter hat mit einem Skalpell die Bauchdecke geöffnet«, referierte er. Seine hohe Stimme war seltsam monoton und ausdruckslos. »Anschließend präparierte er die Haut zur Seite. Dann legte er den Rektusmuskel frei und schnitt ihn heraus. Er wusste, was er tat. Andererseits hat er unpräzise gearbeitet, weshalb die Frau verblutet ist. Eigentlich hätte sie diese Operation überleben müssen.«
»Was schließen Sie daraus?«, fragte ich.
»Ich denke, dass er entweder in keinem guten Zustand war oder einfach ein miserabler Chirurg.«
»Hatte er Hilfe?«
Wesley zuckte gleichmütig mit den Schultern. »Vermutlich schon, jemanden, der ihm zumindest bei Anästhesie und Blutstillung zur Hand ging.«
Er trocknete seine Hände sorgfältig an einem schneeweißen Handtuch ab, das an einer Chromstange neben dem Becken hing. Anschließend warf er es in einen Plastikbehälter, besprühte die Hände mit einem Desinfektionsmittel und betrachtete sie ausgiebig, als wären sie Gegenstand eines eigenen Forschungsprojekts.
Er vermittelte mir den Eindruck, als seien seine eingeübte Rituale der eigentliche Sinn der Leichenschau und die Ergebnisse ein Nebenprodukt. Aber wahrscheinlich tat ich ihm mit dieser Einschätzung Unrecht.
»Sie haben vor Kurzem die Leiche von einem Mann namens Al Perquinno untersucht«, sagte ich.
»Dieselbe Vorgehensweise«, erklärte Wesley mürrisch, als ärgere er sich über die Ungeschicklichkeit des Killers. »Mit Sicherheit handelt es sich in beiden Fällen um denselben Täter. Es gibt keinen erkennbaren Grund dafür, einen funktionierenden Rektusmuskel zu entfernen. Auf eine solche Idee kommen nicht viele.«
Er dachte einen Augenblick nach.
»Soviel ich weiß, ist es doch in Saint Louis genauso gelaufen, oder?«, fragte er dann.
»Ja«, bestätigte ich.
»Der Bursche hat wohl eine Vorliebe für bizarre Prozeduren.«
»Sie glauben, er ist ein Psychopath?«
»Nennen Sie ihn, wie Sie wollen, Cotton. Es ist Ihre Aufgabe, Rückschlüsse zu ziehen, nicht meine.«
Er zog scharf die Nase hoch, versenkte die Hände in seinen Hosentaschen und sah mich zum ersten Mal, seitdem ich den Raum betreten hatte, direkt an. Ich ahnte, dass er zu einem grundsätzlichen Statement ansetzte.
»Ich mache diesen Job seit zwanzig Jahren. Wissen Sie, was mich ankotzt? Ich sag’s Ihnen. Ich habe Hunderte von Toten gesehen, wollte helfen, herauszufinden, wer sie getötet hat. Aber mit jedem neuen Toten, der auf meinem Tisch liegt, wächst mein Pessimismus. Die Menschen werden nicht aufhören, einander zu töten, ganz gleich, ob ich meine Arbeit mache oder nicht. Ich komme mir vor wie ein gottverdammter Fließbandarbeiter. Eine erniedrigende Vorstellung, nicht wahr?«
»Ja.« Ich nickte. »Aber sie beruht auf einer falschen Annahme.«
»Finden Sie?«
»Wie Sie es darstellen, laufen da draußen nur Leute rum, die scharf darauf sind, anderen das Lebenslicht auszublasen. Aber die meisten sind anständig, Wesley. Die Bösen sind die Ausnahmen.«
Er blickte mich einige Sekunden lang stumm an.
»Ja, so ist es wohl«, erwiderte er dann. »Verzeihen Sie mir, aber ich habe heute einen schlechten Tag. Ich wollte nicht so übellaunig rüberkommen.«
»Ist schon gut.« Ich winkte ab. »Jeder von uns kennt diese Tage. Sie sind der Preis für das, was wir machen.«
Er lächelte dankbar, kam auf mich zu und streckte mir die Hand hin. Sein Griff war zupackend.
»Jedenfalls hoffe ich, dass Sie diesen Dreckskerl schnappen«, knurrte er.
»Verlassen Sie sich darauf, Doc!«
Ich ging zur Tür.
»Übrigens«, sagte Wesley, ehe ich sie öffnen konnte, »ich bin nicht davon überzeugt, dass unser Killer komplett irre ist. Vielleicht hat er nur einen Auftrag erledigt.«
»Wie kommen Sie darauf?«
»Na ja, wenn ich es mir recht überlege, habe ich vorschnell geurteilt.«
»Sie machen mich neugierig.«
»Es mag sich komisch anhören, aber ein perverser Mörder wäre in gewisser Weise behutsamer mit seinem Objekt umgegangen, hätte ihm mehr Aufmerksamkeit geschenkt.«
»Das kling in meinen Ohren tatsächlich absurd.«
»Lassen Sie es mich anders formulieren, Cotton. Der Bursche hat nicht gern getan, was er tat. Er wollte diese ganze Prozedur schnell hinter sich bringen, das ist jedenfalls mein Eindruck.«
Erst als ich fünf Minuten später das Gebäude verließ, dämmerte mir, dass Doc Wesley ein gewiefter Psychologe war, dem ich möglicherweise einen wertvollen Hinweis zu verdanken hatte. Und dass er es noch lange nicht aufgegeben hatte, die Welt zu einem besseren Ort zu machen.
»Was ist los mit dir, Mimo?«, fragte John Plunkett besorgt.
»Kein Geld, nicht mal für die Heizung!«, maulte Domingo Morales, der seinen Spitznamen hasste, weshalb seine smaragdgrünen Augen Plunkett jetzt wütend anfunkelten.
Sie hockten auf wackligen Stühlen, ihre Textbücher in den Händen. Auf der von fadem Licht nur notdürftig erhellten, leeren Bühne des Star Stage, eines kleinen, altmodischen Theaters mit neunzig Sitzplätzen im Norden von Bedford-Stuyvesant. Auf dem Programm stand Lenny, ein neues Stück mit schlechten Dialogen und einer an den Haaren herbeigezogenen Story.
Übermorgen war Premiere, und Plunkett graute es vor diesem Tag. Er rechnete für die ganze anderthalbstündige Vorstellung mit maximal fünf Lachern auf Seiten des Publikums, was für eine Komödie den sicheren Untergang bedeutete.
»Außerdem sollst du mich nicht immer Mimo nennen«, beklagte sich Morales.
»Ist halt dein Künstlername.«
»Ja, aber das ist zehn Jahre her. Da war ich noch beim Zirkus, und niemand hat sich was dabei gedacht, mich einen Zwerg zu nennen. Stand sogar auf den Plakaten. ›Mit wilden Tieren, Akrobaten und dem Zwerg Mimo.‹ Mann, war das Scheiße damals, für alle nur den Freak zu machen!«
»Okay, Mimo.«
»Hör auf mit dem Mist, Fettklops!«
Am liebsten wäre Plunkett jetzt von seinem Stuhl aufgesprungen, um Morales eine schallende Ohrfeige zu versetzen. Er tat es aus zwei Gründen nicht.
Erstens, weil es ihm einfach nicht fair erschien, einen Mann zu schlagen, der keine fünf Fuß maß. Hinzu kam, dass Plunkett mit seinen hundertvierzig Kilogramm ein enormes Kampfgewicht auf die Waage brachte.
Zweitens, weil Plunkett Morales für so etwas Ähnliches wie einen Freund hielt. Was nicht unerheblich war, wenn man bedachte, wie es in der Theaterwelt so zuging. Da klopfte man sich gegenseitig ausdauernd auf die Schultern, herzte und küsste sich und war sich zugleich völlig gleichgültig oder spinnefeind.
Das war jedenfalls Plunketts Erfahrung.
Und da gab es noch etwas … Plunkett wusste, dass Morales’ Lamento wegen der ausgefallenen Heizung nur ein Mittel war, um Spannung abzubauen. Er ahnte, was Morales zutiefst beunruhigte, und beschloss, ihn darauf anzusprechen.
»Du machst dir Sorgen, stimmt’s?«
»Na klar, wir brauchen dringend einen Erfolg, John! Die letzte Produktion haben die Kritiker uns um die Ohren gehauen. Noch so ein Flop, und wir können einpacken.«
»Das meine ich nicht. Ich rede von dem Artikel in der New York Post.«
Er war vor zehn Tagen erschienen, und seitdem wirkte Morales verstört. Seit zwei Tagen litt er jedoch unter regelrechten Panikattacken.
Der Kleine erstarrte kurz. Dann ließ er sein Textbuch fallen und hob schwer den Kopf, als laste das gesamte Gewicht der Welt auf seinen schmalen Schultern.
»Du hast ihn also auch gelesen?«, hakte Plunkett nach.
»Hm.«
»Es ist purer Zufall, Mimo, nichts anderes.«
»Mag sein«, erwiderte Morales, ohne den Gebrauch seines Spitznamens weiterhin zu beanstanden. »Aber was, wenn mehr dahintersteckt?«
Sie schwiegen beide.
Plunkett stimmte Morales insgeheim zu. Wenn man sehr viel Fantasie aufbrachte, konnte man auf diese Idee kommen. Erst recht, wenn man eine Neigung zur Hysterie hatte.
Kurz vor dem Umzug der Drama Kings nach New York waren sie noch mit der abgespeckten Version eines Shakespearedramas auf Tournee gewesen. Der Kaufmann von Venedig enthielt ein zentrales Motiv, das selbst ungebildeten Zeitgenossen ein Begriff sein musste. Es ging um ein Pfund Fleisch, das die Titelfigur Shylock als Garantie für die Vergabe eines Kredits forderte.
Es war nachvollziehbar, dass der Artikel vor anderthalb Wochen Morales an das Drama erinnert hatte. Man hatte am Straßenrand in Brooklyn eine Leiche entdeckt, die auf merkwürdige Weise verstümmelt gewesen war: Der Täter hatte ihr einen Muskel aus dem Bauch entfernt.
»Es ist mehr als unwahrscheinlich, Mimo.«
»Trotzdem, John. Ein Stück Fleisch! Herausgeschnitten aus dem Körper! Ich werde den Gedanken nicht los, dass einer unserer Besucher sich Shylock zum Vorbild auserkoren hat. Wäre das nicht schrecklich, wenn wir Schauspieler im Gehirn von Menschen solche Dinge auslösen könnten?«
Plunkett legte seinen feisten Arm fürsorglich um Morales’ Stuhllehne. Fast im selben Augenblick fiel ihm ein, dass eine solche Geste erdrückend wirken musste. Er zog den Arm zurück und verschränkte seine wulstigen Hände im Schoß.
»Ich habe keine Ahnung, was so ein Muskel wiegt«, brummelte er verlegen. »Ich meine, ob das mit dem Pfund überhaupt hinhaut.«
»Als ob es darauf ankäme!«, erregte sich Morales. »Manchmal bist du ein verdammter Esel, John. Denkst nur von hier bis da. Als ob es auf ein paar Gramm mehr oder weniger ankäme! Schon mal was von Symbolen gehört? Immerhin bist du am Theater.«
Plunkett riss der Geduldsfaden. Er wuchtete sich mühsam auf die Beine und baute sich breitbeinig vor Morales auf.
»Reiß dich gefälligst zusammen, Mimo! Du raubst einem den letzten Nerv mit deinen ewigen Ängsten. Jede Sekunde fällt dir was Neues ein, was dich verrückt macht. Die Kollegen gehen dir schon aus dem Weg deshalb. Ich bin der Einzige, der dich noch erträgt, ist dir das überhaupt klar?«
Morales hopste von seinem Stuhl herunter und lief zur Bühnenrampe vor.
»Wenn ihr uns stecht, bluten wir nicht?«, rief er mit theatralischer Gebärde in den leeren Zuschauerraum. »Wenn ihr uns kitzelt, lachen wir nicht? Wenn ihr uns vergiftet, sterben wir nicht?«
Es war der Text aus dem Kaufmann von Venedig, mit dem sie auf ihrer Tournee für den Besuch einer Vorstellung des Stücks geworben hatten.
Morales benutzte das Zitat häufig, wenn er das Gefühl hatte, dass man ihn wegen seiner geringen Körpergröße verachtete. Und genau deshalb erboste es Plunkett, dass Morales ihn damit attackierte. Schließlich brachte er Morales mehr Respekt entgegen als irgendein anderer Mensch auf diesem Planeten.
Schnaufend stampfte er auf Morales zu, um ihm gehörig die Meinung zu geigen.
Ein hässliches Quietschen ließ ihn innehalten. Im Hintergrund der Bühne, dort, wo das Deckenlicht nicht hinreichte, war ein Flügel der schweren Eisentür geöffnet worden. Es dauerte einige Sekunden, bis erkennbar wurde, wer sich da näherte.
»Hey, Fred!«, sagte Plunkett.
»Schön, euch bei der Arbeit zu sehen«, erwiderte der Angesprochene, ein großer Mann mit widerspenstigem, nach hinten gebürstetem Rothaar über der hohen Stirn.
Das längliche Gesicht wies an den Wangen tiefe Kerben auf. Der schmallippige Mund war nur ein Strich über dem ausladenden Kinn. Unter buschigen, hochgezogenen Brauen starrten weit aufgerissene, helle Augen forschend heraus.
»Ich wollte euch nicht stören«, sagte Fred Flanagan.
»Tust du nicht, Fred«, beeilte sich Plunkett zu versichern.
Der Direktor der Drama Kings war sein großes Vorbild. Er schwärmte sogar ein bisschen für ihn. Leider aussichtslos, denn Flanagan machte sich erotisch nichts aus Männern.
»Ich nehme an, ihr wisst es noch nicht?«, erkundigte sich Flanagan.
»Keine Ahnung, wovon du sprichst«, sagte Morales, der sich jetzt neben Plunkett stellte.
»Es kam eben in den Nachrichten von Good Morning America. Es gibt eine dritte Shylock-Leiche, diesmal eine Frau.«
Das Erste, was Plunkett dachte, war, wie der Kleine die Nachricht wohl aufnehmen würde.
»Wie nennst du sie?«, fragte Morales leise.
Flanagan grinste freundlich. »Jetzt sag bloß, Mimo, dass es dir nicht auch aufgefallen ist. Da draußen läuft jemand rum, der womöglich vom guten alten Shakespeare inspiriert ist. Erst der Mord in Saint Louis, und jetzt die beiden anderen. Ich komme langsam zu der Überzeugung, dass wir diesen Scheiß für uns nutzen sollten.«
»Du willst ernsthaft …?«
Morales stockte der Atem.
»Warum nicht? Wir sollten das Stück wieder auf den Spielplan setzen und den Leuten sagen, warum wir’s tun. Ich schwöre euch, sie werden uns die Bude einrennen!«
»Mein Gott, Freddy!«, entfuhr es Morales. »Wie weit willst du noch gehen?«
Die Fensterfront im zwanzigsten Stockwerk des Apartmenthauses bot einen exklusiven Blick auf den Mississippi und den Gateway Arch am gegenüberliegenden Ufer. Doch der sechshundertdreißig Fuß hohe Stahlbogen verschwand ebenso wie die gesamte Skyline im spätherbstlichen Dunst, der Saint Louis einhüllte wie ein dünn gewirktes Leichentuch.
Vor diesem trübseligen Panorama präsentierte sich Mrs. Edvina Oatis Phil in einem bauschigen, goldfarbenen Crêpekleid, das ihren rundlichen Korpus aussehen ließ wie ein kunstvoll eingewickeltes Praliné. Ihren faltigen Hals schmückte ein Collier mit dicken Schmucksteinen, die von dem gleichen Rot waren wie Fingernägel und Lippenbemalung. Den passenden Kontrast dazu bildeten eine leicht verrutschte, dottergelbe Langhaarperücke und die weiß getünchte, faltige Gesichtshaut.
Sie saßen an einem bemalten Elfenbein-Tischchen, auf dem Mrs. Oatis ungefragt eine Flasche mit Cointreau-Likör und zwei kleine Gläser bereitgestellt hatte.
»Du meine Güte«, sagte sie mit schleppender Stimme. »Ich bin eine vierundachtzigjährige Frau, können Sie sich das vorstellen? Die meisten Leute wollen mir das ja gar nicht glauben.«
Sie lachte keuchend.
»Es muss aber stimmen, es steht so in meinen Papieren.« Sie leckte sich fahrig über die Lippen und zwinkerte Phil verschwörerisch zu. »Würden Sie uns wohl einschenken, junger Mann?«
Phil nickte höflich und füllte Mrs. Oatis’ Glas mit der bernsteinfarbenen Flüssigkeit. Sie griff sofort zu und leerte es in einem Zug.
»Ich könnte noch einen Nachschlag brauchen«, sagte sie dann.
Phil füllte ihr Glas ein zweites Mal. Mrs. Oatis schielte gierig darauf, hielt sich aber vorerst noch zurück.
Dass Phil nicht mittrank, schien sie gar nicht zu bemerken.
»Ich könnte mir das alles hier eigentlich gar nicht leisten!« Seufzend deutete sie mit ihrer kleinen Hand, an der die Gelenke knotig und geschwollen waren, auf das protzige, altmodische Mobiliar. »Gott sei Dank war mein geschiedener Mann so umsichtig, mir vor seinem Tod noch dieses Apartment zu schenken und einzurichten. Weiß der Teufel, warum er das getan hat. Wir hatten keine gute Ehe, glauben Sie mir. Ich habe vieles erduldet. Na ja, vermutlich hat ihn das schlechte Gewissen geplagt.«
Phil fragte sich langsam, wie er mit dieser absurden Situation umgehen sollte. Mrs. Oatis hatte vor neun Monaten ihren Sohn verloren. Sie wusste, dass sie vor einem FBI Agent saß, der genau deshalb hier war. Und sie benahm sich, als ginge sie das alles gar nichts an. Als sei Phil nur auf einen kleinen Plausch vorbeigekommen.