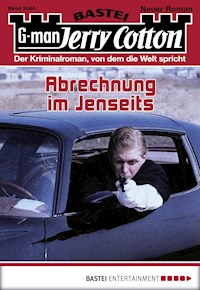1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Krimi
- Serie: Jerry Cotton
- Sprache: Deutsch
Carl Baxter wandte sich an das FBI, weil sein Bruder Jesse seit drei Tagen spurlos verschwunden war. Einige Tage vor seinem Verschwinden hatte er eine Nachricht erhalten. "Du bist ein Mörder, und Mörder müssen sterben. Im Namen der Gerechtigkeit", lautete der Text der Nachricht. Schnell fanden wir heraus, dass Jesse Baxter vor einigen einschlägigen Kneipen in Manhattan Heroin verkauft hatte. Es drängte sich der Verdacht auf, dass er jemandem Drogen verkauft hatte, der daran zugrunde gegangen war. Hatten wir es mit einem Verbrechen aus Rache zu tun?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 145
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhalt
Cover
Impressum
Im Namen der Gerechtigkeit
Vorschau
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige eBook-Ausgabe der beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgabe
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
© 2020 by Bastei Lübbe AG, Köln
Programmleiterin Romanhefte: Ute Müller
Verantwortlich für den Inhalt
Titelfoto: Nomad_Soul/shutterstock
Datenkonvertierung eBook: César Satz & Grafik GmbH, Köln
ISBN 978-3-7325-9274-6
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
www.bastei.de
Im Namen der Gerechtigkeit
Es war dunkel. Jesse Baxter stand in der Hofeinfahrt eines Wohnblocks, als ein hochgewachsener Mann in einem hellen Trenchcoat und mit einem Hut, den er tief ins Gesicht gezogen hatte, direkt auf ihn zukam. Baxter erkannte seine Kunden in der Regel schon an der Statur oder der Art, wie sie sich bewegten. Dieser Mann aber war ihm fremd, und so war sein erster Gedanke, dass es sich womöglich um einen Cop handelte.
Mit den Bullen wollte Jesse Baxter nichts zu tun haben. Der Grund dafür war einfach: Er trug an die fünfundzwanzig Päckchen Heroin bei sich, und wenn man die bei ihm fand, würde er die nächsten Jahre gesiebte Luft atmen.
Jesse Baxter ergriff die Flucht. Er erwartete zwar, dass er aufgefordert wurde, stehen zu bleiben, doch der Mann mit dem Hut rief ihn nicht an. Stattdessen nahm er die Verfolgung auf, wie Baxter mit einem schnellen Blick über die Schulter feststellte.
Plötzlich glaubte der Dealer nicht mehr daran, dass es sich bei dem Hutträger um einen Polizisten handelte. Er dachte an die anonyme Drohung, die vor ein paar Tagen in seinem Briefkasten gelegen hatte.
Du bist ein Mörder, und Mörder müssen sterben. Im Namen der Gerechtigkeit!
Das hatte auf dem Papier gestanden.
Er hatte dem keine allzu große Bedeutung beigemessen.
Das hätte er wohl besser tun sollen.
Von seinem Verfolger ging eine stumme, aber dennoch deutlich zu spürende Bedrohung aus. Ein Kunde war der Kerl auf keinen Fall, denn der wäre Baxter nicht hinterhergelaufen, sondern hätte sich bei einem anderen Straßenverkäufer den benötigten Stoff besorgt. Jeder Junkie hatte mehrere Quellen, um seine Drogen zu beziehen.
Baxter floh in Richtung Seward Park. Ein unbestimmtes Gefühl sagte ihm, dass er um sein Leben laufen musste.
Seine Beine wirbelten, die Sneakers an seinen Füßen verursachten fast kein Geräusch.
Was wollte dieser Kerl von ihm? Dieser Typ war ihm unheimlich. In dem Trenchcoat und mit dem Hut sah er aus wie einer dieser Schnüffler oder Gangster in den alten Kriminalfilmen. So lief für gewöhnlich niemand mehr herum.
Jetzt begann sich Jesse Baxter zu wünschen, dass es ein Bulle war, der ihn hetzte.
Er trat in eine Bodenunebenheit und hatte Mühe, sein Gleichgewicht zu bewahren. Eine kleine Gruppe Menschen kam ihm entgegen, und er musste ausweichen, sprang vom Gehsteig, rannte zwischen zwei parkenden Autos hindurch und überquerte in schräger Linie die Straße.
Ein Blick nach hinten, und sein Magen krampfte sich zusammen. Sein Verfolger hatte aufgeholt. Baxter spürte, wie ihm die Luft knapp wurde. Sein Herz hämmerte wie verrückt in der Brust, und seine Füße wurden schwer wie Blei. Die Angst trieb ihn und half ihm, nicht aufzugeben. Zur Angst gesellte sich das Entsetzen.
Der Dealer hatte den Blick wieder nach vorn gerichtet. Die Büsche und Bäume des Parks konnte er schon sehen. Dahinter erhoben sich die Hochhäuser der Seward Park Housing Corporation.
Jesse Baxters Atem flog. Er presste die rechte Hand gegen den Leib, denn er bekam Seitenstechen.
Noch hundert Yards …
Der Dealer wagte nicht mehr, nach hinten zu blicken. Das Gehsteigpflaster war schadhaft, und jeder falsche Tritt konnte zu einem Sturz führen, was für ihn möglicherweise das Ende bedeutet hätte. Er spürte das Unheil geradezu körperlich, das von seinem Verfolger ausging. Es streifte ihn wie ein eisiger Atem …
Fünfundsiebzig Yards!
Es war nur noch Panik, die Jesse Baxter voranpeitschte. Im Grunde seines Herzens war er ein Feigling, und schon als Junge hatte er gegen Gleichaltrige immer den Kürzeren gezogen. Baxter war nur mittelgroß und ziemlich schmächtig, und wenn es hart auf hart gegangen war auf dem Schulhof oder auf der Straße, hatte er im Bewusstsein seiner Schwäche meistens den Rückzug angetreten. Das hatte ihn geprägt.
Das Seitenstechen wurde unerträglich. Seine Lungen pumpten, er hatte das Gefühl, dass ihm der Kopf jeden Moment platzen müsste.
Noch fünfzig Yards. Er glaubte hinter sich schon den keuchenden Atem seines Verfolgers zu hören.
Baxter taumelte nur noch dahin. Wieder begegneten ihm Leute, es handelte sich um ein halbes Dutzend junger Burschen. Er rannte an ihnen vorüber. Jemand rief etwas hinter ihm her, doch er kümmerte sich nicht darum. Auch als gleich darauf hinter seinem Rücken wüstes Geschrei aufkam, drehte er sich nicht um.
Die kleine Gruppe wollte dem Mann, der Jesse Baxter verfolgte, den Weg verlegen. Vielleicht wollten sich die Jugendlichen einen Scherz erlauben.
»Zur Seite!«, schnarrte der Trenchcoatträger und hielt plötzlich eine Pistole in der Faust. Er hatte sein Tempo nicht verringert, prallte gegen einen der jungen Kerle und katapultierte ihn regelrecht gegen die Hauswand. Im nächsten Moment schlug er mit der Pistole zu, und ein anderer Bursche, den er an der Schläfe getroffen hatte, ging zu Boden.
Gebrüll erhob sich, aber dann war Jesse Baxters Verfolger auch schon durch und jagte wieder hinter dem Dealer her. Der kleine Zwischenfall hatte diesem allerdings wieder etwas Vorsprung verschafft …
Baxter ignorierte die Schmerzen in seiner Seite und raffte sich zu einer letzten Kraftanstrengung auf. Schließlich taumelte er zwischen einige Büsche am Rand des Parks, hielt aber nicht an, sondern kämpfte sich weiter und mied das Licht der Laternen an den Gehwegen in der Grünanlage.
Geduckt und rasselnd atmend pirschte er durch das Strauchwerk, verhielt hin und wieder, um zu lauschen, bohrte den Blick in die Dunkelheit zwischen den Sträuchern und fragte sich, ob es ihm gelungen war, den unheimlichen Verfolger abzuschütteln.
Nur langsam nahmen bei ihm Atmung und Herzschlag wieder den regulären Rhythmus auf, das Seitenstechen ließ nach, und die Angst wurde weniger. Die Frage, warum es der Fremde auf ihn abgesehen hatte, wurde immer drängender.
Du bist ein Mörder!
Die vier Wörter, die auf der Drohung gestanden hatten, schossen ihm durch den Kopf.
Baxter fror es plötzlich. Es war eine Kälte, die von innen kam.
Er stand im Schatten einer Hecke und seine Gestalt verschmolz regelrecht mit der Dunkelheit. Leises Rascheln war zu vernehmen, das der Nachtwind in den Kronen der Bäume und in den Sträuchern hervorrief. Von der Avenue A her erklangen Motorengeräusche sowie das Hupen ungeduldiger Zeitgenossen, denen es wieder einmal nicht schnell genug ging. Für kurze Zeit war in der Ferne auch eine Polizeisirene zu hören.
Im Park aber war es still. Nachts mieden sowohl Einheimische als auch Touristen die grünen Lungen Manhattans.
Der Dealer hatte keine Ahnung, wie viel Zeit verstrichen war, seit er sich im Park versteckte. Er atmete jetzt wieder normal, und das Seitenstechen war erträglich geworden. Du hast den Hurensohn abgehängt, dachte er. Er hat sicher längst aufgegeben.
Er tat einen zittrigen Atemzug, als er daran dachte, dass er vielleicht im letzten Moment dem Tod ein Schnippchen geschlagen hatte.
Du bist ein Mörder, und Mörder müssen sterben. Im Namen der Gerechtigkeit, hämmerte es hinter seiner Stirn, und wieder verspürte er eine Gänsehaut.
Du solltest langsam die Fliege machen, Jesse, spornte er sich selbst an. Das hier ist sicherlich kein Ort zum Wohlfühlen.
Er nahm all seinen Mut zusammen, setzte sich in Bewegung und durchquerte den Park in Richtung East Broadway. Einmal knackte ein trockener Ast unter seinem Schritt, und er blieb wie angewurzelt stehen, lauschte und spürte die Anspannung seiner Nerven bis in die letzte Faser seines Körpers. Schließlich pirschte er geduckt an einer Hecke entlang. Sie endete, und Baxter wollte sich nach rechts wenden.
Etwas Stahlhartes, Kühles presste sich plötzlich gegen seine Stirn, und die schemenhafte Gestalt, die völlig überraschend vor Baxter aufgetaucht war, zischelte: »Keinen Laut, Baxter! Ich hab ’nen Schalldämpfer auf die Mündung geschraubt. Kein Mensch wird es hören, wenn ich dir das Hirn aus der Birne blase!«
Jesse Baxter war starr vor Schreck und sekundenlang zu keiner Reaktion fähig. Seine Kehle war wie zugeschnürt. »Was – was wollen Sie von mir?«, stammelte der Dealer, als er seine Sprache wiedergefunden hatte.
»Du gehst jetzt vor mir her zu meinem Auto, Baxter«, sagte der Unbekannte. »Dort setzt du dich ans Steuer, und wir fahren ein Stück. Solltest du Zicken machen, fährst du zur Hölle. Verstanden?«
Der Dealer konnte nur nicken. Ihn schien eine unsichtbare Faust zu würgen.
Es war am Montagvormittag, als mein Telefon läutete. Bei der Anruferin handelte es sich um Helen, die Sekretärin unseres Chefs. Ich nahm das Gespräch an.
»Guten Morgen«, grüßte Helen, und nachdem ich den Gruß erwidert hatte, sagte sie: »Ihr sollt gleich zum Chef kommen, Jerry. Ein Mann namens Carl Baxter ist bei ihm. Worum es geht, weiß ich allerdings nicht.«
»Wir sind schon auf dem Weg«, versicherte ich, unterbrach die Verbindung und schaute meinen Kollegen an. »Der Chef will uns sehen!«
Ich erhob mich und schlüpfte in meine Jacke, die ich am Morgen über die Stuhllehne gehängt hatte. Auch Phils Gestalt wuchs vom Stuhl in die Höhe …
Als wir kurz darauf Helens Büro betraten, lächelte sie.
»Geht nur hinein«, forderte sie uns auf. »Kaffee steht schon auf dem Besprechungstisch.«
»Du bist ein Schatz«, erklärte Phil und grinste breit.
Ich klopfte schon gegen die Verbindungstür zum Büro des Assistant Directors und klinkte sie auf, ohne die Aufforderung zum Eintreten abzuwarten.
»Ah, Jerry, Phil«, tönte mir die Stimme Mr. Highs entgegen. »Kommen Sie herein.«
Der Chef und ein dunkelhaariger, mittelgroßer und ziemlich schmächtiger Mann, dessen Alter ich zwischen fünfundzwanzig und dreißig Jahren schätzte, saßen an dem runden Besprechungstisch, um den einige mit Leder bezogene Stühle gruppiert waren.
»Bitte, Agents, nehmen Sie Platz«, ließ der AD wieder seine Stimme erklingen. »Vorher aber darf ich Ihnen diesen Gentleman vorstellen. Sein Name ist Carl Baxter.«
Mr. Highs Gast erhob sich, reichte mir die Hand, und ich sagte: »Guten Tag, Mister Baxter. Ich bin Special Agent Cotton.«
»Angenehm«, sagte Baxter und schüttelte sogleich Phils Hand, der ebenfalls seinen Namen nannte.
Baxter vermittelte einen sehr bedrückten Eindruck. Nicht einmal ein andeutungsweises Lächeln verzog seinen Mund.
Als wir saßen, ergriff wieder Mr. High das Wort, indem er Phil und mich zunächst aufforderte, uns am Kaffee zu bedienen, dann klärte er uns über den Grund auf, aus dem Carl Baxter zu ihm gekommen war, indem er sagte: »Mister Baxters jüngerer Bruder Jesse ist seit Freitagnacht spurlos verschwunden. Er befürchtet, dass Jesse entführt und ermordet wurde.«
Ich fasste Carl Baxter ins Auge. »Wie kommen Sie zu dieser Annahme?«, fragte ich.
»Mein Bruder hat vor etwa einer Woche eine anonyme Drohung in seinem Briefkasten vorgefunden. Der Verfasser hat gedroht, ihn zu töten. Jesse hat die Drohung allerdings nicht sonderlich ernst genommen. Als er mir davon erzählt hat, meinte er, jemand habe sich einen schlechten Scherz mit ihm erlaubt und wolle ihm einen Schreck einjagen. Da Jesse die Sache auf die leichte Schulter nahm, dachte ich auch nicht weiter darüber nach. Aber jetzt ist Jesse spurlos verschwunden, und ich bin davon überzeugt, dass es mit der Morddrohung zusammenhängt.«
Wer unseren Chef John D. High nicht kennt, mag sich an dieser Stelle wundern, warum der Fall des verschwundenen Jesse Baxters eine Angelegenheit der Bundespolizei sein sollte, und ebenso mag es erstaunen, dass sein Bruder hier saß, im Büro des New Yorker FBI-Chefs, der sich eigentlich mit Bandenverbrechen und drohenden Terroranschlägen befasste.
Dazu muss man allerdings wissen, dass Mr. High insbesondere über zwei Dinge verfügt, zum einen über eine untrügliche Menschenkenntnis und zum anderen über einen aufgeprägten kriminalistischen Instinkt. Carl Baxter war ihm offenbar sympathisch, darum wollte der Chef helfen, aber er witterte wohl auch, dass hinter dem Verschwinden von Jesse Baxter eine größere Sache stecken konnte.
»Haben Sie in den Krankenhäusern nachgefragt?«, erkundigte sich Phil. »Ihr Bruder hat doch sicher ein Smartphone. Haben Sie versucht, ihn telefonisch zu erreichen?«
»Ich habe sicherlich an die hundert Mal versucht, mit Jesse Kontakt aufzunehmen«, antwortete Carl Baxter. »Und ich habe sämtliche Krankenhäuser angerufen, sämtliche Polizeidienststellen und sämtliche mir bekannten Freunde von Jesse. Nichts! Es gibt nicht den geringsten Hinweis auf seinen Verbleib.«
»Haben Sie den Wortlaut der Morddrohung im Kopf?«, fragte ich.
Carl Baxter nickte. »Du bist ein Mörder, und Mörder müssen sterben. Im Namen der Gerechtigkeit.«
Im Namen der Gerechtigkeit …
Wahrscheinlich hatte das Mr. Highs Interesse geweckt, denn es deutete darauf hin, dass hier jemand Selbstjustiz verüben wollte, vielleicht sogar eine Organisation, was bedeutete, dass tatsächlich ein Bandenverbrechen und damit ein FBI-Fall vorlag. Womöglich war die Sache sogar politisch motiviert.
Phil und ich wechselten einen schnellen Blick. »Das ist eine schwerwiegende Anklage«, stieß mein Partner hervor. »Ist Ihr Bruder denn ein Mörder?«
»Mir ist nicht bekannt, dass er jemand umgebracht hätte«, erwiderte Carl Baxter. »Wobei ich sagen muss, dass mir die Kreise, in denen Jesse verkehrt, ganz und gar nicht gefallen.«
»Reden Sie bitte Klartext, Mister Baxter«, forderte ich. »Was sind das für Leute, mit denen sich Ihr Bruder abgibt?«
»Nun ja …« Baxter dachte kurz nach, sein Blick schien sich für mehrere Sekunden nach innen zu kehren. »Es sind meiner Meinung nach arbeitsscheue Subjekte, Kleinkriminelle, die sich durchs Leben mogeln. Hauptsache, sie müssen sich nicht mit Arbeit die Hände schmutzig machen.«
»Hat Ihr Bruder denn gearbeitet?«
»Nein.«
»Aber er muss doch von etwas gelebt haben«, meldete sich Mr. High zu Wort.
Carl Baxter presste die Lippen zusammen.
»Sagen Sie es schon«, drängte ich. »Womit verdiente Ihr Bruder seinen Lebensunterhalt? Ich vermute, nicht mit ehrlicher Arbeit.«
»Er ist drogensüchtig.« Baxter sagte es und stieß scharf die Luft durch die Nase aus. Es war, als sträubte sich alles in ihm, darüber zu sprechen, und ich glaubte, auf dem Grund seiner Augen einen verzweifelten Ausdruck wahrzunehmen. Er fuhr mit gesenkter Stimme fort: »Jesse schluckt und spritzt alles, was er kriegen kann. Um seinen Drogenbedarf zu finanzieren, dealt er. Aus dem Drogenmilieu – davon bin ich überzeugt – kommt auch der Drohbrief. Vielleicht ist er einem der Kartells in die Quere gekommen.« Baxter hob die Schultern, ließ sie wieder sacken. »Ich weiß es nicht. Aber mir ist klar geworden, dass die Drohung kein Spaß war. Ich vermute sogar ganz stark, dass mein Bruder gar nicht mehr lebt.«
»Zunächst mal ist er verschwunden«, sagte Mr. High. »Ein Leichnam, bei dem es sich um Ihren Bruder handeln könnte, scheint Ihren eigenen Feststellungen gemäß nirgendwo aufgetaucht zu sein. Also gehen wir davon aus, dass er noch unter den Lebenden weilt.« Der AD schaute Phil und mich an. »Ich denke, wir sollten uns darum kümmern«, meinte er. »Bisher sieht es danach aus, als wäre Mister Jesse Baxter entführt worden, und Entführung ist in den USA Sache der Bundespolizei.«
Ich nickte. »Wissen Sie, woher Ihr Bruder seine Drogen bezogen hat?«, erkundigte ich mich bei Carl.
»Nein. Wenn ich die Rede auf seine Sucht und seine Art der Geldbeschaffung brachte, war das, als hätte ich damit in seinem Kopf einen Schalter umgelegt. Er war nicht zu bewegen, mit mir darüber zu sprechen. Dabei meinte ich es doch nur gut mit ihm. Ich hatte sogar einmal die Möglichkeit, ihn in dem Betrieb unterzubringen, in dem ich beschäftigt bin. Es ist eine Werbeagentur drüben in Brooklyn. Jesse hat mich ausgelacht.«
»Wo wohnt Ihr Bruder?«, wollte Phil wissen.
»171 Magenta Street«, antwortete Baxter.
»Wo ist das?«, hakte Phil nach.
»Bronx«, knurrte Carl Baxter, und es war, als schämte er sich, dass sein Bruder in einem Stadtteil New Yorks lebte, den die Menschen in Manhattan, Brooklyn, Queens und Staten Island den dreckigen Hinterhof der Stadt nennen. Die Bronx ist nach wie vor das ärmste Viertel New Yorks und auch das verrufenste. Bandenkriege in den früheren Jahren, Prostitution und Drogenhandel sowie Mord und Totschlag werden heute noch mit der Bronx assoziiert.
Phil nahm sein Notizbüchlein und einen Kugelschreiber aus der Jackentasche und notierte die Anschrift.
Es war früher Nachmittag, als wir den Harlem River überquerten. Das Bild, das sich unseren Augen bot, änderte sich schlagartig. Hier gibt es nichts von dem, was Manhattan ausmacht. Es ist eine trostlose Welt, in die wir kamen.
Wir passierten einen Güterbahnhof, dessen Gleise von Unkraut überwuchert waren, und sahen alte, heruntergekommene Backsteinhäuser, an deren Fassaden die Feuerleitern vor sich hin rosteten. Ein Lastwagen der städtischen Müllabfuhr, der seine stinkende Fracht auf eine nahe gelegene Deponie brachte, kam uns entgegen. Es waren zum großen Teil auch Abfälle aus Manhattan und den anderen Stadtteilen, die jenseits des Harlem River landeten …
Die Magenta Street bildete in dieser trostlosen Gegend keine Ausnahme. Überquellende Mülltonnen standen vor den Häusern, der Müll, der in ihnen keinen Platz mehr gefunden hatte, lag verstreut auf dem Gehsteig und der Straße herum, ein übler Geruch hing in der Luft.
Wir fanden das Gebäude mit der Nummer 173, und ich stellte den Dienstwagen, den wir uns für diese Fahrt genommen hatten, am Straßenrand ab. Es handelte sich um ein vierstöckiges Mietshaus. Fünf Stufen führten zur Haustür hinauf. Das eiserne Geländer wies keine Farbe mehr auf, der Handlauf war abgegriffen und glänzte.
Ein Stück entfernt standen einige Halbwüchsige und beobachteten uns misstrauisch. Irgendwie passten wir wohl nicht hierher.
Wir betraten das Gebäude. Die Luft im düsteren Treppenhaus war abgestanden und muffig. Wir mussten hinauf in die dritte Etage. Einen Fahrstuhl gab es natürlich nicht. Die Treppe war aus Holz, die Stufen ächzten und knarrten, der Geruch von Bohnerwachs mischte sich in die übrigen undefinierbaren Gerüche. In irgendeiner der Wohnungen flog eine Tür krachend zu, ich hörte die schrille, geradezu überschnappende Stimme einer Frau, dann begann ein Kind lauthals zu weinen.
Auf jedem Treppenabsatz gab es ein Fenster. Auf den Fensterbänken lagen tote Fliegen, und die hingen auch in den verstaubten Spinnennetzen, die sich in den Ecken spannten.