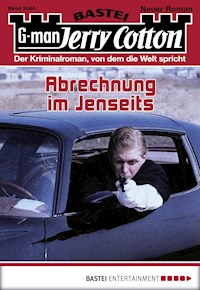1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Krimi
- Serie: Jerry Cotton
- Sprache: Deutsch
Phil und ich wurden zum Fundort einer Leiche bestellt. Das Opfer, die dreißigjährige Dana Peterson, war erstochen worden. Was das FBI auf den Plan rief, waren die Parallelen zu einem anderen Mord, der sich wenige Monate zuvor ereignet hatte. An beiden Tatorten hatte der Täter dasselbe Symbol hinterlassen - das biblische Kainsmal. Und eine weitere Gemeinsamkeit verband die beiden Opfer: Beide hatten einen eineiigen Zwilling ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 138
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhalt
Cover
Impressum
Der Gemini-Killer
Vorschau
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige eBook-Ausgabe der beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgabe
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
© 2020 by Bastei Lübbe AG, Köln
Programmleiterin Romanhefte: Ute Müller
Verantwortlich für den Inhalt
Titelfoto: Nomad_Soul/shutterstock
Datenkonvertierung eBook: César Satz & Grafik GmbH, Köln
ISBN 978-3-7325-9275-3
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
www.bastei.de
Der Gemini-Killer
Plötzlich waren seine kalten, zudringlichen Hände überall. Sie glitten unter ihre Jacke, über ihre Hüfte, an ihren Po.
Delilah Peterson ließ es widerspruchslos geschehen. So lange, bis die grellen Scheinwerfer eines herannahenden Wagens das Paar aus der Dunkelheit rissen.
Der Fahrer hielt ungebremst auf sie zu …
Delilah, die entgegen der Fahrtrichtung stand, bemerkte den Wagen als Erste. Geistesgegenwärtig sprang sie auf die Bordsteinkante.
Sekunden später wischte der feuerrote Ford Mustang nur wenige Zoll an ihrer »Eroberung« vorbei.
Aus dem geöffneten Beifahrerfenster war das Gelächter ein paar Halbstarker zu hören.
Ihr dunkelhaariger Begleiter – Hal? Hank? – blickte dem Wagen hinterher. »Idioten!«
Delilah trat wieder an ihn heran und drückte ihm ihren Zeigefinger mit dem violett lackierten Nagel auf die Lippen. »Sch! Das Leben ist zu kurz, um sich aufzuregen.«
Sie nahm ihn bei der Hand und zog ihn durch die abgelegene Gasse zu einem bogenförmigen Durchgang, der in einen Innenhof führte. Abgesehen von dem schwachen Licht, das aus den Fenstern der angrenzenden Apartments fiel, und dem milchigen Schein des Mondes, der von einer dünnen Wolkendecke gefiltert wurde, war es hier dunkel.
Delilah führte den Mann vorbei an einer Reihe von Müllcontainern zu einer kurzen Treppe, die zu einer Kellertür führte.
Auf der unteren Stufe blieb sie stehen und schlang die Arme um seinen Nacken.
Er legte die Hände auf ihre Hüften, drehte sie sanft, aber bestimmt herum und schob sie gegen das Eisengeländer.
Sie spürte seinen heißen Atem auf ihrem Gesicht, während er sich langsam zu ihr hinunterbeugte. Sekunden später verschmolzen ihre Lippen zu einem innigen Kuss.
Delilah kannte den gut aussehenden Fremden seit einer Stunde. Aufgegabelt hatte sie ihn im Village, in einer Cocktailbar namens Blue Cheers. Ein Laden mit teuren Drinks und unfreundlicher Bedienung, dafür ohne Sperrstunde.
Gegen halb drei hatte sie die Bar betreten. Die üblichen Blicke und billigen Anmachsprüche der vornehmlich männlichen Kundschaft ließen nicht lange auf sich warten, doch es gab Grenzen, die nicht einmal Delilah bereit war zu überschreiten.
Und so sie trank sie ihren Manhattan, als wäre es Kirschsaft, zog sich auf der Toilette die Lippen nach und war kurz davor, sich ein anderes Jagdrevier zu suchen, als er auftauchte.
Groß, schlank, attraktiv, braun gebrannt. Ein netter Bonus – das Auge aß schließlich mit. Am besten gefiel ihr das, worauf sie bei einem Mann den größten Wert legte: sein Geruch.
Der Geruch nach Geld, um genau zu sein.
Sein dunkler Mantel war unauffällig, fast unscheinbar, aber sie erkannte einen Cucinelli, wenn sie ihn vor sich hatte. Der Schal war aus Kaschmir, und die Schuhe … Die kannte sie nicht, billig sahen sie allerdings nicht aus.
Die erste Kontaktaufnahme war leicht, ja, geradezu spielend einfach. Wenige Minuten später nippte sie an ihrem zweiten Manhattan, den er ihr bestellt hatte.
Sie kamen locker ins Gespräch.
Sie erfuhr, dass er im E-Commerce-Bereich tätig war. Den ersten Teil des Abends hatte er angeblich mit ein paar Kollegen verbracht. Auf dem Heimweg hatte er Lust auf einen schnellen Absacker verspürt und war durch Zufall im Blue Cheers gelandet.
Er wiederum bekam jede Menge Lügen zu hören, die Delilah mittlerweile so in Fleisch und Blut übergegangen waren, dass sie selbst Mühe gehabt hätte, sie von der Wahrheit zu unterscheiden.
Eine halbe Stunde später verließen eng umschlungen sie das Lokal.
Am liebsten wäre sie mit zu ihm nach Hause gegangen, angeblich war jedoch gerade seine Schwester zu Besuch.
Ja, genau. Spätestens jetzt war sich Delilah sicher, dass eine Freundin, Frau und vielleicht sogar ein oder zwei Gören zu Hause auf ihn warteten.
Delilahs Apartment fiel aus naheliegenden Gründen ebenfalls aus. Und extra in ein Stundenmotel? Das war die Sache nicht wert.
Delilah schnurrte leise, als er begann, ihren Nacken zu küssen.
Ihre Hände glitten tiefer, unter seinen Mantel. Ihre Rechte strich über seine Brust, während sich die Linke ihrem eigentlichen Ziel näherte. Sie hatte es fast erreicht, als er sich abrupt von ihr losriss und sie mit loderndem Blick anstarrte. Schraubstockartig umklammerte er ihr Gelenk und zog ihre Hand, die sich bereits auf das butterweiche Leder seiner Brieftasche gelegt hatte, ruckartig heraus.
»Du willst mich beklauen? Verdammtes Miststück!« Ohne Vorwarnung holte er aus und schlug zu.
Delilah drehte instinktiv den Kopf, sodass der Schlag nicht in ihrem Gesicht explodierte, sondern stattdessen ihr Ohr traf.
Der glühende Schmerz und das nachfolgende Dröhnen ließen sie taumeln. Einhändig nach dem Geländer greifend, ließ sie sich auf die unterste Treppenstufe sinken. Hektisch griff sie nach ihrer Handtasche und riss den Reißverschluss auf.
Bevor er ein zweites Mal ausholen konnte, starrte der Dunkelhaarige in den Lauf einer handlichen Sig P238, ohne die sie nicht aus dem Haus ging.
»Wage es nicht!«, spie sie ihm durch die Dunkelheit entgegen.
Dem Kerl wich erschrocken zurück. »Du hast sie ja nicht alle! Verdammte Nutte!«
»Sie haben die Lady gehört!«
Beide reagierten gleichermaßen überrascht.
Der Mann, dem die weiche, fast weiblich klingende Stimme gehörte, war wie aus dem Nichts hinter dem Dunkelhaarigen auftaucht. Er trug einen dunklen Hoodie, hatte die Kapuze tief in die Stirn gezogen und verschmolz beinahe mit der Nacht.
Der Dunkelhaarige sah sich irritiert um, dann wanderte sein Blick wieder zu der Waffe, die Delilah beidhändig auf ihn gerichtet hielt. Er ballte die Hand zur Faust, drehte sich um und hastete die Treppe hinauf. Der Mann im Kapuzenpulli machte einen Schritt zur Seite, um ihn vorbeizulassen.
Der Dunkelhaarige blieb neben ihm stehen und fixierte die Stelle, wo sich irgendwo im Schatten der Kapuze das Gesicht seines Gegenübers verbarg. »Pass auf, Mann, die hat ’nen totalen Knall!«
Damit ließ er ihn stehen und verschwand in der Nacht.
Delilah atmete erleichtert aus. Ihre Hände zitterten, während sie die Waffe sicher in ihrer Tasche verstaute.
Ihr Retter kam ihr entgegen und half ihr auf die Beine.
Delilah zupfte an ihrem Rock, der ein wenig hochgerutscht war. »Danke«, sagte sie mit zitternder Stimme. »Wenn Sie nicht gekommen wären …«
»Hätten Sie immer noch Ihre Kanone gehabt«, ergänzte der Mann mit der sanften Stimme und ließ Delilah an sich vorbei.
Sie klammerte sich am Geländer fest, während sie auf ihren hochhackigen Schuhen die Treppe hinaufwankte.
Auf der obersten Treppenstufe verharrte sie und drehte sich zu ihm um. »Verraten Sie mir Ihren Namen?«
»Jacob«, sagte die Stimme aus der Kapuze, ohne zu zögern.
»Und wie weiter?«
In derselben Sekunde sah sie das metallische Blitzen in seiner Hand. Es rührte von einer scharfen Klinge her, die in einer halbkreisförmigen Bewegung auf sie zuraste und sich quer in ihren Hals bohrte. Sie spürte einen scharfen Schmerz und merkte, wie warmes Blut aus der klaffenden Wunde schoss. Dann wurde ihr schwarz vor Augen. Sie taumelte, tastete nach dem Geländer, verfehlte es jedoch um Haaresbreite und landete hart auf dem Boden.
Bevor sie das Bewusstsein verlor, fiel ihr Blick noch einmal auf den Kapuzenträger, der sich über sie beugte. Und das Letzte, was sie in ihrem Leben hörte, war diese sanfte, fast weibliche Stimme: »Einfach nur Jacob.«
Ein Leichenfundort hat immer etwas Tristes an sich. Sogar bei schönstem Sonnenschein kann einen der Anblick eines zerschundenen Körpers vorübergehend in eine Sinnkrise stürzen. Auch erfahrene Ermittler sind davor nicht gefeit. Erst recht nicht, wenn es sich bei dem Leichnam um den einer jungen Frau handelt, die völlig unvermittelt und aus purer Gewaltlust ihres Lebens beraubt wurde.
Heute, in diesem Hinterhof in Greenwich Village, herrschte kein Sonnenschein. Es war kurz nach sieben in der Früh an einem graukalten Februarmorgen. Die Sonne mühte sich am Horizont, sich hinter einer dichten Wolkendecke hervorzuschieben. Die hatte New York in der Nacht mit einem feinen Sprühregen bedacht, der gefroren war und die Straßen mit einer hauchdünnen, aber umso tückischeren Eisschicht überzog.
Phil und bewegten uns wie auf rohen Eiern durch die Polizeiabsperrung zu den Kollegen der Spurensicherung, die bereits seit einer Stunde ihre traurige Arbeit verrichteten.
Schon beim Näherkommen verspürte ich ein dumpfes Gefühl im Magen. Das lag weniger an der tristen Szenerie, sondern an den Zivilisten, die ringsum an den Fenstern der angrenzenden Wohnungen und Büros standen, nach unten gafften und teilweise sogar mit ihren Smartphones filmten. Ich kam mir vor wie ein Gladiator, der beim Gang in die Arena von Dutzenden Sensationslüsterner begleitet wurde. An jedem anderen Tatort hätte man die Leute einfach fortschicken können. In diesem von vier Hauswänden umgrenzten Innenhof war das deutlich schwieriger. Allerdings hatten zwei NYPD-Kollegen – ein Uniformierter und ein Zivilbeamter – das Problem erkannt. Der Mann in Zivil deutete hoch zu einem der Handyfilmer. Der Uniformierte nickte und verließ eilig den Hof. Mit ziemlicher Sicherheit würde er sich den Hobbyfilmer zur Brust nehmen und das Smartphone einkassieren.
Der Zivilpolizist hatte uns inzwischen bemerkt und kam auf uns zu, dass wir fast zeitgleich bei der Toten eintrafen.
Die Kollegen der Spurensicherung waren so geistesgegenwärtig gewesen, den Leichnam mit einem Tuch zuzudecken, sodass wir zunächst nur die Umrisse der Toten sahen, die sich unter der Oberfläche abzeichneten.
»Lieutenant Andrew Morris, Morddezernat«, stellte sich der Kollege vor. Er war ein leicht übergewichtiger Blondschopf mit einem penibel getrimmten Oberlippenbart. Aufgrund seines schwachen Dialekts verortete ich seine ursprüngliche Heimat im Großraum von Boston. »Wir haben hier ein Mordopfer. Delilah Peterson, ihrem Führerschein zufolge. Zweiunddreißig Jahre alt, wohnhaft in Queens.«
Morris nickte dem Coroner zu, einem kahlköpfigen, dürren Asiaten, der bisher schweigend neben uns gestanden hatte. Während der Lieutenant seine Stablampe anknipste, hob der Gerichtsmediziner das Tuch halb an, sodass wir einen Blick auf Gesicht und Brustpartie der Toten werfen konnten.
Sie war vollständig bekleidet, lag auf dem Rücken, hatte dunkles, schulterlanges Haar und war stark geschminkt. Ihr Mascara war verlaufen und bildete dunkle Flecke auf der bleichen Haut. Es verlieh ihr einen Gothiclook, der bestimmt nicht beabsichtigt gewesen war. Tiefe Schnittwunden und eine Kruste aus geronnenem Blut am Hals und an den Schultern verrieten uns die wahrscheinliche Todesursache, bevor der Coroner sie offiziell bekanntgab.
»Die Tat wurde mit einer scharfen Klinge durchgeführt, vielleicht mit einem Rasiermesser«, meinte der Asiate. »So viel kann ich schon sagen.«
»Ein Rasiermesser?« Phil stutzte. »Wer hat denn ein Rasiermesser bei sich?«
»Der Mord war vermutlich keine Zufallstat, sondern geplant. Darauf deutet auch etwas hin, das wir am Bauch der Toten gefunden haben.«
Er lüftete das Laken weiter, und Phil, der Lieutenant und ich zogen den Kreis instinktiv enger, um den Gaffern die Sicht zu nehmen.
Das Top der jungen Frau war halb nach oben gerollt, der untere Teil ihres Oberkörpers lag damit frei.
Morris leuchtete mit seiner Stablampe auf die Stelle unterhalb des gepiercten Bauchnabels. Dort, mit einer Klinge in die Haut geritzt und ebenfalls blutverkrustet, befand sich ein kleines Symbol. Auf den ersten Blick erinnerte es an ein schlecht verheiltes Tattoo. Es ähnelte einem klobigen Gehstock mit einem waagerecht nach links abknickenden Griff und zwei kürzeren Strichen darunter.
»Und das, Gentlemen, ist der Grund, warum wir das FBI um Mithilfe gebeten haben.«
Steve Dillaggio, Special Agent in Charge, hatte uns bereits telefonisch darüber informiert, dass das Police Department die Tat einem Serientäter zuschrieb.
»Lassen Sie mich raten«, sagte ich. »Miss Peterson ist nicht das erste Mordopfer, bei dem dieses Symbol gefunden wurde.«
»Exakt«, gab Morris zurück. »Im Herbst letzten Jahres gab es einen ähnlichen Fall. Ein zweiundvierzigjähriger Immobilienmakler namens Ted Carter wurde tot zwischen zwei Müllcontainern in einer Seitengasse in Brooklyn gefunden. Auch ihm wurde der Hals aufgeschlitzt – mit einer messerscharfen Klinge, vermutlich von einem Skalpell. Sein Mörder hat ihm das gleiche Symbol in die Haut geritzt.«
»Vielleicht ein Copykiller?«, fragte Phil.
»Unwahrscheinlich. Dieses Detail haben wir der Presse bewusst vorenthalten. Ich bin mir sicher, dass wir es in beiden Fällen mit ein und demselben Täter zu tun haben.«
Ich richtete mich auf und wandte mich an Morris. »Letzten Herbst, sagten Sie? Das ist wie lange …? Fünf Monate her?«
»Viereinhalb«, antwortete Morris. »Ähnlichkeiten zu anderen ungeklärten Taten gibt es nicht, selbst landesweit nicht. Das haben wir überprüft.«
»Dann war dieser Carter wahrscheinlich sein erster Mord«, sagte ich leise.
»Und wie es aussieht, hat der ihn auf den Geschmack gebracht«, ergänzte mein Freund und Partner.
»Lange können wir das der Öffentlichkeit nicht vorenthalten«, meinte Morris. »Wenn es einen dritten Mord gibt und bekannt wird, dass wir die Bevölkerung nicht gewarnt haben, dann …«
»Dann sorgen wir lieber dafür, dass es keinen dritten Mord gibt«, erwiderte ich.
»Das Symbol«, sagte Phil, »konnten Sie herausfinden, was es damit auf sich hat?«
Der Lieutenant nickte. »Wir glauben, dass es sich dabei um eine rudimentäre und unausgereifte Version des biblischen Kainsmals handelt.«
Ich nickte zustimmend. Mir waren die Umrisse gleich bekannt vorgekommen, obwohl sie wegen der Blutkruste nicht eindeutig zu erkennen waren. »Das Kainsmal ist das Zeichen, das Gott laut Altem Testament Kain verpasst hat, nachdem der seinen Bruder Abel erschlagen hatte.«
Phil sah erst mich, dann Morris nachdenklich an. »Dieser ermordete Immobilienmakler, dieser Ted Carter, hatte der einen verstorbenen Bruder, dessen Tod er auf irgendeine Art und Weise verschuldet hat?«
Morris schüttelte den Kopf. »Das hätte ich Ihnen längst gesagt. Nein, er hat einen quicklebendigen Bruder, der sich keinen Reim darauf machen kann.«
»Und Delilah Peterson?«, hakte Phil nach.
Morris zuckte mit den Schultern.
Ich winkte ab. »Wir finden das raus. Danke, dass Sie uns verständigt haben. Ab jetzt übernehmen wir.«
Morris zog die Brauen hoch. »Gott sei Dank.«
Wir verbrachten den restlichen Vormittag damit, weitere Informationen über das Opfer und mögliche Angehörige einzuholen. Um das Handy der Toten, das mit einer PIN gesichert war, kümmerten sich unsere Techniker. Ich war zuversichtlich, dass sie es knacken würden, aber etwas würde es dauern.
Wir nutzten die Zeit, um zu Delilah Petersons Wohnung zu fahren, die im sogenannten griechischen Viertel von Queens, dem Stadtteil Astoria, lag. Tatsächlich prägten hier griechische Tavernen und Supermärkte das Bild. Wer griechischen Rotwein trinken und dazu Sirtaki tanzen wollte, kam in einem der zahlreichen Lokale auf seine Kosten, auch wenn der arabische Einfluss in den letzten Jahren zugenommen hatte und vermehrt Shishabars und Falafelimbisse das hellenische Ambiente verdrängten.
Das Apartment, in dem Delilah Petersons gewohnt hatte, befand sich in einem fünfstöckigen Backsteingebäude in einer Seitengasse abseits des Trubels.
Der Hausmeister, den wir bei dieser Gelegenheit gleich über das Ableben der Mieterin informierten schloss uns die Wohnungstür auf.
Das Apartment war klein, nur ein Zimmer mit Küchenzeile, eine Vorratskammer und ein angrenzendes Bad, für eine alleinstehende Person jedoch vollkommen ausreichend.
Bevor wir damit begannen, die Schubladen nach einem Adressbuch, persönlichen Fotos und dergleichen zu durchsuchen, wandte ich mich an den Hausmeister. Er war ein gemütlicher Südländer mit buschigen Brauen, der nicht den Anschein erweckte, als wollte er so bald wieder verschwinden.
»Wissen Sie, ob Miss Peterson Verwandte hat, die informiert werden müssen?«
Der Mann zuckte mit den Schultern. »Hab mit der in fünf Jahren bestimmt keine drei Worte gewechselt. Trug die Nase bis hier, wenn Sie mich fragen.« Er deutete die Höhe mit der flachen Hand an, die er eine halbe Armlänge über seine Stirn hob.
»Wo sie gearbeitet hat, wissen Sie demnach auch nicht?«, fragte ich weiter.
»Nö. Ging aber meistens erst abends aus dem Haus, wenn Sie verstehen.« Ein schmieriges Grinsen legte sich auf sein unrasiertes Gesicht.
Phil warf mir einen Blick zu, den ich wortlos verstand: Zeit, den Kerl loszuwerden.
»Danke erst mal. Wenn wir Sie brauchen, kommen wir auf Sie zu.«
Der Wink mit dem Zaunpfahl blieb wirkungslos. Der Mann machte keine Anstalten, seinen Platz im Türrahmen aufzugeben. Stattdessen verschränkte er die Arme vor der Brust und sah uns lauernd an.
»Warum interessiert sich das FBI für eine wie die? Hat sie was ausgefressen?«
»Wir stehen mit unseren Ermittlungen noch am Anfang«, gab ich zurück. »Umso wichtiger, dass Sie uns unsere Arbeit machen lassen. Wir …«
»Darf ich erfahren, was Sie hier tun?«
Die empörte weibliche Stimme war hinter dem Hausmeister im Treppenflur aufgeklungen. Der Mann wich zur Seite und gab den Blick auf eine Frau Anfang dreißig frei. Sie hatte dunkles Haar, hohe Wangenknochen, war dezent geschminkt und trug einen hochgeschlossenen Mantel.
Außerdem hatten wir sie erst vor zwei Stunden gesehen – blutverschmiert, auf dem vereisten Boden eines düsteren Hinterhofs.
Vor uns stand eine Tote!
Ein leises Jaulen aus dem Hausflur ließ Patricia Sondheim von ihrer Zeitungslektüre aufschauen.
Ihr Blick wanderte zu der rechteckigen Durchreiche, die das Esszimmer mit der Küche verband. Dort, wo sich ihre Tochter gerade noch ihren als Powerdrink angepriesenen Proteinshake zum Frühstück gemixt hatte, herrschte nun gähnende Leere.
»Mia! Stella will raus!«