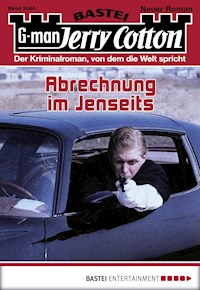1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Während einer Modenschau in einem Convention Center ereignete sich ein brutaler Mord. Gregory Mitchell, ein leitender Mitarbeiter der Modenschau, wurde aus nächster Nähe mit einem Kopfschuss hingerichtet. Auf Handyvideos der Veranstaltung war ein Verdächtiger zu erkennen, der kurz vor der Tat aus der letzten Zuschauerreihe aufgestanden war und anschließend, von den anderen Anwesenden unbemerkt, hinter der Bühne verschwand. Die Ermittlungen führten Phil und mich in die Kreise des organisierten Verbrechens. Gleichzeitig kamen wir einem Geistlichen auf die Spur, der so gar nicht ins Bild passte ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 142
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhalt
Cover
Der Heilige von Hunts Point
Vorschau
Impressum
Der Heilige von Hunts Point
Das Licht von vier Scheinwerfern war auf den Laufsteg gerichtet. Fünf Models trugen extravagante Kleider und den gleichen abwesenden Blick. Akustisch untermalt wurde die Show von treibenden Elektrobeats, die auf den Gang und die Posen der jungen Frauen abgestimmt waren.
Alles war perfekt inszeniert. So hielten es viele Besucher für eine Showeinlage, als die Frau im knappen Sommerkleid plötzlich über den Laufsteg stolperte. Auch die blutroten Flecke auf dem blütenweißen Stoff erregten wenig Aufmerksamkeit. Erst ihr gellender Schrei ließ einige aufspringen. Und ihr gehetzter Blick, mit dem sie sich direkt ans Publikum wandte.
»Sie haben ihn umgebracht! Er ist tot!«
Das war der Moment, in dem Panik ausbrach.
Der Tote hieß Gregory Mitchell und war dem FBI kein Unbekannter. Wir hatten den Geschäftsmann schon seit Jahren im Visier, seit sein Name im Zusammenhang mit Schmiergeldzahlungen an Lokalpolitiker aufgetaucht war. Zahlungen mafiöser Immobilienhaie, die einer seiner Buchhalter über Mitchells damalige Firma abgewickelt hatte. Eine direkte Mittäterschaft konnte ihm als Inhaber zwar nicht nachgewiesen werden, aber unsere Ermittlungen hatten zu hohen Geldstrafen und schließlich zur Schließung seiner Firma geführt. Danach war er nur noch ein Aktenzeichen. Seinen weiteren Lebensweg hatten wir nicht verfolgt. Bis heute, genauer gesagt, bis vor einer Stunde, als sein Name auf unserem internen Radar auftauchte.
»Fahren Sie bitte sofort zum Midtown Convention Center und sehen sich den Tatort an«, hatte uns Mr High gebeten.
Phil und ich wollten den Abend gerade bei einem Glas Rotwein und einem Teller Pasta im Mezzogiorno ausklingen lassen, als uns sein Anruf erreichte.
»Der gute Tropfen«, sagte Alfred, einer der Kellner unseres Lieblingsitalieners, als wir ihm erklärten, dass wir den gerade entkorkten Chianti nun doch nicht genießen könnten. »Ich kann ihn nicht zurück in die Flasche füllen.« Allein der Gedanke schien ihm körperliche Schmerzen zu bereiten.
»Trink du ihn auf uns«, meinte ich mit schiefem Lächeln und legte einen Zwanziger auf den Tisch. »Wir holen das irgendwann nach.«
Keine halbe Stunde später standen wir in einem kühlen Aufenthaltsraum im hinteren Teil des Veranstaltungszentrums und blickten auf Gregory Mitchell, der rücklings in einer Body Bag auf dem Boden lag. Seine Augen waren geschlossen. Nur sein drittes blutrotes Auge glotzte uns aus seiner Stirn an.
»Wer hat ihn gefunden?«, fragte ich Detective Harper, den ermittelnden Kollegen des NYPD, der uns hierhergeführt hatte.
»Eines der Models«, antwortete der Mittdreißiger mit dem rotblonden Vollbart und den streichholzkurzen Haaren. »Sie fand ihn auf einem Drehstuhl sitzend und dachte, er würde schlafen. Als sie ihn umdrehte, ist er ihr entgegengekippt. Natürlich steht sie jetzt unter Schock.«
Ich nickte und warf meinem Partner einen ernsten Blick zu. »Das war keine Tat im Affekt.«
»Nein«, bestätigte Phil. »Das sieht eher nach einer Hinrichtung aus.«
»Heißt das, ihr nehmt mir den Fall ab?«, fragte Harper.
»Sorry«, entgegnete ich mit einem sparsamen Lächeln. »Wir haben uns den Abend auch anders vorgestellt.«
»Wer war alles zum Tatzeitpunkt hinter der Bühne?«, fragte Phil.
»Eine Reihe von Personen«, gab der Detective zurück. »Vor allem die sechs Laufstegmodels und die drei Garderobieren, die ihnen beim An- und Ausziehen assistiert haben. Ich schicke Ihnen die Liste. Aber bisher will niemand etwas bemerkt haben.«
»Und welche Funktion hatte Mitchell bei dieser Veranstaltung?«, wollte ich wissen.
»Er arbeitete als Eventmanager von Be-in-Touch, die Agentur, die die Fashionshow im Auftrag eines Modelabels organisiert.«
Ich nickte nachdenklich. Diese Agentur würden wir uns genauer ansehen, doch im Moment galt es, Zeugen zu finden, die etwas bemerkt hatten. Soweit ich wusste, war die Veranstaltung gut besucht gewesen.
»Meine Leute sind noch dabei, die Personalien aller Besucher aufzunehmen«, erklärte Harper auf meine Frage hin.
»Okay«, sagte ich. »Sie sollen nicht nur ihre Aussagen aufnehmen, sondern sich nach Bild- oder Videoaufnahmen erkundigen, die von der Veranstaltung gemacht wurden.«
Heutzutage gehörte es fast zum guten Ton, bei jeder Gelegenheit das Handy für Fotos oder gar Videoaufnahmen zu zücken. Was manche als Plage empfanden, war für uns oft hilfreich, weil wir uns so ein Bild einer Situation machen konnten, ohne uns auf die verschwommenen Erinnerungen unzuverlässiger Zeugen verlassen zu müssen.
»Wir tragen alles zusammen und lassen es Ihnen gebündelt zukommen«, versprach Harper.
Wir bedankten uns. Für uns gab es hier im Moment nicht mehr viel zu tun. Wir konnten nur auf die Ergebnisse der Vorarbeit unserer Kollegen von NYPD und CSI warten. Hunderte von Besuchern waren zu befragen, endlose Minuten an Bildmarerial zu sichten, den Tatort und die Leiche nach Faser- und DNA-Spuren abzusuchen. Kein Job für zwei, sondern für Dutzende erfahrene Ermittler, auf deren geschulten Blick wir uns verlassen mussten.
Kurz nach zehn hatte ich Phil längst an unserer gewohnten Ecke abgesetzt und machte es mir gerade auf der Couch in meinem Wohnzimmer bequem, als eine Nachricht auf meinem Smartphone aufpoppte.
Harper hatte sie mir auf mein Diensthandy geschickt, und der knappe Text Sehen Sie sich das an wurde durch eine Videoaufnahme ergänzt. Sie war offenbar kurz vor Beginn der Veranstaltung aufgenommen worden, zeigte den noch leeren Laufsteg und schwenkte dann über die Zuschauerreihen. Als ich es mir das erste Mal ansah, war ich mir nicht ganz sicher, worauf Harper gestoßen war. Also schaute ich es mir ein zweites und drittes Mal an. Und dann machte es Klick.
In der letzten Reihe, ganz am Rand, stand ein Mann, der sich verstohlen in alle Richtungen umsah. Als er sich unbeobachtet glaubte, steuerte er auf eine Tür zu, die in den Backstagebereich führte. Ich wusste das, weil ich vor wenigen Stunden selbst durch diese Tür gegangen war.
Neugierig geworden, hielt ich das Video an, als sich der Mann für einen Moment zur Kamera umdrehte. Ich stutzte, vergrößerte den Bildausschnitt und vergewisserte mich, dass ich mich nicht getäuscht hatte.
Nein, ich hatte richtig gesehen. Unter dem schwarzen Hemdkragen des Mannes blitzte ein weißer Kollar. Ein ringförmiger Stehkragen, wie er von Geistlichen verschiedener Konfessionen getragen wurde.
Sofort leitete ich die Aufnahme mit Bitte um eine Identitätsfeststellung an die Kollegen im Field Office weiter.
Vielleicht hatte sich der Mann, der nur auf den richtigen Moment gewartet zu haben schien, nur getarnt. Wenn nicht, dann hatten wir es bei diesem Verdächtigen offensichtlich mit einem Priester zu tun.
Mein Verdacht bestätigte sich am nächsten Morgen. Phil und ich hatten gerade unser Büro betreten, und ich war noch dabei, meinen Computer hochzufahren, als mir das rot blinkende Lämpchen an meinem Telefon signalisierte, dass ich einen Anruf verpasst hatte. Dabei hatte unsere offizielle Bürozeit noch gar nicht begonnen.
Ich nahm den Hörer ab und drückte auf die Wahlwiederholung.
»Hallo Jerry«, meldete sich der Kollege aus dem Archiv nach einmaligem Klingeln. »Hast du meine Nachricht erhalten?«
»Bin gerade erst angekommen«, erwiderte ich.
»Ich habe euch eine ganze Akte geschickt. Aber nur kurz: Der Mann, den ihr sucht, ist stadtbekannt.«
»Wirklich?« Ich sah Phil stirnrunzelnd an.
»Okay, das war vielleicht etwas übertrieben«, räumte der Kollege ein, der auf den Namen Peter hörte. »Zumindest in der Bronx kennt man ihn. Dort befindet sich seine Kirche.«
»Also wirklich ein Priester?«, fragte ich verblüfft.
»Katholischer Priester«, präzisierte Peter. »Abel Sandoval stammt aus Ecuador und lebt seit etwa zehn Jahren in New York City. Und in dieser kurzen Zeit hat er sich einen Namen als der Heilige von Hunts Point gemacht. So hat ihn jedenfalls die Presse getauft.«
Ich nahm Platz und beugte mich vor. »Was ist denn so heilig an ihm?«
»Er setzt sich nicht nur für die Armen in seinem Viertel ein, sondern auch für die Slums in Ecuador, die er mit regelmäßigen Aktionen unterstützt. Dafür hat er sogar eine Auszeichnung vom Bürgermeister gekriegt.«
In meinem Kopf überschlugen sich die Gedanken, und ich versuchte, all die Informationen unter einen Hut zu bringen.
»Steht alles in den Akten, die ich euch geschickt habe«, unterbrach Peter meinen Gedankenfluss.
Ich bedankte mich und beendete das Gespräch.
»Okay, vielleicht haben wir uns geirrt und dieser Sandoval hat doch nichts mit dem Mord an Gregory Mitchell zu tun«, meinte Phil, nachdem ich ihn ins Bild gesetzt hatte. »Trotzdem würde ich gerne ein Wörtchen mit ihm reden.«
Ich stand auf und ging zum Schreibtisch meines Partners, der die E-Mail mit den Dokumenten bereits auf seinem Computer geöffnet hatte.
»Seine Kirche befindet sich mitten in der Bronx«, sagte er und tippte auf die Adresse.
Ich nickte und nahm meine Jacke vom Haken. »Dann fahren wir da mal hin.«
Sandovals Kirche war klein und lag abseits der Hauptstraßen, zwischen hohen Wohnblocks und einem verlassenen Parkplatz, der mit einer rostigen Kette gesichert war. Das Mauerwerk musste einmal weiß gewesen sein. Jetzt ging es mehr ins Gräuliche, und die abblätternde Farbe und die Risse zeugten von jahrelanger Vernachlässigung.
Mein Versuch, das breite Holztor zu öffnen, scheiterte. Der von einer graugrünen Patina überzogene Knauf quietschte leise, ohne dass sich die Tür auch nur ein Stück bewegte.
»Sollte eine Kirche tagsüber nicht immer geöffnet haben?«, fragte Phil.
»Normalerweise schon«, sagte ich. Was gleichzeitig die Frage aufwarf, wie »normal« dieser Fall war.
Wir beschlossen, das Gebäude zu umrunden, um nach einer anderen Tür zu suchen. Idealerweise eine mit Klingel, denn der Haupteingang bot außer Klopfen keine Möglichkeit, auf sich aufmerksam zu machen.
Tatsächlich fanden wir auf der Rückseite eine schmale Holztür. Auch hier gab es keine Klingel, aber sie wurde auch gar nicht benötigt. Schon aus einigen Schritten Entfernung sah ich, dass das Schloss kaputt war und die Tür von einer Schnur, die zwischen dem Knauf und einem Nagel im Mauerwerk gespannt war, gehalten wurde.
»Das nennt man wohl Flickwerk«, meinte Phil.
Ich untersuchte bereits das Schloss, das nicht nur kaputt, sondern aufgebrochen war. »Da kam rohe Gewalt zum Einsatz.«
Kaum hatte ich den Knoten gelöst, musste ich die schwere Tür mit dem Fuß aufhalten. Andernfalls wäre sie mir entgegengeflogen.
Dahinter erwartete uns ein schmaler, fensterloser Gang, der bereits nach wenigen Schritten an einer weiteren Tür endete. Auch diese war unverschlossen und führte in einen breiteren, nüchternen Flur, der von gerahmten Heiligenbildern gesäumt war.
Durch eine weitere Tür gelangte man direkt in den Altarraum. Ein modriger Geruch hing in der Luft, eine Mischung aus verbranntem Weihrauch und altem Holz. Was ich dann sah, entsetzte mich. Die aufgebrochene Tür hätte mir bereits eine Warnung sein können, aber mit diesem Anblick hatte ich nicht gerechnet.
Kerzen lagen zerbrochen auf dem Boden, das Altarkreuz war heruntergerissen und lag neben dem Altar. Die zerfetzten Überreste von Altartüchern hingen in zerschlissenen Fetzen herab, und auf dem Boden davor hatte jemand rote Farbe vergossen. Hier waren keine Einbrecher am Werk gewesen, sondern Vandalen, die ihre Lust an purer Zerstörung ausgelebt hatten.
Oder war es eine Warnung? Stand dieser Akt des Vandalismus in direktem Zusammenhang mit Abel Sandovals Auftauchen auf der Modenschau?
Ein Knarren und eine Bewegung im Augenwinkel rissen mich aus meinen Gedanken. Schnell drehte ich mich um, und mein Blick fiel auf eine Gestalt, die in der offenen Tür stand. Ein Junge, etwa sechzehn, mit südländischem Aussehen und einer blauen Baseballjacke mit weißen Ärmeln.
Sekundenlang starrten wir uns über die Distanz hinweg an. Er wirkte erschrocken, als hätten wir ihn bei etwas Verbotenem ertappt. Dann drehte er sich abrupt um und verschwand aus unserem Blickfeld.
Phil und ich sahen uns an, dann rannten wir ebenfalls los.
Ich war ihm eine Nasenlänge voraus und stürmte als Erster zurück in den Flur. Der Junge hatte gerade den Ausgang erreicht, blieb stehen und blickte gehetzt über seine Schulter. Er drehte sich um und entwischte durch die geöffnete Tür nach draußen.
Nach fünf langen Sätzen tat ich es ihm gleich.
Der Junge war schnell, und wenn wir uns nicht beeilten, würde er uns in Windeseile entwischen. Noch während ich das dachte, hörte ich aufgeregtes Hupen und das Quietschen von Reifen. Dann erst sah ich den Grund dafür.
Es war der Junge, der in dem verzweifelten Versuch, uns abzuschütteln, auf die Fahrbahn gerannt war. Genau vor den Kühler eines Taxis, dessen Fahrer im letzten Moment abgebremst hatte. Trotz der schnellen Reaktion hatte sein Kühlergrill den Jungen touchiert und ihn seitwärts auf die Fahrbahn geschleudert. Wie es aussah, hatte er den Sturz unverletzt überstanden. Zumindest war er schon wieder auf den Beinen, als Phil und ich ihn in die Zange nahmen.
Inzwischen war auch der Taxifahrer, ein kleiner orientalischer Mann, dessen dunkle Gesichtsfarbe eine gute Schattierung bleicher geworden war, aus dem Wagen gestiegen. Bevor wir etwas sagen konnten, wandte sich der Junge mit sich überschlagenden Worten an ihn.
»Sir, bitte rufen Sie die Cops! Die Männer sind hinter mir her!«
»Nicht nötig«, sagte ich, bevor der Taxifahrer reagieren konnte. »Wir sind die Cops!«
Um meine Aussage zu unterstreichen, zog ich meine Dienstmarke hervor und hielt sie Richtung Fahrer, ohne dabei den Jungen aus den Augen zu lassen. Er wirkte überrascht. Um einer Nachfrage zuvorzukommen, hielt ich auch ihm meine Marke entgegen, bevor ich sie wieder in der Tasche verschwinden ließ.
»FBI?«, fragte er atemlos.
»Ganz recht. Und wir drei unterhalten uns jetzt in Ruhe.«
»Kannst du gehen?«, fragte Phil vorsichtshalber. »Oder brauchst du einen Arzt?«
Der Junge schien die Frage gar nicht zu registrieren. Wahrscheinlich war sein Gehirn noch damit beschäftigt, die Informationen zu sortieren.
»Was wollen Sie von mir?«, fragte er statt einer Antwort. »Ich habe nichts getan.«
»Und warum rennst du dann wie von der Tarantel gestochen davon, wenn du ein reines Gewissen hast?«, wollte Phil wissen.
Der Blick des Jungen wanderte unruhig zwischen mir und meinem Partner hin und her, und ich nutzte den Moment, um ihn genauer zu betrachten. Er hatte ein schmales, nach unten spitz zulaufendes Gesicht mit hohen Wangenknochen und dunkle, borstenartige Stoppelhaare. Am auffälligsten waren seine Augen. Sie waren nicht dunkel, wie man vielleicht vermutet hätte, sondern schimmerten grau mit einem Stich, der ins Grüne tendierte.
»Ich dachte, Sie gehören zu den Typen, die ...«
Er verstummte mitten im Satz, als wäre ihm gerade eingefallen, dass man seine Worte besser auf die Goldwaage legte, wenn man mit dem FBI sprach.
»Ähm ... Brauchen Sie mich eigentlich noch?« Es war der Taxifahrer, der sich von der Seite in unser Gespräch einmischte. »Ich habe nämlich einen Fahrgast, der dringend zum JFK muss.«
Erst jetzt sah ich, dass tatsächlich noch jemand auf der Rückbank des Yellow Cab saß. Aus versicherungstechnischen Gründen ließ ich mir seine Personalien geben und ihn und seinen Fahrgast weiterziehen.
Dann wandte ich mich wieder dem Jungen zu, den Phil inzwischen im Auge behalten hatte. Aber jetzt wo er wusste, wer wir waren, machte er keine Anstalten mehr zu fliehen.
»Wie heißt du?«, fragte ich, während wir zur Kirche zurückgingen.
»Tyler.« Seine graugrünen Augen blitzten auf.
»Okay, Tyler«, gab ich zurück. »Dann erzähl uns mal, was du in der Kirche gesucht hast. Und warum du vor uns weggerannt bist.«
Er nickte, mied aber meinen Blick. »Ich wollte nachsehen, ob der Padre wieder da ist.«
»Wir reden von Pater Sandoval, nehme ich an?«
Wieder antwortete er mit einem knappen Nicken.
»Seit wann vermisst du den Padre denn?«, wollte Phil wissen.
»Seit ein paar Tagen ist die Kirche verschlossen, und bei ihm zu Hause öffnet niemand.«
»Und in welcher Beziehung stehst du zu Sandoval?«, fragte ich.
Er blickte auf und musterte mich mit großen Augen. »Der Padre hat mich von der Straße geholt und mir ein Zuhause gegeben. Seitdem helfe ich ihm als Messdiener.«
Auf Nachfrage erfuhren wir, dass Tyler aus Nicaragua stammte und zusammen mit seinen Eltern illegal ins Land gekommen war. Er war damals drei Jahre alt gewesen. Nach einer jahrelangen Existenz am Rand der Gesellschaft geriet die Familie ins Visier der Einwanderungsbehörde. Kurz vor ihrer Deportation tauchte der inzwischen Achtzehnjährige unter und versteckte sich in der WG eines Schulfreunds. Dort flog er raus und lebte eine Weile auf der Straße, bevor Pater Sandoval auf ihn aufmerksam geworden war. Unter anderem hatte Tyler ihm dabei geholfen, eine Aufenthaltsgenehmigung zu beantragen, und ihm einen Ausbildungsplatz in der Firma eines Gemeindemitglieds besorgt.
»Padre Sandoval ist ein Heiliger«, schloss Tyler seine Erzählung.
»Davon habe ich gehört«, erwiderte ich lakonisch.
»Offensichtlich sind nicht alle so begeistert von ihm«, meinte Phil.
Tyler sah Phil überrascht an, dann senkte er betreten den Kopf. Die entweihte Kirche und Sandovals angebliches Verschwinden sprachen eine deutliche Sprache, wobei »Verschwinden« es nicht ganz traf. Verschwunden war der Priester nicht, wie die Videoaufnahmen der Modenschau zeigten. Bestenfalls war er untergetaucht. Nur warum? Wegen der Leute, die seine Kirche verwüstet hatten? Dieser Verdacht lag nahe. Doch was hatte er mit dem Tod von Gregory Mitchell zu tun?
»Ich weiß nur, dass der Padre in Schwierigkeiten steckt«, rückte Tyler schließlich heraus. »Da waren diese Männer ...«
»Welche Männer?«, fragte ich, um den Gesprächsfaden nicht abreißen zu lassen.
»Ich kenne sie nicht, aber sie sahen bedrohlich aus.«
»Wo und wann hast du sie gesehen?«
»Letzten Donnerstag nach der Abendmesse. Meistens bleibe ich etwas länger, um dem Padre beim Aufräumen zu helfen. Ich war gerade in der Sakristei, als ich Stimmen hörte. Ich wollte nicht lauschen. Nur nachsehen, ob alles in Ordnung ist. Deshalb habe ich mich angeschlichen ...«
»Und was hast du gesehen?«, hakte ich nach.
»Drei Männer in Anzügen. Einer von ihnen hat auf den Padre eingeredet. Er sagte, der Padre würde es bereuen, wenn er sich weiter einmischt.«
Ich runzelte die Stirn. »Und sonst?«