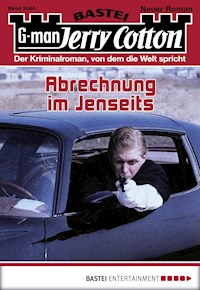1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Es war ein Bild, das unsere Kollegin Dionne Jackson in höchste Alarmbereitschaft versetzte. Bei einer routinemäßigen Durchsicht der Überwachungskameras fiel ihr in der Menschenmenge in Manhattan ein Mann auf. Es war Clyte Runnicle, der seit Längerem ein Leben unter neuer Identität führte. Er hatte als Kronzeuge gegen einen großen Mafiaboss des Big Apple ausgesagt und war in New York in großer Gefahr. Wir ahnten, dass etwas Größeres dahintersteckte, und behielten recht. Denn als wir Runnicle an seinem neuen Wohnort in der Provinz von Connecticut besuchen wollten, um den Grund für seinen New-York-Besuch zu erfahren, fehlte jede Spur von ihm. Und das war erst der Anfang ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 145
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhalt
Cover
Zeugenfalle
Vorschau
Impressum
Zeugenfalle
Das Schrillen des Telefons versetzte Clyte Runnicle einen solchen Schreck, dass er beinahe die Whiskyflasche fallen gelassen hätte. Er hatte gerade einen verbotenen Schluck genommen. Immerhin war er der Verkäufer im Schnapsladen namens Lenny's Liquors und kein Kunde.
Er wischte sich mit dem Handrücken über den Mund und nahm den Telefonhörer ab. Es war Lenny, sein Chef.
»Ich hoffe, du bedienst dich nicht wieder an der Ware!«, rief er. »Ich warne dich. Wenn ich morgen früh die Schicht übernehme, und es fehlt was, bist du gefeuert.«
Ohne eine Antwort abzuwarten, legte er auf.
Okay, dachte Runnicle. Wenigstens hat er mich gewarnt. Jetzt musste er nur noch überlegen, wie er erklärte, dass eine Flasche fehlte.
Plötzlich hörte er, wie ein Wagen mit quietschenden Reifen hinter dem Laden hielt. Und da peitschte auch schon ein Schuss!
Voller Panik brachte Clyte Runnicle seinen massigen Körper hinter dem Tresen in Deckung. Die Flasche nahm er mit. Kaum hatte er sich geduckt, nahm er noch einen Schluck zur Beruhigung.
Der Schweiß rann ihm von der Stirn.
Der Schuss war hinten in dem kleinen Hof gefallen, den man durch eine Durchfahrt von der Parallelstraße aus erreichte. Jetzt hörte Runnicle schnelle Schritte auf dem Beton. Dazu ein Stöhnen und Keuchen, als würden zwei Männer miteinander kämpfen.
Als er in Deckung gegangen war, hatte er noch gedacht, da wären welche gekommen, um den Laden zu überfallen. Wie jeder in New York wusste, passierte das ziemlich häufig. Schnapsläden hatten meist bis tief in die Nacht geöffnet. Und außer dem Bargeld konnte man noch etwas Ware mitnehmen, die auf dem Schwarzmarkt ihren Preis hatte.
Aber jetzt hatte Clyte verstanden, dass es um etwas ganz anderes ging. Irgendwelche Typen schienen eine Rechnung offen zu haben und lieferten sich eine Schlägerei.
Hinter dem Tresen gab es ein Fenster, das auf den Hof hinausführte. Daneben befand sich der Hinterausgang, durch den man auch auf den Hof gelangte. Hinter dem Fenster konnte Runnicle die Fassade des Nachbarhauses erkennen. Es war ein Abbruchgebäude. Es wohnte niemand da, der sich über den Schuss wunderte, was in dieser Gegend sowieso fast nie jemand tat. Wenn hier in der Nacht geschossen wurde, schaute man am besten nach, ob die Fenster und Türen ordentlich verrammelt waren, zog die Decke über den Kopf und schlief weiter.
Runnicle bekam zwei Gestalten zu sehen. Sie waren nichts als schwarze Umrisse. Zwei Männer, die miteinander rangen.
Die eine Gestalt löste sich aus dem Kampf und rannte weg. Die andere rief etwas, das Runnicle nicht verstand. Sie blieb stehen, griff irgendwo hin und hatte eine Waffe in der Hand.
Wieder ein Schuss. Runnicle konnte sogar das Mündungsfeuer sehen, das für einen Moment die Szenerie erhellte.
Dort wo der andere Mann hingerannt war, ertönte ein Schrei. Runnicle spürte, wie sich in ihm etwas verkrampfte. Er arbeitete seit drei Jahren in dem Schnapsladen. Zweimal hatte er einen Überfall erlebt. Das war jedes Mal glimpflich ausgegangen, denn Runnicle hatte dem Täter jeweils einfach das Geld aus der Kasse gegeben und fertig.
Das hier war etwas anderes.
Was sollte er tun? Die Cops rufen? Oder den Notarzt?
Sein Handy befand sich in der Jacke, die im Büro nebenan hing. Also musste er das Telefon des Geschäfts nehmen.
Er drehte sich um und wandte dem Fenster und dem Hinterausgang den Rücken zu. Seine Knie wollten ihm kaum gehorchen, als er die paar Schritte ging.
Gerade hatte er das kabellose Telefon von der Station genommen, als hinter ihm die Tür krachend aufflog.
Runnicle wäre fast das Herz stehen geblieben. Er wollte sich umdrehen. Jemand packte ihn an den Armen und drehte sie hart nach hinten.
Er würde der Nächste sein, der erschossen wurde. Da war er sich ganz sicher.
»Hab ich mich doch nicht geirrt«, zischte eine Stimme hinter ihm. »Hier brennt noch Licht, also ist da auch jemand ...«
In Runnicles Ohren war ein Rauschen, das im Rhythmus seines rasenden Herzens pulsierte. Er konnte die Stimme des Mannes nur wie durch Watte hören.
»Leg das Telefon weg ... Ich will mich mit dir unterhalten. Keine Angst.«
Unterhalten?, dachte Runnicle. Worüber?
Seine Hand zitterte, als er das Telefon auf die Ladeschale zurücklegte.
»Was hast du gesehen?«, fragte der Mann.
Runnicle keuchte.
»Nichts ...«, brachte er hervor. »Ich habe nichts ...«
»Lüg mich nicht an!«, zischte der Mann.
Runnicle spürte etwas Hartes, das sich in seinen Rücken bohrte. Es war aus Metall, und man musste kein Hellseher sein, um zu begreifen, dass es sich um die Waffe handelte.
»Ich lüge nicht.« Runnicles Stimme klang flehend. »Ich habe nichts gesehen.«
Der Mann ließ einen Moment locker. Runnicle kam es wie eine Befreiung vor. Dann fiel ihm ein, dass da draußen ein Mensch lag. Womöglich schwer verletzt. Der Hilfe brauchte. Oder er war schon tot ...
»Du hast nichts mitgekriegt, sagst du? Du hast nicht gesehen, was da draußen eben passiert ist?« Das Bohren wurde stärker. »Und wieso habe ich dann deine Visage am Fenster gesehen?«
Runnicle versuchte zu erklären, dass er den Kampf schon beobachtet hatte. »Nur ich habe keinen erkannt«, fügte er hinzu. »Das müssen Sie mir glauben.«
Eine Pause entstand. Der Mann schien nachzudenken. »Doch, du hast jemanden erkannt.«
»Was?«
»Ich erklär's dir«, sagte er Mann. Und auf einmal klang seine Stimme nicht mehr so kalt wie vorher.
Ein Jahr später
»Ich komme bald nach Hause, Schatz«, sagte Dionne Jackson ins Telefon. »Mommy muss noch ein bisschen arbeiten.«
»Aber ich will, dass du jetzt kommst«, sagte der achtjährige Lamonte, und sein Tonfall schnitt Dionne ins Herz.
»Sei ein tapferer Junge und tu das, was Granny sagt«, erklärte sie ihm. »Ich bin sicher noch rechtzeitig da, um dir Gute Nacht zu sagen.«
Dionne konnte sich das Gesicht ihres Sohns gut vorstellen. Wie er damit rang, das, was sie ihm gesagt hatte, zu akzeptieren.
»Ist gut, Mommy«, kam es schließlich aus dem Hörer. »Granny will dich noch mal sprechen.«
Lamonte übergab den Hörer an Dionnes Schwiegermutter. Die Schwiegereltern kümmerten sich um den Jungen, wenn Dionne ihren Dienst beim FBI versah. Sie lebten zusammen in Harlem, seit Dionnes Mann plötzlich an einem Herzinfarkt verstorben war.
»Ich hoffe, ich schaffe es«, sagte Dionne. »Es tut mir leid, dass ich so oft Überstunden schieben muss.«
»Mach dir keine Sorgen«, sagte Flora, Dionnes Schwiegermutter. »Elijah und ich spielen noch ein bisschen mit ihm. Und dann geht es ins Bett.«
»Danke«, gab Dionne zurück. »Ich sehe zu, dass ich bald nach Hause komme.«
Sie verabschiedeten sich voneinander. Dionne sah auf die Uhr. Wie so oft in den letzten Dienstminuten nutzte sie die Zeit, wenn nichts anderes anlag, um die Bilder von Überwachungskameras zu studieren. Das Meer der Gesichter in New York City zu beobachten, war ihre Leidenschaft, die mit ihrem besonderen Talent zusammenhing.
Supervisory Special Agent Dionne Jackson war eine Super-Recognizerin. Sie konnte sich Gesichter merken, die sie einmal irgendwo gesehen hatte. Auch dann, wenn sie den jeweiligen Personen nur kurz begegnet war oder wenn sie deren Fotos nur wenige Sekunden vor Augen gehabt hatte. Das galt sogar dann, wenn sich die Person in der Zwischenzeit stark verändert hatte oder wenn die Perspektive, in der sie sie sah, eine andere war.
Wenn sie sich durch die Aufnahmen der Kameras klickte, verfiel sie in einen besonderen Flow. Immer wieder kam es vor, dass sie verdächtige oder sogar gesuchte Personen entdeckte.
Dionne vergaß in diesem Zustand, wie die Zeit verging. Und plötzlich ...
Ein Treffer. Mitten im Gewühl der Millionenmetropole stach ein Gesicht heraus, das in ihr eine Alarmglocke zum Klingen brachte.
Sie zoomte die Aufnahme heran. Der Mann war übergewichtig und unrasiert. Sein dunkles Haar fiel ihm wirr und wie nass in die Stirn.
Sie hatte sein Foto erst vor Kurzem in einer Akte gesehen, da war sie sich sicher. Leider konnte sie sich bloß daran erinnern, dass sie es gesehen hatte. Sich genau daran zu erinnern, wo es gewesen war, gehörte nicht zu ihrem Talent.
Und wenn schon?, dachte Dionne. Dann hat der Mann eben eine Akte bei uns. Spielt das eine Rolle? Man darf beim FBI in den Datenbanken vorkommen und trotzdem durch New York laufen.
Sie beschloss, den Arbeitstag zu beenden. Es war halb sechs. Offizieller Dienstschluss. Sie konnte gehen und würde in Harlem sein, bevor ihr Sohn zu Bett gegangen war.
Sie fuhr nach Hause, aß mit ihren Schwiegereltern zu Abend, las mit Lamont, als er im Bett lag, noch eine Geschichte.
Und als sie zur Ruhe gekommen war, fiel ihr schlagartig ein, wo sie das Bild des Mannes auf der Videoaufnahme gesehen hatte.
Und ihr wurde klar, dass daran etwas nicht stimmen konnte.
Der Mann durfte gar nicht in New York sein.
»Wenig Betrieb heute«, sagte Roxanne und lächelt Runnicle zu. »Du kannst langsam Schluss machen, Robert.«
Robert.
An diesen Namen musste sich Runnicle immer noch gewöhnen. Er lebte nicht mehr in New York, sondern in Ridgefield. Der kleine Ort befand sich in Connecticut, nicht weit von der Grenze zum Staat New York entfernt.
Man hatte ihm einen angenehmen Job besorgt. Nicht in einem Schnapsladen, sondern in einem Museumsshop, der zu Keeler Tavern gehörte. Das war ein historisches Gebäude. Ein weißes, kleines Holzhaus, das irgendwie mit der Geschichte von Ridgefield zusammenhing. Es hatte eine Rolle im Krieg mit den Engländern in der amerikanischen Revolutionszeit gespielt. Zusammen mit der legendären Battle of Ridgefield. In einem Balken an der Außenwand steckte sogar noch eine originale Kanonenkugel, die man besichtigen konnte.
Viele Besucher – Erwachsene, Touristen und selbst ganze Schulklassen – waren ganz wild darauf, dieses kleine Kapitel amerikanischer Geschichte hautnah zu erleben. Und nachdem sie sich die kleine Ausstellung und die berühmte Kanonenkugel angesehen und sich mit ihr auch noch auf einem Selfie verewigt hatten, kauften sie manchmal im Museumsshop ein. Eine Tasse, ein T-Shirt, ein Buch. Oder einfach nur eine Ansichtskarte. Es gab sogar Geschirr mit stilisierten englischen Soldaten als Motiv. Oder entsprechend dekorierte Einkaufstaschen aus Leinen.
Roxanne war eine nette Chefin, anders als es Lenny in New York gewesen war. Sie war sicher fast zwanzig Jahre älter als Runnicle, besaß grellrot gefärbtes Haar und wirkte ein bisschen wie eine Mutter auf ihn.
»Alles klar, Rox«, sagte er und machte sich daran, die Kasse zu schließen, um die Abrechnung zu machen.
Anders als bei Lenny's in New York war er hier absolut ehrlich. Wenn man ihn gut behandelte, war er es eben. Und mit dem Trinken hatte er auch aufgehört. Zumindest fast. Ab und zu ein Bier in Daisy's Café. Das war alles.
Seine Arbeit am Tresen wurde unterbrochen, als draußen ein schwerer Wagen vorbeifuhr. Runnicle sah auf. Eine schwarze Limousine.
Sofort beschleunigte sich sein Herzschlag. Ganz ruhig, sagte er sich.
Er konnte gegen diese Reaktion jedoch nichts machen. Natürlich, er war hier in Ridgefield in Sicherheit, er lebte unter neuer Identität, aber etwas in ihm hatte immer noch Angst.
Er brauchte ein paar Minuten, um sich zu beruhigen.
»Alles in Ordnung?«, fragte Roxanne.
»Alles bestens«, gab Runnicle zurück. »Irgendwie warm heute ...«
»Finde ich nicht«, gab die Chefin zurück. »Oder denkst du an Daisy?« Sie lächelte, und es war ein mütterliches Lächeln. Dass er manchmal mit der Besitzerin seines Stammlokals flirtete, blieb in so einer kleinen Stadt nicht verborgen.
»Ja, auch«, sagte Runnicle und grinste schief. Sollte sie doch glauben, dass seine Nervosität daran lag.
Zehn Minuten später war er mit seiner Abrechnung fertig und stieg in seinen alten Ford, der auf einer für die Mitarbeiter reservierten Fläche des Besucherparkplatzes stand.
Ich bin Robert Shawn, sagte er sich. Robert Shawn.
Clyte Runnicle gibt es nicht mehr.
Bis zu seiner Wohnung, die ein Stück weiter nördlich in der Innenstadt lag, musste er nur eine gute Meile zurücklegen. Runnicle hätte die Strecke zu Fuß gehen können, aber so was machte keiner in dem kleinen Ort, außerdem war es ihm zu anstrengend. Körperliche Bewegung oder gar Sport waren noch nie seine Sache gewesen.
Dazu fühlte er sich mit dem Wagen freier. Er konnte, wenn er wollte, direkt nach Dienstschluss einen Ausflug unternehmen. Oder in einen der Supermärkte am Stadtrand fahren und einkaufen.
Heute war ihm nicht danach. Er ließ den Ford an der Kirche vorbeirollen und parkte ihn vor dem Gebäude, in dem sich im ersten Stock seine Wohnung befand. Unten gab es einen Optikerladen. Mr Callahan, der Inhaber, war hinter der Scheibe zu sehen und nickte Runnicle zu.
Um in die Wohnung zu gelangen, musste man in den Hinterhof, um von dort aus eine breite Wendeltreppe zu absolvieren.
Als Runnicle die Tür hinter sich geschlossen hatte, spürte er, dass immer noch ein Rest Unruhe in ihm war, die nun von ihm abfiel.
Er zog die Jacke aus, holte das Handy aus der Tasche und legte es auf den Tisch. In dem Kühlschrank, der zu der Küchenzeile gehörte, hatte er Fertiggerichte gestapelt, die man samt Verpackung in die Mikrowelle stellen konnte.
Kurz darauf drehten sich die in einer Plastikschale befindlichen Spaghetti Bolognese, als sein Handy klingelte.
Er ging zum Tisch und griff nach dem Telefon.
»Mit wem spreche ich?«, sagte eine Stimme.
Runnicle zuckte zusammen. Sein Magen verkrampfte sich. Wieso wurde er angerufen? Sonst hatte er die Nachrichten immer auf anderem Weg erhalten.
»Robert Shawn«, sagte Runnicle automatisch, weil er auf der Herfahrt seinen neuen Namen immer wieder vor sich hin gesagt hatte.
Der Mann reagierte mit Gelächter.
»Robert Shawn!«, rief er verächtlich. »Ich weiß, wie du wirklich heißt.«
»Wieso rufen Sie mich an?«, fragte Runnicle. »Sie haben mich nie angerufen. Wir haben die Treffen immer anders abgemacht und ...«
»Ich weiß, was wir abgemacht haben«, kam es scharf aus dem Hörer. »Diesmal geht es um etwas anderes ...«
»Er ist zu Hause. Kann losgehen.« Nervös trommelte Sergio mit den Fingern auf das Lenkrad.
Tonio saß auf dem Beifahrersitz. Mit unbewegter Miene hatte er Runnicle verfolgt, der aus dem Ford ausgestiegen und ins Haus gegangen war.
»Noch nicht«, sagte er.
Sergios Unruhe wuchs. Sie suchte ein Ventil. Er war nicht gerade der Geduldigste, und das wusste er auch. »Was bringt's denn, hier weiter rumzustehen?«
Tonio beobachtete wie versteinert die Vorgänge in der Straße. »Er hat den Mann hinter der Schaufensterscheibe gegrüßt. Ich wette, der hat uns auch bemerkt. Fahr los.«
Sergio drehte sich zu Tonio. »Wieso losfahren? Wir stehen doch gut hier. Wir brauchen nur über die Straße ...«
»Fahr los, verdammt noch mal! Das hier ist ein Kaff. Unser Wagen ist schon auffällig genug. Wir fahren einmal um den Block.«
»Und wenn er in der Zwischenzeit abhaut?«, fragte Sergio.
»Wo er gerade nach Hause gekommen ist? So einer wie der schlägt sich erst mal die Wampe mit irgendeinem Fraß voll.«
»Muss der sich auch gerade hier in der Provinz verstecken«, maulte Sergio. »In New York wäre das alles längst passiert.«
Er startete den Motor, gab Gas und fädelte sich in den Verkehr der Main Street ein. Nach knapp fünfzig Yards bog er rechts ab. Kurz darauf kamen sie an einer Toreinfahrt vorbei, die auf einen Hof führte. Eine Wendeltreppe drehte sich hinauf zu einem Vorsprung. Dort ging es in Runnicles Wohnung.
»Jetzt siehst du, warum es besser war«, sagte Tonio. »Hier sieht uns keiner. Los geht's.«
Sergio atmete innerlich auf. Er hatte schon befürchtet, dass sie hier schon wieder nur auf Beobachtungsposten standen.
Sie stiegen aus und sahen sich kurz um. Dann gingen sie durch das Tor.
Auf die Wendeltreppe zu.
»Was soll das heißen, etwas anderes?«, rief Runnicle ins Telefon.
Sonst war das alles ganz anders abgelaufen. Er hatte Nachrichten bekommen, und das auf die ganz altmodische Art. Nicht über Handy oder sonst wie elektronisch, sondern ganz einfach auf Papier im Umschlag, mit der Post. Kurz und knapp. Angaben zu den Treffen. Und dann war er mit einem Batzen Bargeld wieder nach Hause gegangen. Das ermöglichte ihm zusammen mit dem geruhsamen Job in Ridgefield ein schönes Leben.
»Kriege ich mehr Geld?«, fragte Runnicle. Es war ihm einfach herausgerutscht.
Der Mann auf der anderen Seite der Leitung ließ ein paar Sekunden verstreichen, bevor er antwortete. Und es war natürlich nicht die Antwort, die Runnicle hören wollte.
»Wenn man bedenkt, dass ich dich komplett in der Hand habe, reißt du die Klappe ganz schön weit auf«, sagte er kalt.
»Hören Sie zu ...«, begann Runnicle.
»Nein, jetzt hörst du mir zu«, wurde er unterbrochen. »Du tust, was ich sage. Egal, was es ist. Du bist nicht in der Position, irgendwelche Forderungen zu stellen.«
Runnicle holte Luft und wollte etwas sagen, da knackte es in der Leitung. Der andere hatte aufgelegt.
Ein lautes Glockengeräusch, das von der Mikrowelle herrührte, zeigte, dass die Spaghetti fertig waren. Runnicle war der Appetit vergangen. Nachdenklich stand er auf und sah aus dem Fenster. Drüben ragte der Turm der Kirche auf. Daneben, in einem Bungalow, wohnte Reverend Snyder, zu dem Runnicle ein gutes Verhältnis hatte.
Der Mann mit dem gutmütigen Großvatergesicht erinnerte ihn an seinen eigenen Grandpa. Er war gestorben, als Runnicle gerade mal neun gewesen war. Danach hatte er nur noch seine Großmutter gehabt, die nur fünf weitere Jahre lebte. Und dann hatte Runnicles Zeit in den Waisenhäusern begonnen. Eine furchtbare Zeit, die Grandpas Tod eingeläutet hatte ...
Na ja, wenigstens hatte ihm das Schicksal Reverend Snyder beschert. Dem Geistlichen war sofort aufgefallen, dass Runnicle etwas bedrückte. Hin und wieder unterhielten sie sich. Dabei hatte Snyder Runnicle immer wieder zum Gottesdienst eingeladen. Leider neigte Runnicle dazu, sonntags sehr lange zu schlafen, wenn er nicht sowieso in der Keeler Tavern Dienst hatte. Das Museum war auch sonntags geöffnet.
Langsam legte sich die Unruhe wieder, die der Anruf in ihm ausgelöst hatte.
Okay, es hatte keinen Zweck, hier zu versauern. Ridgefield war nicht New York. Aber es wartete auf ihn, der nun einen angenehmen Feierabend verbringen wollte. Am besten, er ging in