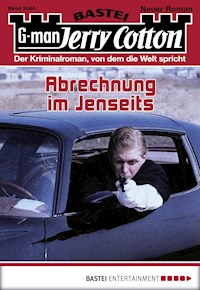1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
In New York verschwand die siebzehnjährige Tochter von Senator Lawrence Farmer spurlos auf dem Weg von der Highschool nach Hause. Zur gleichen Zeit tauchte ein Mann unter, der wegen Korruption angeklagt und gegen Zahlung einer Kaution freigelassen worden war: New Yorks Gouverneur Ron Quintero. Dessen Freund, der Immobilienmogul Gilbert Newcomb, war mächtig sauer, weil er das Geld für die Kaution bezahlt hatte und nun nicht zurückerhielt. Er heuerte einen Kopfgeldjäger an. Schnell stellte sich heraus, dass vor zwei Monaten ein weiteres Mädchen als vermisst gemeldet worden war. Und schon bald erkannten wir vom FBI, dass ein düsterer Zusammenhang zwischen diesen Ereignissen bestand ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 145
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhalt
Cover
Kopfgeld
Vorschau
Impressum
Kopfgeld
Chloe Farmer kauerte fröstelnd am Boden des feuchten Kellers, der ihr Zuflucht gewährte. Oben, hinter dem fensterlosen, vergitterten Schacht unter der Decke, sah sie die vorüberhastenden Beine der ahnungslosen Passanten.
Unsere Seele ist entronnen wie ein Vogel dem Netz des Vogelfängers.
Ihr Vater liebte es, die Bibel zu zitieren.
Was würde er denken, wenn er sie jetzt sehen könnte?
Stöhnend senkte sie die Lider über ihre brennenden Augen.
Die Erinnerungen an die furchtbaren Schmerzen und Demütigungen lasteten bei jedem Atemzug wie Blei auf ihrer Brust. Sie war erst siebzehn und hatte das Gefühl, dass etwas in ihr in rasendem Tempo gealtert war. Vielleicht, dachte sie, ist meine Seele wirklich davongeflattert und hat zurückgelassen, was nichts mehr taugt.
Okay, sie hatte bereits ein bisschen Erfahrungen mit LSD, ehe es passiert war. Doch jetzt gab es etwas, das viel stärker war.
Die Mischung aus Scham, panischer Angst und Todessehnsucht.
Es war ein früher und trüber Dienstagmorgen, keiner von uns hatte Zeit für ein Frühstück gefunden. Wir saßen zu viert bei Mr High, der in der Nacht von einer einwöchigen Konferenz in Washington zurückgekehrt war: Phil Decker, Kristen Steele, Dionne Jackson und ich. Steve Dillaggio und Zeerookah verbrachten eine Woche in Quantico, wo sie den FBI-Nachwuchs trainierten.
Es gab zwei brandheiße Themen. Zuerst sprachen wir über den Fall, den Phil und ich bearbeiteten.
Gouverneur Ron Quintero, angeklagt wegen eines schwerwiegenden Falls von Korruption, war gestern nicht zur Gerichtverhandlung erschienen und unverzüglich zur Fahndung ausgeschrieben worden. Der ewige Junggeselle, wie ihn die Boulevardblätter bezeichneten, war kinderlos, der Vater vor neun Jahren verstorben, kurz nachdem Quinteros Mutter mit einem wesentlich jüngeren Mann nach Europa durchgebrannt war. Der Gouverneur besaß keine Familie, weshalb viele mitfühlende Seelen mit ihm sympathisierten.
Nun, jetzt suchte die ganze Stadt Ron Quintero, und seine Beliebtheitswerte sanken rapide in den Rankings. Besonders an Autobahnraststätten, Flughäfen und Bahnhöfen lauerte man ihm auf. Aus dem mächtigsten Mann des Staats New York war ein armseliger Flüchtling geworden.
Phil und ich hatten eine Menge belastendes Material über ihn zusammengetragen. Wir konnten belegen, dass er einen frei gewordenen Senatssitz meistbietend zum Verkauf angeboten hatte. Wurde er schuldig gesprochen, drohten ihm vierzehn Jahre Haft.
»Zweifellos«, stellte Phil sarkastisch fest, »ist sein Kumpel Newcomb ziemlich sauer auf ihn.«
Der Immobilienmogul Gilbert Newcomb, eine gesellschaftlich und politisch einflussreiche Persönlichkeit, hatte Quintero die Kaution in Höhe von hunderttausend Euro hingeblättert. Phils Bemerkung spielte darauf an, dass sich bereits am frühen Morgen ein berüchtigter Kopfgeldjäger namens Hug Boyett telefonisch beim FBI gemeldet hatte, um ordnungsgemäß mitzuteilen, dass er im Auftrag Newcombs nach dem Flüchtigen suchte, um ihn bei der Polizei abzuliefern. Geschah das rechtzeitig, würde das Gericht die Kaution zurückerstatten, und Newcomb hätte nichts verloren außer einer herzerwärmenden Freundschaft.
Selbstverständlich hatte Boyett dem FBI seine Bereitschaft zur Kooperation angeboten. Das machten Typen wie er meistens so, um auf diese Weise ihrem fragwürdigen Gewerbe einen Hauch von Seriosität zu verleihen.
»Sehen Sie zu«, sagte Mr High, »dass Sie Quintero erwischen, ehe es Boyett tut. Sonst könnte bei einigen Wirrköpfen der Eindruck entstehen, das FBI hätte versagt.«
»Und ausgerechnet da«, ergänzte Phil, »wo es einem Politiker an den Kragen geht.«
»Immerhin«, sagte Kristen lächelnd, »waren es Jerry und du, die ihn vor Gericht gezerrt haben.«
»Klar, aber du weißt ja, wie das so ist mit Verschwörungstheoretikern. Sie biegen sich die Sache nach ihrem Geschmack zurecht.«
»Einige werden garantiert behaupten«, stimmte der Chef Phil zu, »das FBI habe mit der Festnahme Quinteros lediglich eine große Show veranstaltet, um ihn anschließend davonkommen zu lassen. Man tue eine Weile so, als suche man ihn, und lasse derweil Gras über die Sache wachsen.«
»Das wäre doch völlig unlogisch!«, empörte sich Dionne.
»Es geht nicht um Logik«, erwiderte der Chef.
»Worum dann, bitte?«, fragte Dionne.
»Um das Gefühl, verarscht zu werden«, erwiderte Kristen. »Von allen, der Regierung, den Medien und meinetwegen vom lieben Gott. Es geht um blinde Wut. Und die breitet sich in diesem Land aus wie eine Seuche.«
Mr High nickte schweigend. Dann wandte er sich wieder an Phil und mich. »Sie müssen Quintero auch erwischen, um zu verhindern, dass ihm Boyett zum Spaß ein paar Knochen bricht, ehe er ihn an uns oder das NYPD weiterreicht.«
»Das wird nicht leicht«, sagte ich. »Mit Sicherheit wird der Gouverneur bei niemandem auftauchen, der uns oder der Öffentlichkeit bekannt wäre. Wir sollten herausfinden, welche bislang unbekannten Personen mit ihm befreundet sind oder zumindest in Kontakt mit ihm stehen. Ich habe Ben gebeten, sich darum zu kümmern.«
»Davon abgesehen«, fügte Phil hinzu, »ist der Gouverneur eine Berühmtheit. Sobald er aus irgendeinem Mauseloch herausguckt, besteht die Wahrscheinlichkeit, dass ihn jemand sieht und es meldet.«
»Kommen wir zu Ihnen«, richtete sich der Chef an Kristen und Dionne. »Gibt es inzwischen irgendeinen Hinweis auf den Verbleib des verschwundenen Mädchens?«
»Nicht den geringsten.« Kristen zuckte unmerklich mit den Schultern, eine für sie ungewöhnliche Geste. Eigentlich lag es ihr nicht, Hilflosigkeit einzugestehen. »Es ist, als hätte sich Chloe Farmer in Luft aufgelöst.«
Ihr Foto war in zahlreichen Medien veröffentlicht worden. Es zeigte eine nachdenkliche Siebzehnjährige mit kastanienbraunem Haar und Ponyfrisur. Sie trug darauf einen grauen Hoodie und eine weite schwarze Cargohose.
»Sämtliche Cops der Stadt halten nach ihr Ausschau«, fuhr Kristen fort. »Wir haben immer wieder die Krankenhäuser kontaktiert. Nichts, kein Ergebnis.«
Vor fünf Tagen war Chloe auf dem Weg von der Highschool nach Hause spurlos verschwunden. Bisher hatte sich niemand gefunden, der etwas Auffälliges beobachtet hatte. Kristen und Dionne hatten Lehrer und Mitschüler gefragt, ob ihnen in letzter Zeit bei Chloe Anzeichen von Depression oder Angst aufgefallen seien, was von allen verneint wurde. Sie habe auch nicht angedeutet, dass sie nicht zu ihrem Vater zurückkehren wolle. Und Senator Laurence Farmer, der sie allein erzog, versicherte, dass Chloe das Haus am frühen Donnerstag voriger Woche in bester Stimmung verlassen habe.
»Glauben Sie«, fragte der Chef, »der Senator würde sich Ihnen anvertrauen, falls sich ein Entführer bei ihm meldet?«
Kristen runzelte die Stirn. »Ich denke schon, Sir. Er wirkt sehr beherrscht, was wohl darauf schließen lässt, dass er das Richtige tun wird.«
»Ich bin mir nicht sicher«, wandte Dionne ein. »Er ist bemüht, seine Fassung zu wahren, und das ist ihm anfangs noch ganz gut gelungen. Aber man sollte sich davon nicht täuschen lassen. Wir haben gestern noch einmal mit ihm gesprochen, und da machte er einen anderen Eindruck. Er war verschlossen und wortkarg und hatte Mühe, sich auf das Gespräch zu konzentrieren.«
»Na ja«, sagte Kristen, »er kam gerade von einer mehrstündigen Sitzung.«
»Bleiben Sie an ihm dran«, bat Mr High. Er schwieg kurz. »Gibt es eine Mitschülerin Chloes, die eng mit ihr befreundet ist?«
»Wir hatten den Eindruck, dass sich alle gleich gut mit ihr verstehen«, sagte Dionne. »Sie ist außerordentlich beliebt.«
»Hat sie keine Freundin, der sie besonders vertraut?«
»Wir wissen es nicht, Sir«, gestand Kristen.
»Dann finden Sie es schleunigst heraus«, sagte der Chef. »Falls das Mädchen ein Geheimnis hütet, wird die beste Freundin es am ehesten erfahren haben.«
»Stimmt, Sir, mir fällt etwas ein«, sagte Kristen. »Chloes Kunstlehrerin, Emily Sanders, spricht geradezu schwärmerisch über sie. Und das Verschwinden des Mädchens scheint ihr besonders zuzusetzen. Sie ließ durchblicken, dass sie Chloes Lieblingslehrerin sei. Vielleicht hat sie einen Tipp für uns, was Chloes Freundschaften betrifft.«
»Gut, sprechen Sie mit ihr.« Der Chef fuhr sich durchs Haar. »Die Gleichzeitigkeit der beiden Fälle setzt uns unter Druck. Ein flüchtiger korrupter Gouverneur und eine verschwundene Siebzehnjährige, zufällig die Tochter eines Senators. Obwohl beides nichts miteinander zu tun hat, werden gewisse Journalisten daraus im Handumdrehen einen einzigen großen Skandal konstruieren, wenn wir nicht schnell Ergebnisse liefern. Das könnte unsere Arbeit erheblich erschweren.«
Es klopfte, und Helen betrat den Raum. »Draußen steht eine junge eifrige Person, Sir. Sie will Sie unbedingt sprechen, ihr Name ist Barbara Smith. Sie kommt von der New York Post.«
»Du meine Güte«, Mr High seufzte, »es geht schon los. Ausgerechnet dieses Klatschblatt!«
»Was sage ich ihr, Sir?«
»Sie soll morgen kommen. Mit steht jetzt nicht der Sinn nach Smalltalk.«
»Was ich ihr natürlich nicht sagen werde«, erwiderte Helen und zog sich lächelnd zurück.
Hug Boyett sonnte sich in dem Gefühl, ein Gewinner zu sein. Anders ausgedrückt, er hatte noch nie einen Kampf verloren.
Anfang dreißig, ausgestattet mit einem zweihundert Pfund schweren Körper, was größtenteils auf Muskelmasse beruhte, und außerordentlich fintenreich in der Anwendung der fiesesten Tricks, mir deren Hilfe man die Gesundheit eines Gegners für immer ruinieren konnte, verfügte er über die besten Voraussetzungen.
Wenn er sich jemandem gegenübersah, der ebenfalls ein harter Bursche war, dachte er augenblicklich darüber nach, wer von ihnen beiden die Oberhand behalten würde, wenn es darauf ankam.
So wie jetzt.
Der Mann, der Boyett und seine Partnerin Ricky in einem schäbig möblierten Wohnraum auf der zwölften Etage einer heruntergekommenen Mietskaserne in der übelsten Ecke von Brownsville empfing, musste trotz seines fortgeschrittenen Alters – Boyett schätzte ihn auf Mitte fünfzig – als gefährlich gelten.
Vor Jahrzehnten, als Storm in Boyetts heutigem Alter war, zählte er noch zu Amerikas Wrestlingelite. Sein Name, René Storm, war in aller Munde gewesen. Bis Storm aus unbekanntem Grund von heute auf morgen den Ring verließ, in kurzer Zeit verarmte und schließlich in Vergessenheit geriet. Es gab nicht viele Leute, die wussten, dass er sich mit Gelegenheitsjobs durchschlug.
Er war ein großer, vierschrötiger Mann mit Halbglatze, der das schiefe Sofa, auf dem er wuchtig vorgebeugt hockte, zusammenzuquetschen drohte. Sein flaches bleiches Gesicht mit den ausgeprägten Kieferknochen und den winzigen umherhuschenden Augen verriet keinerlei Regung.
Die neunundzwanzigjährige Philippinerin Ricky, die eigentlich Ricarda Lee hieß und vor zehn Jahren ihren Wohnsitz von Manila in die USA verlegt hatte, verstand es durchaus, Storms brütendem Gleichmut die Stirn zu bieten. Währen Boyett seitlich von Storm in einem kurzbeinigen Sessel thronte, balancierte Ricky kerzengerade auf der vorderen Ecke ihres Stuhls und belauerte den Ex-Wrestler mit der stechenden Penetranz eines Raubvogels.
Ihr zierlicher kleiner Körper, der in einem eng sitzenden geblümten Hosenanzug steckte, und die kurz geschorenen schwarzen Haare, unter denen die Kopfhaut durchschimmerte, ließen sie auf eine puppenhafte Art schutzbedürftig erscheinen. Dieser Eindruck wurde noch verstärkt durch die glänzende Schminke, die Ricky mehrfach täglich auftrug.
Die kindliche Sweety-Masche stellte eine perfekte Tarnung für ihr wahres Wesen dar. Hug Boyett hätte sich keine perfektere Partnerin für ihr gemeinsames Geschäft vorstellen können. Sie unterhielten ein Kautionsbüro in Lower Manhattan und trieben die Gelder, die ihnen säumige Schuldner vorenthielten, selbst ein. Außerdem übernahmen sie als Kopfgeldjäger Aufträge von anderen Kautionsgebern, deren Gläubiger sich dem Zugriff der Justiz entzogen hatten.
Ricky war durch und durch bösartig, weshalb ihr die Arbeit besonderes Vergnügen bereitete. Und sie scheute kein Mittel, um Leute zum Reden zu bringen, die möglichweise wussten, wo sich ein flüchtiger Kautionsnehmer versteckte.
Und das war noch das Harmloseste, was man über Ricky sagen konnte.
Bisher hatte Storm auf Boyetts Frage, ob er über den momentanen Aufenthalt von Gouverneur Ron Quintero informiert sei, nicht geantwortet.
Stattdessen fragte er nun: »Wie sind Sie eigentlich auf mich gekommen?«
»Ich bin nicht befugt«, versetzte Boyett schroff, »darüber Auskunft zu erteilen.«
»Und ich«, knurrte Storm, »kann Sie und Ihre Partnerin jederzeit rauswerfen, wenn mir danach zumute ist.«
»Warum sollten Sie das tun?«
»Ganz einfach, weil Sie ungebeten hier aufkreuzen und mir auf die Nerven gehen.«
»Womöglich«, meldete sich Ricky mit ihrer leicht kratzigen Stimme zu Wort, »haben Sie auch nur ein schlechtes Gewissen.«
»Sind Sie komplett bescheuert?«, blaffte Storm sie an.
»Keineswegs, Sir. Gouverneur Quintero ist wegen Korruption angeklagt und hat sich deshalb verdrückt. Falls Sie ihn schützen ...«
»Er ist was?«, unterbrach Storm sie.
»Ach, das wissen Sie nicht? Ich meine, Sie sollten doch mitkriegen, was so läuft, oder?«
»Ich scheiße drauf, Lady, was so läuft. Hab mit mir selber genug zu tun.«
Hug Boyett verschränkte seine Hände und ließ die Knöchel geräuschvoll knacken. »Hören Sie, René, Sie waren mal ein großer Mann. Aber ehrlich, ich denke, von dem alten Glanz ist nicht viel übrig, oder? Sicher konnten Sie früher so mit Typen umspringen, die Sie genervt haben. Bloß versuchen Sie das nicht bei mir. Ich frage Sie höflich, ob Sie mir eine einzige Frage beantworten können. Und wissen Sie was? Ich lasse Sie auf der Stelle in Ruhe, wenn Sie es tun. Versprochen.«
Storm lachte hart. Dabei tasteten seine flattrigen Augen jede Stelle von Boyetts Körper ab, als suchten sie den richtigen Punkt für einen Überraschungsangriff.
»Was soll denn das für eine so wichtige Frage sein?« Storm dehnte jeden Vokal wie ein Gummiband und fletsche dabei seine schadhaften Zähne.
»Sind oder waren Sie mit dem Gouverneur befreundet?«
»Ich denke, ich sollte lieber mit Nein antworten.«
Hug Boyett war auf der Stelle elektrisiert, versuchte jedoch, es zu verbergen. »Das heißt, Sie sind Freunde?«
»Falsch kombiniert, Klugscheißer. Es heißt, dass wir es nicht sind. Dass ich es Ihnen aber liebend gerne vormachen würde, um Sie auf eine falsche Fährte zu locken.«
Boyetts Gemütszustand verfinsterte sich zusehends. Er musste jetzt höllisch auf der Hut sein, damit ihm nicht die Gäule durchgingen. »Etwas an mir passt Ihnen nicht, René, das ist nicht zu leugnen. Manchmal ist es eben so, man kommt irgendwo rein, und da ist jemand, der einen auf den ersten Blick nicht leiden kann. Okay, es juckt Sie in den Fingern, mich zu verarschen, das ist nicht weiter schlimm. Ich bin ein Menschenfreund und kann jede Menge einstecken. Doch wissen Sie, was ich nicht respektiere, René?«
Storm zuckte mit den Schultern. »Sagen Sie es mir.«
»Dass Sie sich nicht wie ein guter Staatsbürger verhalten. Da draußen läuft ein Kerl herum, dem mein Klient Mister Newcomb hunderttausend Dollar geliehen hat, damit er die Kaution hinterlegen kann, die ihn davor bewahrt, in den Knast zu wandern. Und was macht dieses Prachtexemplar eines korrupten Politikers? Quintero taucht unter, und mein Auftraggeber sieht in die Röhre. Finden Sie es nicht unmoralisch, Quintero zu decken?«
Storm schwieg mürrisch und schien sich plötzlich mehr für Ricky zu interessieren als für Boyett.
»Was starren Sie mich so an?«, ätzte Ricky. »Ich hoffe bloß, Sie wollen nicht mit mir anbändeln.«
Storm grinste anzüglich. »Lieber mit Ihnen als mit Ihrem Partner, Kleines. Sie sehen einfach besser aus.«
»Nettes Kompliment«, erwiderte Ricky ernsthaft. »Ich wusste, dass Sie's draufhaben, René, wirklich. Doch ehe wir beide so weitermachen, sagen Sie es mir, Hug kann ja so lange weghören: Wie steht es um Sie und Gouverneur Quintero?«
Das Sofa knarrte und ächzte bedenklich, als sich Storm daraus hochstemmte. Er baute seinen massigen Körper breitbeinig vor Hug Boyetts Sessel auf. »Ich will Sie nicht länger auf die Folter spannen, Boyett. Ich kenne Quintero nur aus dem Fernsehen und halte nicht viel von ihm. Das ist die Wahrheit. Verschwinden Sie jetzt, und nehmen Sie die Süße da mit, ehe ich ihr an die Wäsche gehe.«
Boyett blickte kurz zu Ricky hinüber. Er las aus ihrer Miene dasselbe, was er selbst dachte. Irgendwann würden sie zurückkehren und dem gealterten Wrestler eine Lehre erteilen.
Hug Boyett stand lächelnd auf, kurvte um Storm herum und ging mit Ricky zu der schmalen Diele hinüber, die durch einen filzigen Vorhang vom Wohnraum abgetrennt war. Storm kam nach, drängte sich an ihnen vorbei und öffnete die Wohnungstür.
»Sie sind echt ein schwieriger Patient«, verabschiedete sich Boyett von Storm, bevor er mit Ricky die Wohnung verließ. Er drückte ihm seine Visitenkarte in die Hand. »Für den Fall, dass Sie es sich anders überlegen. Ich würde Sie dafür großzügig entlohnen.«
»Lecken Sie mich am Arsch!«, versetzte Storm bissig. »Das würde mir als Belohnung schon reichen.«
Kristen und Dionne hatten Glück gehabt. Sie machten sich gleich nach der Sitzung bei Mr High auf den Weg zur Stuyvesant High School, wo sich Chloes Kunstlehrerin Emily Sanders umstandslos Zeit für sie nahm. Auf die Frage nach einer besonders innigen Freundschaft Chloes antwortete sie, ohne zu zögern.
»Oh ja, und ob es die gibt. Rosalie de Yong ist in vielem das Gegenteil von Chloe. Sie ist schüchtern, kontaktarm, ängstlich und ernster, als es einer Siebzehnjährigen guttut. Doch vermutlich ist diese Verschiedenheit genau der Grund für die enge Bindung der beiden.«
Nach Absprache mit dem Schuldirektor und nachdem sie telefonisch Rosalies Mutter informiert hatten, trafen Kristen und Dionne in einem leer stehenden Unterrichtsraum mit dem Mädchen zusammen. Ein dichter Regenschleier hinter den Fenstern ließ lediglich tristes Licht hereinsickern. In das gedämpfte Rauschen der Wassermassen mischte sich entferntes Donnergrollen.
Rosalie wollte sich nicht setzen, sondern blieb in der Nähe der Tür stehen, als ginge es darum, sich einen Fluchtweg offenzuhalten. Sie war mollig, trug ein verwaschenes kariertes Baumwollhemd, graue Jeans und grüne Sneaker. Durch die hochgezogenen Schultern wirkte sie noch kleiner, als sie ohnehin war. Ihr rundliches Gesicht umrahmten dünne blonde, in der Mitte nachlässig gescheitelte Haare.
Kristen und Dionne verzichteten ebenfalls auf einen Stuhl und stellten sich zu Rosalie, wobei sie darauf achteten, ihr nicht zu nahe zu kommen.
»Ich kann Ihnen bestimmt nicht weiterhelfen«, sagte das Mädchen mit schwacher Stimme. Dabei zog es die Stirn kraus. Instinktiv wandte es sich an Dionne, als erwartete es von der zierlichen Afroamerikanerin mehr Mitgefühl.
»Weißt du denn«, fragte Dionne ruhig, »worüber wir mit dir reden wollen?«
Rosalie Mund zuckte unmerklich, ehe sie erwiderte: »Na klar, über Chloe, aber ehrlich, ich hab keine Ahnung.«
»Keine Ahnung von was?«
»Wo sie steckt und so. Warum sie so was macht. Und überhaupt.« Sie schüttelte den Kopf.
»Glaubst du«, warf Kristen ein, »dass Chloe absichtlich verschwunden ist?«
Rosalie riss erschrocken die Augen auf. »Um Himmels willen, nein! Dafür müsste sie jedoch einen Grund haben, nicht wahr?«
»Und hatte sie einen?«, hakte Kristen nach.
Rosalie verschränkte die Arme vor der Brust. »Woher soll ich das wissen?«