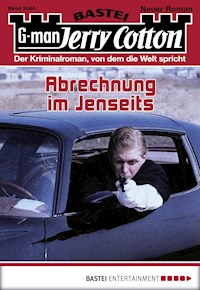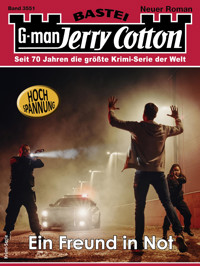
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Unser alter Bekannter Angus McDougal war in Los Angeles, der Stadt der Engel, verhaftet worden. McDougal hatte einen Anruf frei und kontaktierte Phil und mich. Wir besuchten ihn in der Untersuchungshaft. Er berichtete uns, dass ihn die Frau, die er angeblich getötet haben sollte, um Hilfe gebeten habe. Als er in ihrem Haus eingetroffen war, war sie bereits tot gewesen. Alles sah arrangiert aus. Mein Partner und ich nahmen die Ermittlungen auf. Und dann verübte jemand im Gefängnis einen Mordanschlag auf unseren Freund ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 131
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhalt
Cover
Inhalt
Ein Freund in Not
Vorschau
Hat Ihnen diese Ausgabe gefallen?
Impressum
Cover
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsbeginn
Impressum
Ein Freund in Not
Als er das spärlich beleuchtete Haus durch die offene Tür betreten hatte, schaute er sich um. Es war still, unheimlich still. Im Wohnzimmer zuckte er unwillkürlich zusammen. Auf dem Boden lag eine Frau. Reglos. Inmitten von Blut. Er beugte sich zu ihr und tastete nach ihrem Puls. Nichts. Sie war tot.
»Leb wohl, geliebte Janet«, sagte er mit rauer Stimme.
In dem Moment stürmten schwer bewaffnete Cops in das Haus, die Mündungen ihrer Pistolen und die grellen Leuchtkegel ihrer Taschenlampen richteten sich auf ihn.
»Hände hoch! Und langsam aufstehen!«, befahl einer der Polizisten.
Er leistete ohne Widerstand Folge.
»Wie heißen Sie?«, fragte der Cop, nachdem er ihm Handschellen angelegt hatte.
»Angus, Angus McDougal«, antwortete er.
Es war schon dunkel, als Phil und ich mit dem Jaguar gemächlich durch die Häuserschluchten von Manhattan fuhren. Trotzdem waren auf den Straßen noch viele Leute unterwegs.
»Endlich Feierabend«, sagte Phil und seufzte.
In dem Moment klingelte mein Telefon. Unbekannter Anrufer. Anhand der Vorwahl wohl aus Los Angeles.
»Hallo?«, meldete ich mich und stellte auf laut.
»Jerry?«, hörte ich eine bekannte Stimme. »Hier ist Angus McDougal. Ich bin in Los Angeles und habe gerade ein Problem.«
Ich schaute zu Phil. »Was für ein Problem?«
McDougal redete nicht lange um den heißen Brei herum. »Ich bin verhaftet worden. Im Haus einer Freundin, die tot auf dem Boden lag.«
»Wie bitte?«, gab Phil erschrocken von sich. »Man hat Sie doch nicht etwa mit der Mordwaffe in der Hand erwischt?«
»Nein, das nicht«, antwortete McDougal. »Die habe ich nicht angefasst. Man hält mich trotzdem für den Täter. Ich frage nur ungern, aber ich kenne in L. A. und Umgebung niemanden und dachte, Sie wüssten, wer mich unterstützen könnte. Juristisch und darüber hinaus.«
»Wir kommen persönlich«, sagte ich, ohne nachzudenken.
»Wirklich? Beide?«
Ich schaute Phil an. Er nickte wortlos.
»Ja«, antwortete ich. »Wir müssen das nur erst mit unserem Chef abklären. Wo genau hält man Sie fest?«
»Im Moment befinde ich mich im Sheriff's Department nördlich von Malibu, Agoura Road. Keine Ahnung, ob beziehungsweise wie lange sie mich hier behalten.«
»Das finden wir heraus. Wahrscheinlich kriegen wir erst morgen früh einen Flug. Also werden wir um die Mittagszeit da sein. Kommen Sie so lange klar?«
»Sicher«, sagte McDougal. »Die Kosten für Flüge und Unterkunft übernehme ich natürlich.«
»Vielleicht könnte ich jemanden in L. A. fragen, ob er einen guten Anwalt kennt. Das muss ich abklären. Es war gut, dass Sie uns angerufen haben. Wir melden uns.«
»Danke. Bis morgen«, sagte McDougal und legte auf.
»Angus McDougal wurde verhaftet?«, sagte Phil. »Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Der Typ ist ein Ninja, ein Schatten, ein Meister der Tarnung. Der lässt sich nicht so leicht verhaften.«
»Keine Ahnung, was genau passiert ist, wie es aussieht, haben ihm diese besonderen Fähigkeiten diesmal nichts genutzt. Wir sollten mit Mister High abklären, dass wir ein paar Tage frei kriegen. Außerdem sollten wir herausfinden, was geschehen ist. Kannst du nachschauen, ob schon ein Bericht vorliegt?«
Phil nickte und nahm den Laptop zur Hand. »McDougal wurde im Haus von Janet Coulson in Malibu festgenommen. Auf frischer Tat, wie hier steht. Die Frau war tot, die Mordwaffe ein Schwert. Das spricht nicht gerade für den alten Schotten.«
»So alt ist er gar nicht«, sagte ich. »Aber du hast recht, das spricht nicht für ihn. Er wird uns einiges zu erklären haben. Ich kontaktiere Mister High.«
Wenige Sekunden später hatte ich unseren Chef am Telefon und schilderte ihm die Situation.
»Und Sie wollen wirklich nach L. A.?«, hakte er nach. »Nach dem, was in Japan passiert ist?«1
»Ja, Sir, wir wollen sehen, was los ist, und ihm soweit möglich helfen. Natürlich werden wir vorsichtig sein, damit wir nicht wieder in eine Falle tappen.«
»Gut, dann nehmen Sie sich ein paar Tage frei«, sagte er. »Halten Sie mich bitte auf dem Laufenden. Insbesondere, wenn etwas Unerwartetes geschieht.«
»Machen wir, Sir«, sicherte ich ihm zu, und wir beendeten das Gespräch.
Phil schaute mich an. »Etwas Unerwartetes?«
»Er kennt McDougal. Da kann immer etwas passieren. Sicher hat McDougal auch nicht damit gerechnet, heute verhaftet zu werden.«
»Bist du dir sicher?«, fragte Phil.
Ich zuckte mit den Schultern. »Keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass McDougal das alles geplant hat, damit wir nach Los Angeles fliegen. Völlig ausschließen will ich es auch nicht. Was auch immer los sein mag, wir werden es herausfinden.«
Phil lächelte. »Sicher. Im Gegensatz zu unserem letzten Treffen mit McDougal in Japan haben wir diesmal unsere Waffen dabei und können auf den FBI-Apparat zurückgreifen. Das beruhigt mich ein wenig.«
Der Flug vom JFK Airport zum Los Angeles International Airport dauerte knapp sechs Stunden. Damit hatten wir gleichzeitig eine neue Zeitzone erreicht, mit drei Stunden Zeitunterschied. Rein von der Uhrzeit her schien es also, als hätte der Flug nur drei Stunden in Anspruch genommen.
Während ich die Zeit über den Wolken nutzte, um mich mit aktuellen Gegebenheiten in L. A. und vor allem Malibu vertraut zu machen, lernte Phil ein paar japanische Ausdrücke.
»Man kann nie wissen«, sagte er und setzte den Kopfhörer wieder auf, nachdem wir uns kurz darüber unterhalten hatten.
In L. A. angekommen, mieten wir uns einen deutschen Sportwagen und fuhren zum Gefängnis, in dem McDougal in Untersuchungshaft saß. Es dauerte eine Weile, sich als Besucher einzutragen und die üblichen Sicherheitsprotokolle zu erfüllen. Unsere Waffen mussten wir zur Verwahrung abgeben.
Als wir McDougal schließlich in einem karg eingerichteten Raum begegneten, war er erfreut, uns zu sehen.
»Schön, dass Sie es so schnell einrichten konnten«, sagte er.
»Gerne«, erwiderte ich, und wir nahmen Platz. »Wollen Sie uns im Detail erzählen, was passiert ist?«
Er räusperte sich. »Sie kommen gleich zur Sache, das gefällt mir. Janet Coulson ist ... war eine alte Freundin, genauer gesagt eine Ex-Freundin. Wir waren ein halbes Jahr zusammen. Das ist eine ganze Weile her. Tatsächlich hatten wir seit etwa sieben Jahren keinen Kontakt. Vor knapp einer Woche hat sie mir eine Nachricht geschickt. Sie wollte mit mir reden. Wir haben telefoniert. Sie meinte, sie habe Probleme in ihrem Job. Ihr Chef sei kein netter Kerl, und sie bräuchte jemanden, der mal ein ernstes Wort mit ihm rede. Bei der Gelegenheit wollte sie mir gleich die Stadt zeigen. Ich war absolut bereit, ihr zu helfen, da sie mir in gewisser Weise immer noch wichtig war. Ich habe ihre Beweggründe, mich zu kontaktieren, also nicht hinterfragt.«
»Und dann sind Sie gestern in L. A. gelandet?«, fragte Phil.
McDougal nickte. »Ich habe sie vom Flughafen angerufen. Sie meinte, ich solle am besten ein Taxi zu ihrem Haus nehmen. Ich habe mir lieber einen Wagen gemietet und bin zu ihr gefahren.«
»Sie haben sich vorher kein Hotel oder eine andere Bleibe gesucht?«, fragte Phil.
»Nein, sie meinte, ich könne bei ihr übernachten. Sie hat ein großes Haus. Die Fahrt dauerte über eine Stunde. Dort sah ich, dass die Haustür offen stand. Es war niemand zu sehen, nichts zu hören, also trat ich ein. Es dauerte nicht lange, da fand ich sie auf dem Boden liegend tot. Ihr Körper war noch warm. Neben ihr lag ein Schwert, dem Blut und der Wunde nach zu urteilen, die Tatwaffe. Ich überlegte noch, was zu tun wäre, als die Cops hereinstürmten.«
»Hätten Sie nicht einen Ihrer besonderen Tricks anwenden und verschwinden können?«, fragte Phil.
»Vielleicht«, antwortete McDougal. »Ich muss zugeben, dass ich geschockt war. Janet dort liegen zu sehen, ich meine, ich kenne den Tod. Doch das war unerwartet. Natürlich hätte ich die Beamten überwältigen und fliehen können. Aber das hätte mir weitere Unannehmlichkeiten eingebracht. Außerdem hatte ich nichts verbrochen. Auch in den USA gilt die Unschuldsvermutung.«
»Unschuldig, bis das Gegenteil bewiesen beziehungsweise eine rechtskräftige Verurteilung erfolgt ist«, sagte ich. »So lautet das Gesetz. Bloß standen Sie neben dem Opfer, die Tatwaffe lag daneben. Damit sind Sie der Hauptverdächtige. War sonst wirklich niemand in der Nähe des Tatorts?«
»Ich habe niemanden gesehen«, sagte McDougal. »In direkter Nähe des Hauses stand nur ein blauer Ford, von dem ich annehme, dass es sich um ihren Wagen handelt. Die Polizisten, mit denen ich zu tun hatte, waren nicht gerade redselig, um es nett auszudrücken. Sie haben mich verhaftet und so behandelt, als wäre ich der Täter.«
»Ihrer Aussage nach haben Sie nichts mit dem Mord zu tun«, sagte ich. »Jetzt müssen wir nur noch Beweise finden, die das bestätigen, und den Verdacht, dass Sie der Täter sind, entkräften.«
»Ich habe sie nicht getötet«, sagte McDougal mit finsterer Miene. »Allerdings hatte ich die ganze Nacht Zeit nachzudenken. Ich gehe inzwischen davon aus, dass Janet in ein Komplott verwickelt war, bei dem es um mich ging. Bestimmt hat derjenige, der die Fäden gezogen hat, ihr verschwiegen, dass ihr Tod Teil des Plans ist. Letztlich ist sie wegen mir gestorben.«
»Das tut mir leid«, sagte ich. »Manchmal setzen Gegner unsere Emotionen, Gefühle und Menschen, zu denen wir eine Verbindung haben, gegen uns ein. Das ist verwerflich, absolut niederträchtig, aber es kommt vor, insbesondere da wir es mit oft mit Kriminellen zu tun haben.«
McDougal nickte schweigend. Er wusste genau, was ich meinte.
Phil räusperte sich. »Haben Sie in L. A. irgendwelche Feinde, die hinter der Sache stecken könnten? Jemand, den Sie ins Gefängnis gebracht oder auf andere Weise verärgert haben könnten?«
McDougal runzelte die Stirn. »Ich war tatsächlich, abgesehen von einem Trip als Jugendlicher, noch nie in L. A. Auch habe ich hier noch nie gearbeitet. Daher wüsste ich nicht, wer einen derartigen Groll gegen mich hegen könnte, dass er dafür den Tod eines Menschen in Kauf nimmt.«
»Vielleicht fällt Ihnen ja noch jemand ein, der hinter der Sache stecken könnte«, meinte Phil. »Bis dahin werden wir uns an die Arbeit machen.«
Ich nickte zustimmend. »So ist es. Wir werden schauen, ob uns die Kollegen vom FBI L. A. unterstützen können. Was ist mit einem Anwalt? Sie sagten, Sie hätten noch keinen, richtig?«
»Nein, ich kenne hier niemanden«, antwortete McDougal. »Theoretisch könnte jemand aus Schottland kommen, doch ich denke, dass ein lokaler Rechtsexperte sinnvoller ist. Ein guter Anwalt, kein Pflichtverteidiger. Können Sie mir jemanden empfehlen?«
»Dazu müssen wir uns selbst schlau machen«, sagte ich. »Los Angeles ist uns zwar nicht ganz unbekannt, oft waren wir hier auch nicht. Aber ich weiß schon, wen ich fragen kann.«
McDougal nickte. »Danke für Ihre Unterstützung.«
»Dann machen wir uns jetzt auf den Weg«, sagte ich und stand zusammen mit Phil auf.
Wir verabschiedeten uns von McDougal und verließen das Gefängnis.
»Und? Was hältst du von der Sache?«, wollte ich von Phil wissen.
»Wahrscheinlich sagt er die Wahrheit, wobei wir auch offen dafür sein sollten, dass es nicht so ist«, antwortete Phil.
»Du zweifelst an seiner Version der Geschichte?«
Phil lächelte. »Beruflich begründeter Argwohn. Darüber hinaus waren wir wegen McDougal schon mehr als einmal in gefährliche Situationen verstrickt. Ich kann ihn eigentlich gut leiden, auch das hat seine Grenzen. Immerhin besteht die Möglichkeit, dass er impulsiv gehandelt und die Frau getötet hat. Er weiß, wie das geht. Wie sagte er treffend: Ich kenne den Tod.«
»Nun gut, mein Advocatus Diaboli, dann konzentrierst du dich darauf, alles zu finden, was auf seine Schuld hinweist. Ich bin mir sicher, dass er der Frau kein Haar gekrümmt hat. Schauen wir zuerst, was die Fakten sagen. Wir sollten zum hiesigen FBI Field Office fahren und Guten Tag sagen.«
Phil grinste. »Meinst du damit etwa einen bestimmten Agent? Du sagtest McDougal, du wüsstest, wen du fragen könntest.«
»Natürlich«, antwortete ich.
Das FBI Field Office L. A. befand sich am Wilshire Boulevard, nicht einmal eine Meile von Beverly Hills entfernt. Zusammen mit Chicago, Miami, New York und Washington gehörte es zu den größten fünf Field Offices. Wir hatten kein Problem, die Sicherheitsschleuse zu passieren, und wollten gerade mit dem Fahrstuhl nach oben fahren, als uns Sarah Hunter entgegenkam.
»Phil, Jerry, willkommen in L. A.«, sagte sie und umarmte zuerst Phil und dann mich.
Wir schauten uns kurz in die Augen, und das allein erinnerte mich an all das, was wir zusammen erlebt hatten und was ich für sie empfunden hatte. Schwer zu sagen, ob es ihr ähnlich ging.
»Was genau führt euch in die Stadt der Engel?«, fragte sie. »Am Telefon habt ihr keine Details verraten.«
»Es geht um einen Freund, der in Schwierigkeiten steckt«, antwortete ich.
»Einen Freund, den ich kenne?«, wollte sie wissen.
»Nein, ich glaube nicht, dass ihr schon das Vergnügen hattet. Er ist Schotte und ...«
»... und noch einiges mehr«, beendete Phil meinen Satz.
»Dann lasst uns hochfahren, wir können das in meinem Büro besprechen«, sagte sie und führte uns zum Fahrstuhl.
Wenige Sekunden später fuhren wir zusammen mit drei Männern nach oben. Wir sprachen kein Wort. Aber ich merkte, dass ich mich irgendwie zu Sarah hingezogen fühlte. Wir hatten uns lange nicht gesehen, trotzdem war da wieder dieses vertraute Gefühl.
»Du bist ja jetzt schon ein paar Jahre in L. A.«, bemerkte Phil, nachdem wir ausgestiegen waren. »Hast du dich gut eingelebt?«
»Im Großen und Ganzen schon«, sagte Sarah. »Ab und zu vermisse ich den New Yorker Regen, die engen Häuserschluchten und dergleichen.«
»Ja, so ist das wohl, wenn man in einer Wüstenregion in einem Erdbebengebiet lebt«, bemerkte Phil.
»An die Beben habe ich mich gewöhnt«, meinte sie. »Spürbare Beben kommen alle paar Wochen vor, sind für gewöhnlich jedoch nicht besonders stark. Aber du hast recht, wegen der Erdbebengefahr wird hier selten so hoch gebaut wie in New York. Und wenn, sind hohe Sicherheitsauflagen zu erfüllen. Ich selbst wohne in einem Bungalow, was hier nicht unüblich ist.«
»Bungalow? Hört sich gar nicht schlecht an.«
»Ist es auch nicht. Außerdem sind die Mieten hier niedriger als in Manhattan. Man kann sich also mehr Platz leisten. Das hängt natürlich auch davon ab, wo man wohnt. So viel zu L. A. Wer ist dieser Freund, der in Schwierigkeiten steckt? Und was macht er hier?«
Wir erklärten ihr die Situation.
»Er ist was? So ein Ninjatyp?«, gab sie überrascht von sich.
»Ja, so eine Art«, antwortete Phil. »Er hatte uns mal nach Japan eingeladen und da haben wir noch mehr von diesen Typen kennengelernt. Allerdings war das keine friedliche Begegnung. Das ist eine andere Geschichte. Jetzt geht es um den Mord und die Tatsache, dass McDougal verdächtigt wird.«
»Na ja, wenn ein Ninja neben einer Frau steht, die mit einem Schwert getötet wurde, würde ich auch annehmen, dass er der Täter ist«, sagte Sarah.
»Das mit dem Ninja vergiss besser schnell wieder«, sagte Phil. »Das ist nicht offiziell bekannt und sollte auch so bleiben. Er agiert lieber unterhalb des Radars. Passt wohl zu dem, was er macht.«
»Was macht er denn?«, wollte Sarah wissen. »Ninja sein ist ja kein Beruf. Oder etwa doch?«
»Wie es aussieht, unterstützt er überall auf der Welt Behörden, die mit Ninjas und dergleichen Schwierigkeiten haben. Man könnte ihn wahrscheinlich als eine Art Privatdetektiv betrachten«, erklärte Phil.
Sie zeigte sich amüsiert. »Privatdetektiv? Mit Schwert und schwarzem Anzug? Ungewöhnlich, wenn du mich fragst. Aber gut, wenn ihr sagt, dass er in Ordnung ist, dann glaube ich euch das. Natürlich helfe ich euch, so gut ich kann. Was braucht ihr denn?«
»Zunächst einmal sollte er, wie ich schon am Telefon angedeutet hatte, einen guten Anwalt bekommen«, antwortete ich. »Also keinen Pflichtverteidiger. Jemanden, der sein Handwerk versteht und ihn aus der Untersuchungshaft bekommt.«
Sie überlegte kurz und nickte. »Da habe ich mir bereits Gedanken gemacht. Ich kann gleich anrufen, um herauszufinden, ob er Zeit hat. Sonst noch etwas?«
»Das Übliche: Zugriff auf die Berichte, forensische Untersuchung, all das. Wenn möglich, würden wir einige der Arbeiten gerne von hier erledigen.«
»Das sollte kein Problem sein. Wir haben, soweit ich weiß, noch ein oder zwei freie Büros. Ich rede mit unserem Chef und regele das.« Sie verschwand und kam schnell wieder. »Alles klar. Ich zeige euch euer Büro.«